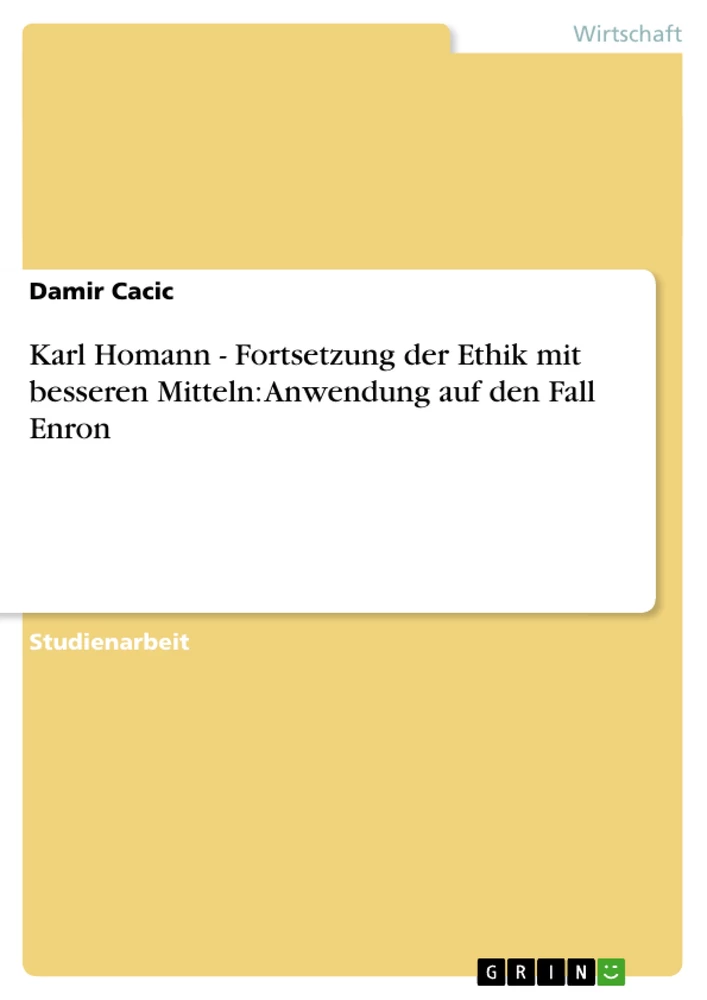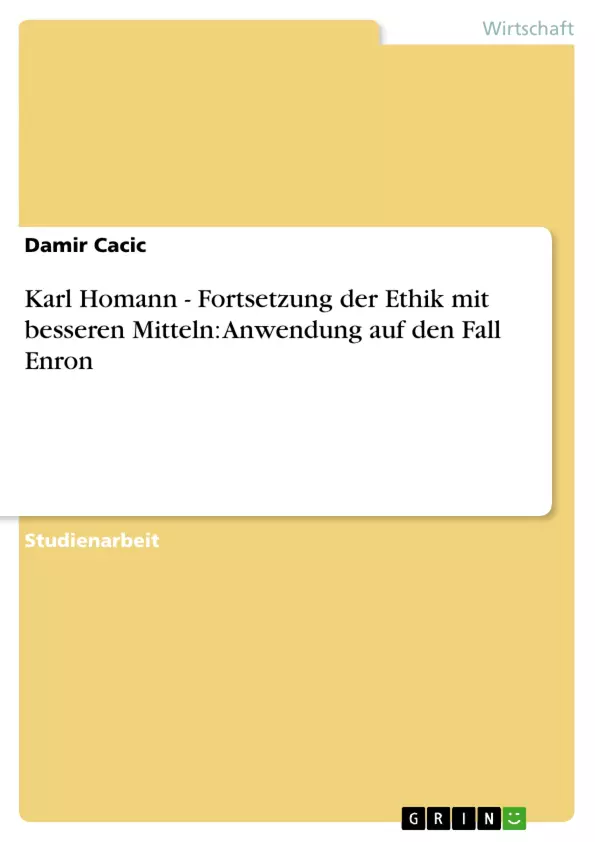1. Die Notwendigkeit der Gewinnmaximierung in der Unternehmung
Unternehmen haben viele Ziele, wobei unter Ökonomen die Frage, ob Unternehmen nur nach dem Gewinnmaximierungskalkül1 agieren sollten, umstritten ist. Ohne an dieser Stelle partialanalytische mikrökonomische Studien zu bemühen, herrscht in den Wirtschaftswissenschaften Einigkeit darüber, dass Unternehmen vor allem langfristig Gewinne maximieren sollten, um am Markt bestehen zu können2. Denn nur Unternehmen, die Profit erzielen, können sich noch andere Ziele leisten. Wenn nun Gewinnmaximierung das Oberziel einer Unternehmung ist, dann stellt sich die Frage, nach welchen Gesichtspunkten man andere Unternehmensziele bewerten soll. Wenn man ein wertfreies Bewertungsmodell für die Analyse von Handlungsmustern und -zielen sucht, dann bietet es sich an, Interaktionen und Zielformulierungen auf Kosten- und Nutzenüberlegungen hin zu untersuchen. Dieser ökonomische Ansatz3 eines Gary Becker bietet die Möglichkeit, systematisch über Vorteilsüberlegungen zu Erkenntnissen von interagierenden Wirtschaftssubjekten und Handlungssituationen jedweder Art zu gelangen4. Das Ethikkonzept von Homann baut auf solchen Vorteils- und Anreizüberlegungen auf, um darüber hinaus aufzuzeigen, wie z.B. konfligierende Interessen ökonomisch sinnvoll überwunden werden können. Wenn eine Unternehmung ihren Gewinn maximieren will und die Arbeitnehmerschaft konträre Interessen verfolgt, dann gilt es nach Homann einen derartigen Rahmen an Regeln zu gestalten, der die Anreizstrukturen beider Parteien berücksichtigt, um Kooperationsgewinne zu erzielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Notwendigkeit der Gewinnmaximierung in der Unternehmung
- 2. Institutionenethik als Primat für ethisches Handeln
- 2.1 Ordnungs- versus Handlungsethik
- 2.2 Dilemmastrukturen und Wettbewerb
- 2.3 Anreize und Wettbewerb
- 2.4 Überwindung von Dilemmastrukturen durch die Ordnungsethik
- 3. Das Versagen des Ordnungsrahmens im Fall Enron
- 3.1 Die Liaison von Kontroll- und Beratungsinstanz
- 3.2 Die Konsolidierungskreisproblematik von SPEs nach US-GAAP
- 3.3 Anreizbedingungen im Fall Enron
- 4. Plädoyer für einen ordnungstheoretischen Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht das Ethikkonzept von Karl Homann im Kontext des Fallbeispiels Enron. Ziel ist es, die Anwendung der Ordnungsethik auf den Fall Enron zu analysieren und zu beurteilen, inwieweit das Versagen des Ordnungsrahmens die Entstehung der Enron-Krise erklärt.
- Gewinnmaximierung in der Unternehmung
- Ordnungs- versus Handlungsethik
- Dilemmasituationen und Wettbewerb
- Anreize und Anreizstrukturen
- Das Versagen des Ordnungsrahmens im Fall Enron
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Notwendigkeit der Gewinnmaximierung in der Unternehmung. Dabei wird der ökonomische Ansatz von Gary Becker zur Erklärung von Handlungsmustern und Zielformulierungen anhand von Kosten- und Nutzenüberlegungen vorgestellt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Institutionenethik als Primat für ethisches Handeln. Die Arbeit stellt Homans Konzept der Ordnungsethik dar, welches sich durch staatliche Rahmenbedingungen und Normen sowie ökonomische Vorteilskalkulationen und Anreizüberlegungen charakterisiert.
Kapitel 3 analysiert das Versagen des Ordnungsrahmens im Fall Enron. Die Arbeit beleuchtet die Verbindung von Kontroll- und Beratungsinstanz, die Konsolidierungskreisproblematik von SPEs nach US-GAAP sowie die Anreizbedingungen im Fall Enron.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Wirtschafts- und Unternehmensethik, Ordnungsethik, Handlungsethik, Anreizstrukturen, Dilemmastrukturen, Gewinnmaximierung, Wettbewerb, Fallbeispiel Enron.
Häufig gestellte Fragen zu Karl Homann und dem Fall Enron
Was ist das Kernkonzept der Ethik nach Karl Homann?
Homann vertritt eine Ordnungsethik, die ethisches Handeln primär über Rahmenbedingungen und Anreizstrukturen steuert, statt an das individuelle Gewissen zu appellieren.
Warum ist Gewinnmaximierung laut Homann notwendig?
Langfristige Gewinne sind Voraussetzung für das Überleben am Markt; nur profitable Unternehmen können sich die Verfolgung weiterer (sozialer) Ziele leisten.
Was war die Ursache für den Enron-Skandal?
Die Arbeit analysiert das Versagen des Ordnungsrahmens, insbesondere die problematische Verbindung von Kontrolle und Beratung sowie Lücken in den Bilanzierungsregeln (SPEs).
Was unterscheidet Ordnungs- von Handlungsethik?
Ordnungsethik setzt auf Regeln und Anreize (Systemebene), während Handlungsethik auf die moralische Entscheidung des Einzelnen fokussiert.
Wie können Dilemmastrukturen überwunden werden?
Durch die Gestaltung eines Rahmens, der Kooperation belohnt und Fehlverhalten (wie bei Enron) durch wirksame Anreize und Sanktionen verhindert.
Welche Rolle spielt der ökonomische Ansatz von Gary Becker?
Homann nutzt Beckers Modell der Kosten-Nutzen-Überlegungen, um menschliches Verhalten und Interaktionen systematisch zu analysieren.
- Citar trabajo
- Damir Cacic (Autor), 2006, Karl Homann - Fortsetzung der Ethik mit besseren Mitteln: Anwendung auf den Fall Enron , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70625