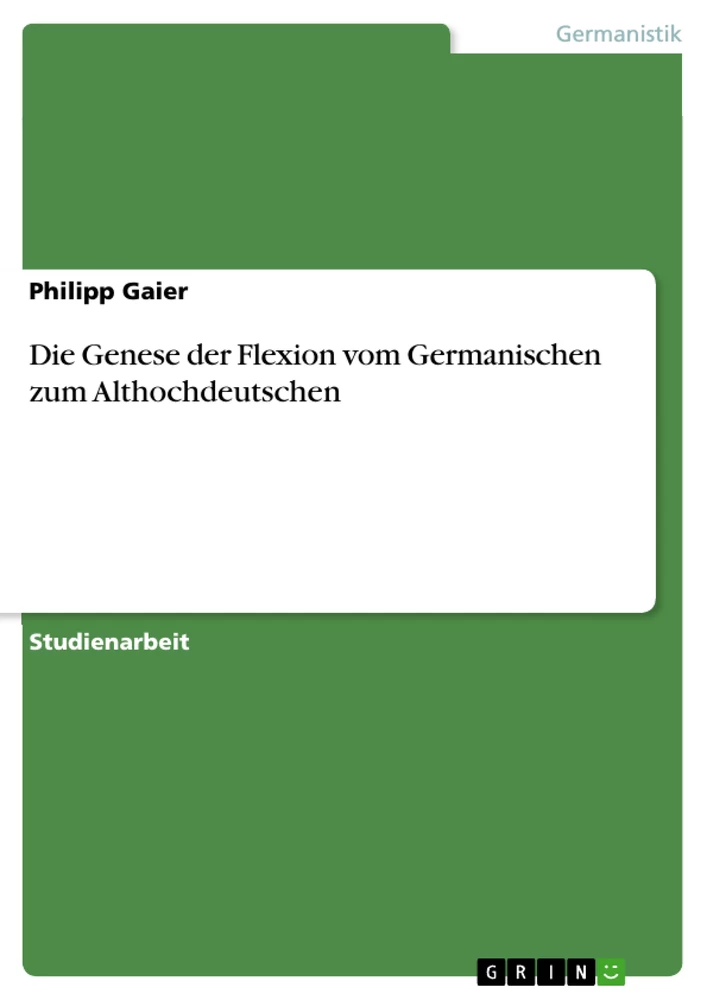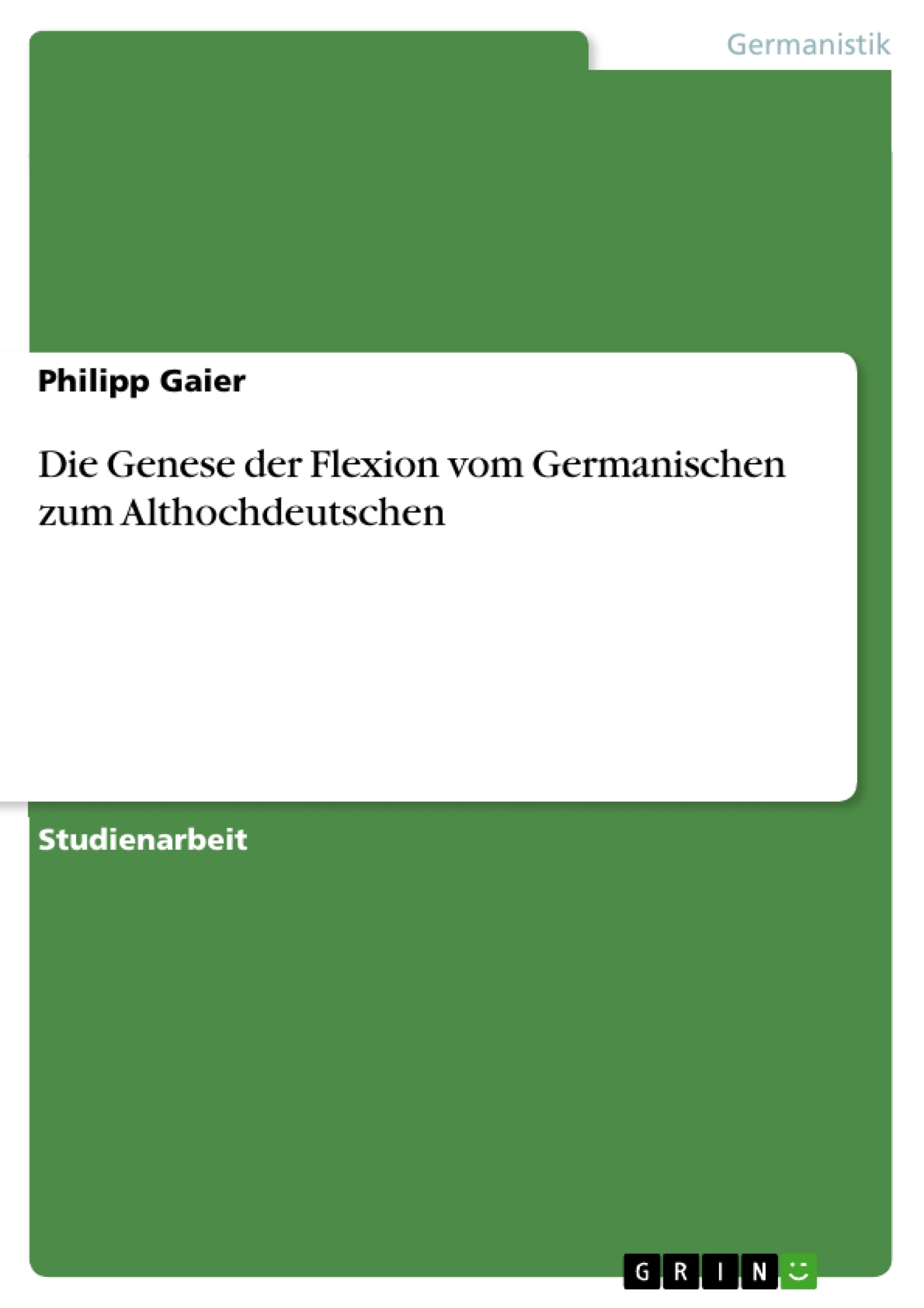Bei der Untersuchung der Genese der Flexion vom Germanischen ins Mittelhochdeutsche lassen sich sowohl Anzeichen für eine Vermehrung wie auch für den Abbau von Flexionsklassen zeigen.
„Wir können beobachten, dass in die Sprache neben die Flexionsmöglichkeiten, die es schon in den vorausgegangenen Entwicklungsstufen gegeben hat, neue Flexionstypen eingeführt werden; so entsteht im Germ. die schwache Flexion des Verbs neben den ererbten Flexionsmöglichkeiten der ablautenden und reduplizierenden Verben. Die Gründe sind u.a. sprachökonomischer Art: die schwache Flexion ist 'einfacher' als die starke.“1
In Folge dessen hat sich eine Tendenz zu den schwachen Verben fortgesetzt. Die schwachen Verben sind auch heute noch die einzige produktive Verbklasse, so dass jedes neue Verb im Neuhochdeutschen schwach flektiert wird.2
In diesem Zusammenhang finden sich auch Anzeichen für einen Verlust von Flexionsklassen, wie etwa der -nan-Verben im Germanischen. Der Verlust der reduplizierenden Verbklasse macht allerdings auch deutlich, dass es eine Gegenbewegung gab, eine Anpassung an das Ablaut-Prinzip.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Was ist Flexion?
- 1.2 Verbflexion
- 2. Hermann Paul: Die Genese der Wortbildung und Flexion
- 3. Die Genese der Flexion vom Germanischen ins Althochdeutsche am Beispiel der schwachen Verben
- 3.1 Allgemeines zu den schwachen Verben im Germanischen
- 3.2 Genese der schwachen Verben vom Indogermanischen ins Germanische
- 3.3 Das Verschwinden der -nan-Klasse
- 3.4 Die schwachen Verben im Althochdeutschen
- 4. Ausblick: Die schwachen Verben im Mittelhochdeutschen
- 5. Kurzes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Flexion im Germanischen und Althochdeutschen, insbesondere am Beispiel der schwachen Verben. Sie beleuchtet die Theorien von Hermann Paul zur Genese von Wortbildung und Flexion und analysiert die historischen Prozesse, die zur Veränderung der Flexionsformen geführt haben.
- Definition und Entwicklung der Flexion
- Hermann Pauls Theorie zur Genese von Wortbildung und Flexion
- Analyse der schwachen Verben im Germanischen und Althochdeutschen
- Der Einfluss von Lautwandel auf die Flexion
- Vergleichende Betrachtung der Flexion in verschiedenen Sprachstufen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Flexion ein und definiert den Begriff. Es erklärt die verschiedenen Flexionskategorien (Kasus, Numerus, Tempus, Person, Genus) und deren Funktion in flektierenden Sprachen wie dem Deutschen. Der Abschnitt 1.1 erläutert den Begriff "Flexion" und seine Bedeutung für die Struktur flektierender Sprachen. Abschnitt 1.2 konzentriert sich auf die Verbflexion, den Unterschied zwischen finiten und infiniten Verbformen und die traditionellen Bezeichnungen Konjugation und Deklination. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Untersuchung der Genese der Flexion.
2. Hermann Paul: Die Genese der Wortbildung und Flexion: Dieses Kapitel fasst Hermann Pauls Ansichten zur Genese von Wortbildung und Flexion zusammen, hauptsächlich aus seinem Werk "Prinzipien der Sprachgeschichte". Paul betont den kontinuierlichen und sich wiederholenden Prozess der Suffixbildung und hinterfragt die Annahme einer abgeschlossenen vorhistorischen Periode. Er argumentiert, dass die historische Erfahrung als Grundlage für das Verständnis der Flexionsentwicklung dient und kritisiert Theorien, die diese Erfahrung nicht berücksichtigen. Pauls Fokus liegt auf der ständigen Wechselwirkung zwischen Entstehung neuer und dem Untergang alter Suffixe, wobei der Lautwandel eine bedeutende Rolle spielt. Er illustriert seine Thesen anhand von Beispielen aus dem Althochdeutschen.
3. Die Genese der Flexion vom Germanischen ins Althochdeutsche am Beispiel der schwachen Verben: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der schwachen Verben vom Germanischen bis ins Althochdeutsche. Es beleuchtet zunächst allgemeine Eigenschaften der schwachen Verben im Germanischen und deren Entstehung aus dem Indogermanischen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verschwinden der -nan-Klasse und der Beschreibung der schwachen Verben im Althochdeutschen. Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Fallstudie, die die in Kapitel 2 vorgestellten theoretischen Überlegungen illustriert.
Schlüsselwörter
Flexion, Germanische Sprachen, Althochdeutsch, schwache Verben, Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Wortbildung, Suffixbildung, Lautwandel, morphologische Entwicklung, Indogermanisch.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Genese der Flexion vom Germanischen ins Althochdeutsche am Beispiel der schwachen Verben"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entwicklung der Flexion, insbesondere der schwachen Verben, im Germanischen und Althochdeutschen. Sie analysiert historische Prozesse und bezieht die Theorien von Hermann Paul zur Genese von Wortbildung und Flexion mit ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung der Flexion, Hermann Pauls Theorie zur Wortbildungs- und Flexionsgenese, eine detaillierte Analyse der schwachen Verben im Germanischen und Althochdeutschen, den Einfluss des Lautwandels auf die Flexion und einen Vergleich der Flexion in verschiedenen Sprachstufen.
Welche Rolle spielt Hermann Paul in dieser Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Hermann Paul, insbesondere aus seinem Werk "Prinzipien der Sprachgeschichte". Pauls Ansichten zur kontinuierlichen Suffixbildung und zur Bedeutung der historischen Erfahrung für das Verständnis der Flexionsentwicklung werden ausführlich dargestellt und analysiert.
Was sind schwache Verben und warum werden sie in dieser Arbeit untersucht?
Schwache Verben bilden eine wichtige Gruppe von Verben, deren Entwicklung exemplarisch für die Veränderungen der Flexion im Germanischen und Althochdeutschen steht. Die Arbeit analysiert ihre Genese vom Indogermanischen über das Germanische bis ins Althochdeutsche, inklusive des Verschwindens der -nan-Klasse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 führt in das Thema Flexion ein. Kapitel 2 fasst Hermann Pauls Theorien zusammen. Kapitel 3 analysiert die Genese der schwachen Verben vom Germanischen ins Althochdeutsche. Kapitel 4 gibt einen Ausblick auf die schwachen Verben im Mittelhochdeutschen. Kapitel 5 bietet ein kurzes Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Flexion, Germanische Sprachen, Althochdeutsch, schwache Verben, Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Wortbildung, Suffixbildung, Lautwandel, morphologische Entwicklung, Indogermanisch.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser mit Interesse an germanistischer Sprachwissenschaft, insbesondere an der historischen Entwicklung der deutschen Sprache und der Morphologie.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte. Für eine tiefere Auseinandersetzung mit den Inhalten ist die Lektüre der vollständigen Arbeit erforderlich.
- Citar trabajo
- Philipp Gaier (Autor), 2007, Die Genese der Flexion vom Germanischen zum Althochdeutschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70687