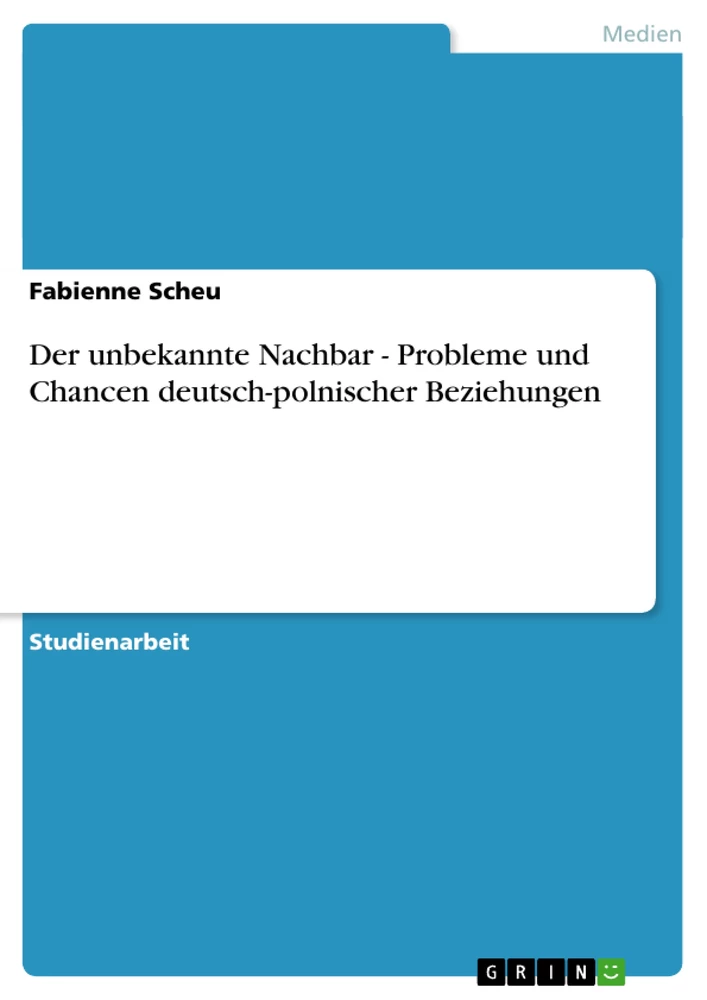Zu Polen fällt vielen Deutschen nicht mehr ein als „polnische Wirtschaft“, „die klauen“, sind „rückständig, aber gastfreundlich“ und „trinken viel Wodka“. Häufig fehlt völlig der Bezug zum östlichen Nachbarland, zumindest der gegenwärtige. Doch vor dem Hintergrund der Aufnahme Polens in die EU 2004, erhält die deutsch-polnische Thematik hohe Relevanz: Während heute, zumindest außerhalb der Grenzregionen, ein „Nebeneinanderherleben“ noch möglich ist, wird mit der Grenzöffnung ein Leben miteinander unumgänglich sein. Meinungen und Gefühle beider Seiten über die anstehende Annäherung gehen weit auseinander; Prognosen reichen von vielversprechend bis misstrauisch und angsterfüllt. Persönliche Erfahrungen und Betroffenheit, die vor allem aus regional bedingten Kontakten resultieren, spielen bei der Meinungsbildung eine Rolle, beispielsweise die vorherrschende Angst vor der EU-Aufnahme Polens in der Grenzregion um Frankfurt/Oder 1 . Interessanterweise liegt die Ursache der meisten Urteile weit weniger in gemeinsamen historischen Erfahrungen als aktuellen ökonomischen Anliegen; man betrachte vor allem den Widerstand der polnischen Landwirte oder das Wissen um wirtschaftliche Vorteile für deutsche Unternehmen beim EU-Beitritt Polens. Aber hat die jahrhundertlange, belastete gemeinsame Geschichte keine aktuelle Relevanz mehr oder gar gegenseitiges Desinteresse und Bezuglosigkeit gefördert? Oder besteht bereits auf verschiedenen Ebenen interkultureller Kontakt, ohne daß dieser für Außenstehende offensichtlich ist? Welche organisierten Maßnahmen zur deutsch-polnische Beziehungsförderung existieren, um eine geeignete Basis für das künftige Miteinander zu etablieren? Ziel dieser Arbeit ist die Betrachtung bestehender deutsch-polnischer Kontakte aus verschiedenen Perspektiven, um zu zeigen, dass trotz unterschiedlichster Grundlagen in den Köpfen der Menschen der Umgang miteinander häufig von Toleranz und positiven Resultaten geprägt ist. Dazu ist zunächst ein politisch-historischer Abriss mit besonderer Betrachtung des deutschpolnischen Verhältnisses bis heute notwendig. Daraus lassen sich dann Rückschlüsse auf Beziehungsbelastungen und differente Volkscharaktere schließen, die häufig in Stereotypen Ausdruck finden und somit als Basis deutsch-polnischer Kontaktaufnahmen gesehen werden könnten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenrelevanz und Zieldefinition
- Hauptteil
- Deutsch-polnische Geschichte
- Der deutsche „Drang nach Osten“
- Gebietsstreitigkeiten und Polonisierung nach dem Ersten Weltkrieg
- Umsiedlungen und Terror durch Hitlers Politik
- Erneute Zwangspolonisierung unter dem kommunistischen Regime
- Politische Annäherung, schlesische Verbände und polnisches Misstrauen
- Resultate aus der gemeinsamen Geschichte
- Erfahrung: „kein Interesse“, könne „nichts sagen“ über „die Polen“
- Erfahrung: „Ich kann die Polen nicht leiden!“—„Ich hab ja mit denen nix zu tun“
- Erfahrung: „keine Gedanken über Polen“ bis Mutter 1999 bettlägerig wurde
- Erfahrung: „Warn nich viel anders als ich“, nur einmal ein Mißverständnis
- Erfahrung: „Dachte so weit seien sie doch noch nicht!“, „Unterschiede nicht so gravierend!“
- Kontaktförderung zur Lösung von Bezugs- und Voruteilsproblematiken
- Schlußteil
- Persönliche Bilanz und Zukunftsprognose
- Anmerkungen
- Anhanghinweise
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der deutsch-polnischen Beziehung, insbesondere im Kontext der EU-Aufnahme Polens im Jahr 2004. Sie analysiert die historische Entwicklung des Verhältnisses, um die aktuellen Herausforderungen und Chancen des Miteinanders zu verstehen. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass trotz der belasteten gemeinsamen Geschichte, die in Stereotypen und Vorurteilen weiterlebt, ein friedliches und tolerantes Miteinander möglich ist.
- Analyse der historischen Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses
- Beurteilung der Auswirkungen der gemeinsamen Geschichte auf die heutige Beziehung
- Untersuchung der Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in deutsch-polnischen Kontakten
- Bewertung der Chancen und Herausforderungen des Miteinanders in der EU
- Prüfung von Möglichkeiten zur Förderung interkultureller Kontakte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Themenrelevanz und Zielsetzung der Arbeit definiert. Im Hauptteil wird die deutsch-polnische Geschichte beleuchtet, wobei verschiedene Epochen und ihre jeweiligen Konflikte analysiert werden. Der Fokus liegt dabei auf der deutschen Expansionspolitik und ihren Folgen für die polnische Seite, sowie auf der deutschen und polnischen Wahrnehmung der gemeinsamen Geschichte.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Erfahrungen aus persönlichen Kontakten beleuchtet, um aufzuzeigen, wie Stereotype und Vorurteile in realen Begegnungen zum Tragen kommen. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehung.
Schlüsselwörter
Deutsch-polnische Beziehungen, Geschichte, Stereotype, Vorurteile, interkulturelle Kommunikation, EU-Beitritt Polens, Integration, Toleranz, Miteinander.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die EU-Aufnahme Polens 2004 für Deutschland?
Sie machte ein echtes „Miteinander“ unumgänglich und löste sowohl wirtschaftliche Erwartungen als auch Ängste, besonders in Grenzregionen, aus.
Welche Stereotypen prägen das deutsche Bild von Polen?
Häufige Vorurteile beziehen sich auf Begriffe wie „polnische Wirtschaft“, Kriminalität oder Rückständigkeit, gepaart mit positiven Klischees wie Gastfreundschaft.
Wie beeinflusst die gemeinsame Geschichte das heutige Verhältnis?
Die Arbeit analysiert historische Belastungen wie den „Drang nach Osten“, Hitlers Terrorpolitik und spätere Zwangsumsiedlungen als Ursachen für Misstrauen.
Gibt es erfolgreiche Beispiele für interkulturellen Kontakt?
Ja, die Arbeit zeigt anhand persönlicher Erfahrungen, dass reale Begegnungen oft von Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen geprägt sind.
Warum ist das Interesse am Nachbarland oft so gering?
Der Text hinterfragt, ob gegenseitiges Desinteresse aus der belasteten Geschichte resultiert oder ob ökonomische Anliegen heute stärker im Vordergrund stehen.
- Citar trabajo
- Fabienne Scheu (Autor), 2002, Der unbekannte Nachbar - Probleme und Chancen deutsch-polnischer Beziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70710