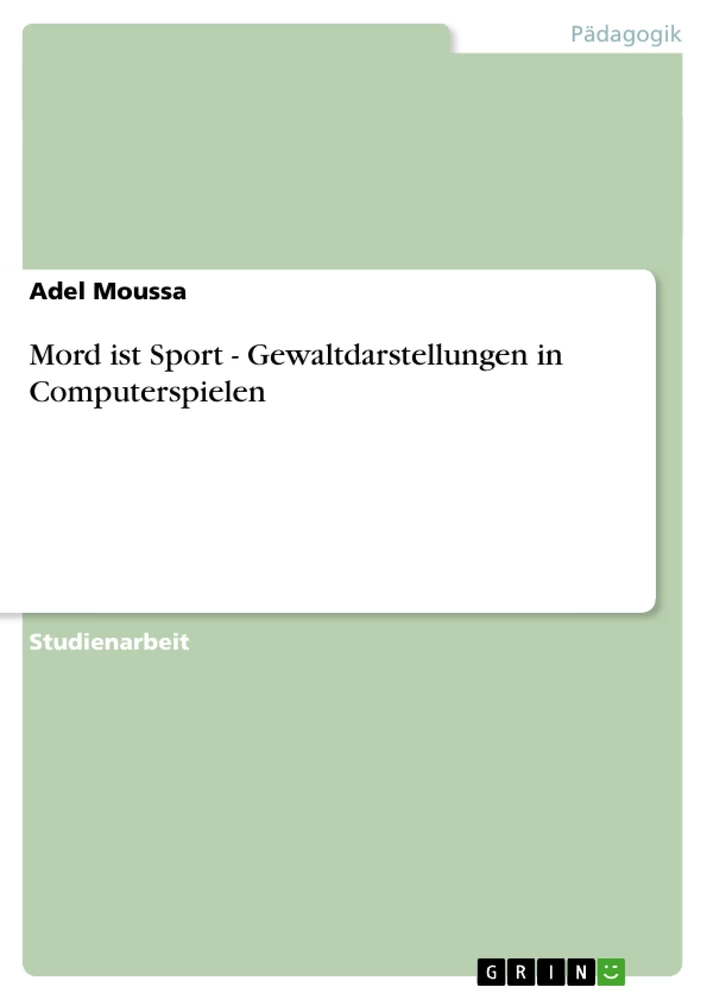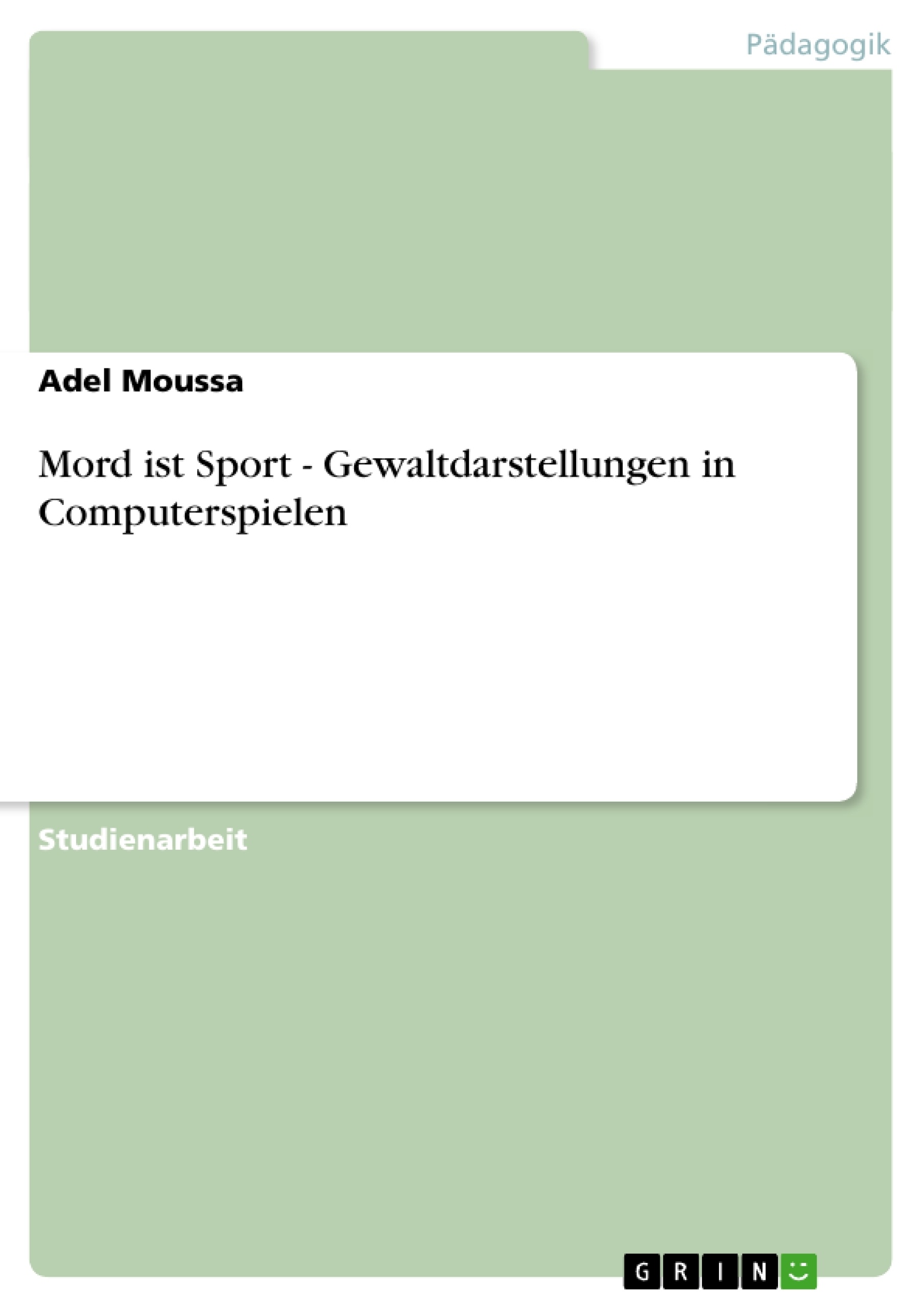Erfurt, 26. April 2002: Robert Steinhäuser, ein bisher unauffälliger 19-jähriger Schüler, tötet 16 Menschen und richtet danach die Waffe gegen sich selbst. Die Republik ist geschockt. Medien und Politik haben jedoch schnell eine Erklärung für das scheinbar Unerklärliche parat: Der Konsum gewalthaltiger Computerspiele.
Bereits wenige Wochen nach der grausamen Tat, reagiert die Politik auf den Druck der Öffentlichkeit, die eine strengere Reglementierung oder sogar ein Totalverbot von gewalthaltigen Computerspielen fordert. Eilig wird die bereits begonnene Novellierung des Jugendschutzgesetzes vorangetrieben. Das Ziel: Jugendlichen soll der Zugang zu brutalen Computerspielen erschwert und die staatliche Kontrolle schneller und effektiver gemacht werden.
Auf den ersten Blick der richtige Schritt. Dennoch: Ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem Konsum von virtueller Gewalt und real erhöhter Gewaltbereitschaft ist wissenschaftlich nicht belegt. Politik und Medien beschäftigen sich trotzdem immer wieder mit der Frage, ob Computerspiele Jugendliche zu Gewalttätern werden lassen. Dabei werden die Computerspiele häufig generalisiert und die Motivation der Jugendlichen diese brutalen Spiele zu spielen ignoriert. Ein Fehler der in den Anfängen der Medienwirkungsforschung begründet liegt. Deren wirkungstheoretischer Grundgedanke vom deduktiven Einfluss durch Medienkonsum letztlich immer wieder auf die Frage nach den Folgen des Konsums gewalthaltiger Medien reduziert wird. Moderne Medienforschung sollte sich jedoch viel mehr auf die Analyse des Mediums Computerspiel und die Motive der Spieler, gewalthaltige Spiele zu konsumieren, konzentrieren.
Eine derartige Annäherung an das Thema kann nicht ohne empirische Daten erfolgen. Diese Hausarbeit argumentiert daher unter anderem auf Basis einer eigens durchgeführten Internet-Umfrage zum Thema Gewalt in Computerspielen.
Im Rahmen dieser Umfrage wurden im Zeitraum vom 05. Januar 2005 bis zum 14. Januar 2005 insgesamt 525 Teilnehmer im Alter von 12 bis 47 Jahren zu Ihrem Gewaltspielkonsum befragt. Ziel der Umfrage war es, Informationen über die Konsumenten von gewalthaltigen Computerspielen zu sammeln, Motivationen für das Spielen von in der Öffentlichkeit als „Gewaltspiele“ titulierten Computerspielen zu ermitteln und schließlich mögliche Auswirkungen dieser Spiele aufzudecken. (Weitere Details zur Umfrage finden sich im Anhang „Umfrage: Gewalt in Computerspielen“)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Angstlust: Vom Reiz der Angst
- III. Die Entwicklung von Gewalt in Computerspielen
- III.A: Die Geburt des 3D-Shooters
- IV. Die Grenze zwischen virtueller und realer Welt
- IV.A: Intermondiale Transfer- und Transformationsprozesse
- V. Jugendschutz in Deutschland
- V.A: Computerspiele am Pranger
- V.B: Reformen im Bereich Jugendschutz
- V.C Medienkompetenz statt Verbot
- VI. Computerspielen als Sport
- VI.A: LAN-Partys: Die Sportveranstaltungen von Morgen
- VI.B Von der LAN-Party zur Weltmeisterschaft
- VI.C Taktisches Vorgehen statt hirnlosem Abschlachten
- VII. Wahrnehmungsunterschiede bei Gewaltdarstellungen
- VIII. Der Spieler als aktiver Medienkonsument
- IX. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Darstellung von Gewalt in Computerspielen. Sie untersucht die Gründe, warum Jugendliche gewalthaltige Computerspiele spielen, und diskutiert die möglichen Auswirkungen dieser Spiele auf die Spieler. Die Arbeit basiert auf einer eigens durchgeführten Internet-Umfrage zum Thema Gewalt in Computerspielen, die im Zeitraum vom 05. Januar 2005 bis zum 14. Januar 2005 insgesamt 525 Teilnehmer im Alter von 12 bis 47 Jahren befragte.
- Die Motivation der Spieler, gewalthaltige Computerspiele zu konsumieren
- Der Zusammenhang zwischen der Darstellung von Gewalt in Computerspielen und der erlebten Angstlust
- Die Entwicklung von Computerspielen und die zunehmende Realitätsnähe der Gewaltdarstellungen
- Die Rolle des Jugendschutzes und die Debatte um die Regulierung von Computerspielen
- Die Bedeutung von Medienkompetenz im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die aktuelle Debatte um Gewalt in Computerspielen anhand des Amoklaufs von Erfurt im Jahr 2002 eingeführt. Es wird die enge Verbindung zwischen dem Konsum von Computerspielen und dem Vorwurf der Gewalttätigkeit herausgestellt. Die Arbeit argumentiert für eine differenziertere Betrachtungsweise, die sich auf die Analyse der Computerspiele und die Motive der Spieler konzentriert.
Kapitel II beleuchtet den Begriff der „Angstlust“, der von Michael Balint geprägt wurde. Die Arbeit zeigt, wie die erlebte Angstlust in Computerspielen durch die realitätsnahe Darstellung von Gewalt und die Möglichkeit, die Spielwelt aktiv zu beeinflussen, entsteht.
Kapitel III zeichnet die Entwicklung der Computerspiele nach, beginnend mit den frühen Arcade-Automaten bis hin zur Einführung des 3D-Shooters. Die Arbeit stellt heraus, wie die technische Entwicklung der Computerspiele zu einer stetigen Steigerung der Realitätsnähe der Gewaltdarstellungen geführt hat.
Kapitel IV diskutiert die Grenzen zwischen der virtuellen Welt der Computerspiele und der realen Welt. Es wird untersucht, inwieweit Erfahrungen und Verhaltensmuster, die in Computerspielen gelernt werden, auf das reale Leben übertragen werden können.
Kapitel V befasst sich mit dem Jugendschutz in Deutschland und der Diskussion um die Regulierung von Computerspielen. Es wird die Kritik an der mangelnden Effektivität der derzeitigen Regelungen sowie die Notwendigkeit einer verstärkten Medienkompetenz hervorgehoben.
Kapitel VI analysiert die Entwicklung des Computerspielens zum Sport. Es wird die Entstehung von LAN-Partys und die zunehmende Professionalisierung von eSport-Wettbewerben dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen von Gewaltdarstellungen in Computerspielen, Angstlust, Medienkompetenz, Jugendschutz, und der Entwicklung des Computerspielens. Die Arbeit analysiert die Motivationsfaktoren und die möglichen Auswirkungen des Konsums von Computerspielen auf die Spieler. Die Untersuchung basiert auf einer eigenen Internet-Umfrage, die Daten über die Konsumenten von gewalthaltigen Computerspielen liefert.
Häufig gestellte Fragen
Machen gewalthaltige Computerspiele Jugendliche aggressiv?
Ein direkter Kausalzusammenhang ist wissenschaftlich nicht belegt. Die Arbeit plädiert dafür, eher die Motive der Spieler und deren Medienkompetenz zu analysieren.
Was bedeutet der Begriff „Angstlust“ bei Computerspielen?
Angstlust beschreibt den Reiz, in einer sicheren virtuellen Umgebung kontrolliert Angst und Spannung zu erleben.
Wie hat sich die Gewaltdarstellung in Spielen entwickelt?
Mit der Einführung von 3D-Shootern und technischem Fortschritt sind Darstellungen immer realitätsnäher geworden, was die Debatte um den Jugendschutz verschärft hat.
Sind LAN-Partys Sportveranstaltungen?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von LAN-Partys hin zu professionellen eSport-Weltmeisterschaften, bei denen Taktik statt „Abschlachten“ im Vordergrund steht.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz?
Medienkompetenz wird als wichtiger erachtet als reine Verbote, um Jugendlichen einen kritischen und reflektierten Umgang mit virtueller Gewalt zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Adel Moussa (Autor), 2005, Mord ist Sport - Gewaltdarstellungen in Computerspielen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70737