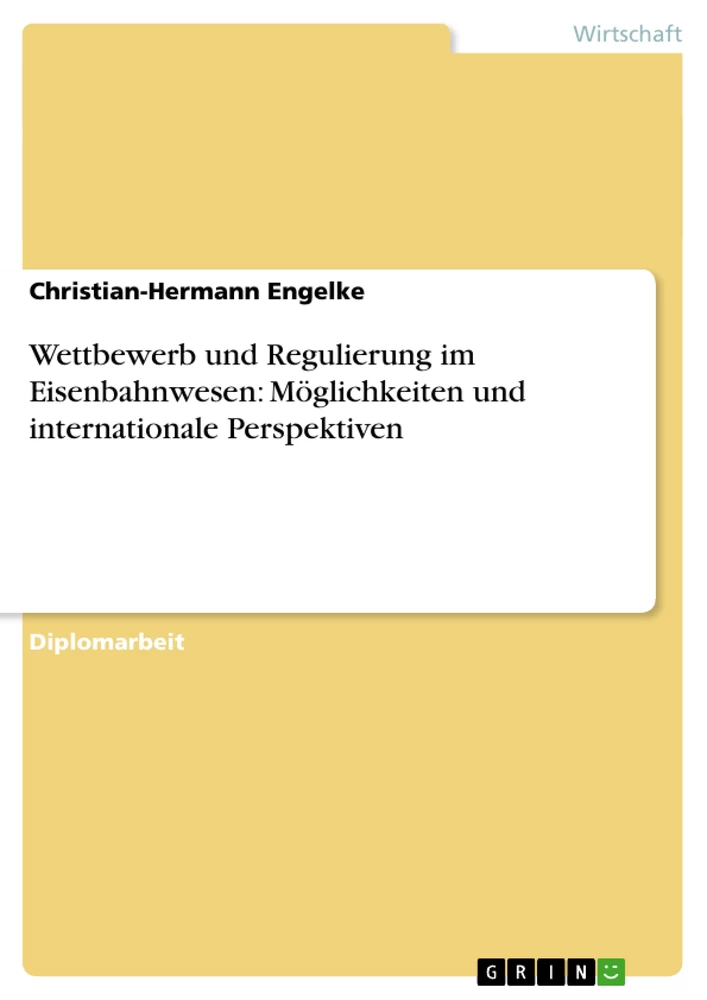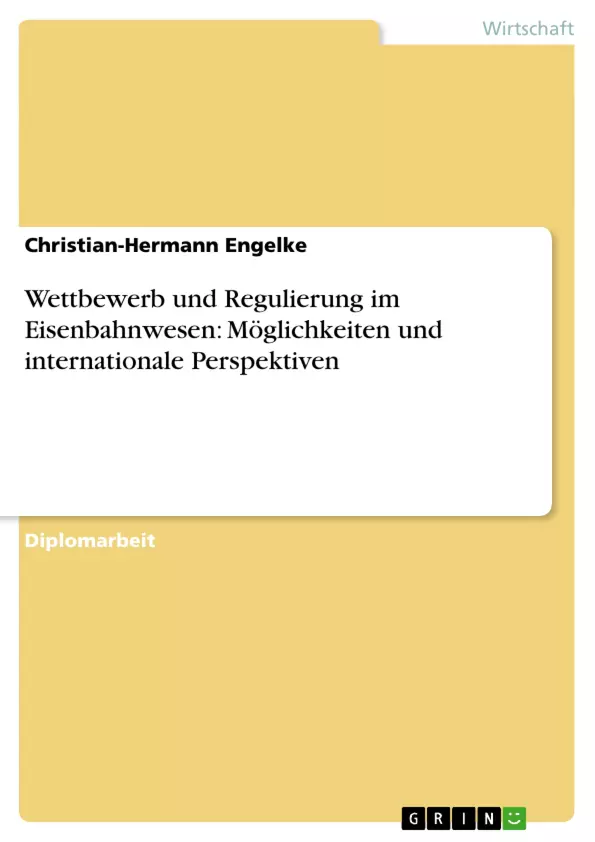Die Eisenbahn zählt in der historischen Betrachtung zu den am stärksten regulierten Industriesektoren überhaupt. Während die Anfänge der Bahn in den meisten Ländern durch privatwirtschaftliche Initiativen begründet wurden, wurden die einzelnen Unternehmen im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts überall in Europa verstaatlicht. Gründe für diese Entwicklung lagen einerseits im Bestreben, private Monopole zu verhindern; andererseits erkannten die staatlichen Organe aber auch die strukturpolitische und militärische Bedeutung des neuen Verkehrsmittels und ergriffen die Möglichkeit des staatlichen Rent-seekings, da sich die Eisenbahnen anfänglich noch als äußerst profitträchtig erwiesen. Auch in Ländern, in denen der Staat traditionell weniger Einfluss hat, wurde das Bahnwesen massiv reglementiert: So bestanden die Bahngesellschaften der USA und Kanadas zwar als private Unternehmen fort, wurden aber durch strikte Regulierungsmaßnahmen so stark in ihrer Gewerbe- und Vertragsfreiheit eingeschränkt, dass ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit drastisch abnahm und freie
Unternehmensentscheidungen kaum mehr möglich waren. In der Folge verlor die Bahn im intermodalen Wettbewerb international stark an Bedeutung und wurde in vielen Ländern zu einem anhaltenden Verlustbringer.
Erst mit Beginn der 1980er Jahre wurden die regulatorischen Maßnahmen zunächst in Nordamerika, später auch in Europa gelockert. Eisenbahnen wurden wieder weniger als staatliche Akteure zur Sicherung des Gemeinwohls, sondern vielmehr als gewinnorientierte Unternehmen betrachtet.
Wie kann der Verkehrsträger Eisenbahn im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Wettbewerb seine Zukunftschancen in Deutschland und Europa langfristig verbessern? Dieser Fragestellung widmet sich die vorliegende Arbeit. Ziel ist die Entwicklung von Möglichkeiten, wie die Bahnen durch eine Verminderung des staatlichen Einflusses und eine stärker an Wettbewerbsgesichtspunkten orientierte Ausrichtung ihre Effizienz steigern und so einen Teil ihrer früheren Bedeutung zurückerlangen können. Dabei sollen unter der Berücksichtigung der Besonderheiten der Netzindustrie Bahn regulatorische Notwendigkeiten erarbeitet und daraus mithilfe internationaler Beispiele zur Organisation von Bahnmärkten Perspektiven zur langfristigen Stärkung entwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Eisenbahn als Netzmarkt zwischen natürlichem Monopol und Wettbewerb
- 2.1. Betriebsgrößenersparnisse als Markteintrittsschranke im Netzmarkt Eisenbahn
- 2.1.1. Economies of Scale und Economies of Density
- 2.1.2. Economies of Scope
- 2.2. Von Betriebsgrößenvorteilen zum natürlichen Monopol
- 2.3. Identifikation des monopolistischen Bottlenecks im Eisenbahnmarkt
- 2.3.1. Zur Existenz monopolistischer Bottlenecks
- 2.3.2. Disaggregierung des Netzmarkts Eisenbahn zur Identifikation monopolistischer Bottlenecks
- 2.3.2.1. Die Schieneninfrastruktur
- 2.3.2.2. Die Überwachung des Zugverkehrs
- 2.3.2.3. Das Angebot von Transportleistungen
- 3. Grundzüge der Regulierung
- 3.1. Was ist Regulierung? Zum Begriff der Regulierung im normativen und im positiven Sinn
- 3.1.1. Rechtfertigung von Regulierung in der normativen Regulierungstheorie
- 3.1.2. Kritische Auseinandersetzung mit Regulierung: Die positive Regulierungstheorie
- 3.2. Formen der Regulierung
- 3.2.1. Marktstrukturregulierungen
- 3.2.1.1. Vertikale Separierung vor- und nachgelagerter Märkte
- 3.2.1.2. Horizontale Aufspaltung von integrierten Netzindustrien
- 3.2.2. Franchising
- 3.2.3. Marktverhaltensregulierung
- 3.2.3.1. Zwischen Kostendeckung und Wohlfahrtsoptimierung: Preissetzung und Regulierung
- 3.2.3.2. Rentabilitäts- und Price Cap-Regulierung als indirekte Regulierungsinstrumente
- 3.3. Zwischenfazit zum zweiten und dritten Kapitel
- 4. Die Wettbewerbs- und Regulierungsstruktur der Eisenbahn in Deutschland
- 4.1. Die Entwicklung der Schiene im intermodalen Wettbewerb
- 4.2. Die deutschen Eisenbahnen nach der Bahnreform
- 4.3. Der regulatorische Rahmen in Deutschland: Der Zugang zum Schienennetz und die Struktur der Trassenpreise
- 4.4. Zwischenfazit zum vierten Kapitel
- 5. Internationale Ansätze zur Strukturierung und Regulierung der Eisenbahn im Vergleich
- 5.1. Grunddimensionen der Organisation von Bahnsystemen
- 5.2. Großbritannien, Schweden und die USA als Beispiele für die Durchführung von Eisenbahnreformen
- 5.2.1. Großbritannien
- 5.2.1.1. Ausgangssituation
- 5.2.1.2. Reformansätze
- 5.2.1.3. Entwicklung nach der Reform
- 5.2.1.4. Fazit zur Reform der britischen Eisenbahnen
- 5.2.2. Schweden
- 5.2.2.1. Ausgangssituation
- 5.2.2.2. Reformansätze
- 5.2.2.3. Entwicklung nach der Reform
- 5.2.2.4. Fazit zur Reform der schwedischen Eisenbahnen
- 5.2.3. USA
- 5.2.3.1. Ausgangssituation
- 5.2.3.2. Reformansätze
- 5.2.3.3. Entwicklung nach der Reform
- 5.2.3.4. Fazit zur Reform der amerikanischen Eisenbahnen
- 5.3. Zwischenfazit zum fünften Kapitel
- 6. Der Einfluss von Wettbewerb auf die Produktivität im Eisenbahnwesen
- 6.1. Die Auswahl von Produktivitätskennziffern
- 6.2. Der „,Liberalisierungsindex Bahn 2002“
- 6.3. Die Wettbewerbs- und Produktivitätskennziffern im Vergleich
- 7. Rückschlüsse für die weitere Entwicklung in Deutschland und Europa
- 7.1. Nationale Grenzen als Hindernisse für den europäischen Eisenbahnverkehr
- 7.2. Outputspezifische Fokussierung als Erfolgsfaktor für mehr Verkehr auf der Schiene
- 7.3. Die Auswirkungen von Regulierung und Wettbewerb auf die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Wettbewerbs- und Regulierungsstruktur des Eisenbahnwesens und untersucht den Einfluss von Wettbewerb auf die Produktivität in diesem Sektor. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Chancen der Liberalisierung des Eisenbahnmarktes sowie die Auswirkungen von verschiedenen Regulierungsansätzen auf die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn.
- Herausforderungen und Chancen der Liberalisierung des Eisenbahnmarktes
- Analyse der Wettbewerbsstruktur des Eisenbahnwesens
- Untersuchung des Einflusses von Wettbewerb auf die Produktivität
- Bewertung verschiedener Regulierungsansätze und deren Auswirkungen auf die Eisenbahnindustrie
- Der Einfluss von Regulierung und Wettbewerb auf die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die Eisenbahn als Netzmarkt zwischen natürlichem Monopol und Wettbewerb
- Kapitel 3: Grundzüge der Regulierung
- Kapitel 4: Die Wettbewerbs- und Regulierungsstruktur der Eisenbahn in Deutschland
- Kapitel 5: Internationale Ansätze zur Strukturierung und Regulierung der Eisenbahn im Vergleich
- Kapitel 6: Der Einfluss von Wettbewerb auf die Produktivität im Eisenbahnwesen
Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz des Eisenbahnwesens für die Wirtschaft und Gesellschaft. Es werden die Forschungsfragen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit vorgestellt.
Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Eigenschaften des Eisenbahnmarktes als Netzmarkt. Es werden die Betriebsgrößenersparnisse, die zu einem natürlichen Monopol führen können, und die Herausforderungen bei der Identifikation des monopolistischen Bottlenecks im Eisenbahnmarkt beleuchtet.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Regulierung. Es werden die verschiedenen Formen der Regulierung und deren Ziele sowie die Vor- und Nachteile der Regulierungsansätze diskutiert.
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des deutschen Eisenbahnwesens im intermodalen Wettbewerb sowie die Auswirkungen der Bahnreform. Es werden die Regulierungsmechanismen in Deutschland, insbesondere der Zugang zum Schienennetz und die Struktur der Trassenpreise, analysiert.
Dieses Kapitel stellt internationale Ansätze zur Organisation und Regulierung des Eisenbahnwesens vor. Es werden die Erfahrungen in Großbritannien, Schweden und den USA im Hinblick auf die Liberalisierung und Regulierung des Eisenbahnmarktes analysiert.
Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Wettbewerb und Produktivität im Eisenbahnwesen. Es werden verschiedene Produktivitätskennziffern betrachtet und der Einfluss von Wettbewerb auf die Effizienz der Eisenbahnindustrie analysiert.
Schlüsselwörter
Eisenbahn, Wettbewerb, Regulierung, Netzmarkt, natürliches Monopol, Liberalisierung, Produktivität, Trassenpreise, intermodaler Wettbewerb, Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Eisenbahn als Netzmarkt mit natürlichem Monopol?
Aufgrund hoher Fixkosten für die Schieneninfrastruktur und Betriebsgrößenvorteilen (Economies of Scale) ist es oft effizienter, nur ein Schienennetz zu betreiben.
Was ist ein „monopolistischer Bottleneck“ im Eisenbahnwesen?
Es ist der Bereich des Netzes (meist die Infrastruktur), der nicht im Wettbewerb steht und den Zugang für andere Anbieter kontrolliert.
Wie unterscheiden sich die Bahnreformen in Großbritannien und Schweden?
Schweden war Vorreiter bei der Trennung von Netz und Betrieb, während Großbritannien eine tiefgreifende Privatisierung durchführte, die später teilweise revidiert wurde.
Was sind Trassenpreise?
Gebühren, die Eisenbahnverkehrsunternehmen an den Netzbetreiber zahlen müssen, um die Schienenwege nutzen zu dürfen.
Welchen Einfluss hat Wettbewerb auf die Produktivität der Bahn?
Studien und Indizes zeigen, dass Liberalisierung und Wettbewerb die Effizienz steigern und den Schienenverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern stärken können.
- Quote paper
- Christian-Hermann Engelke (Author), 2007, Wettbewerb und Regulierung im Eisenbahnwesen: Möglichkeiten und internationale Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70855