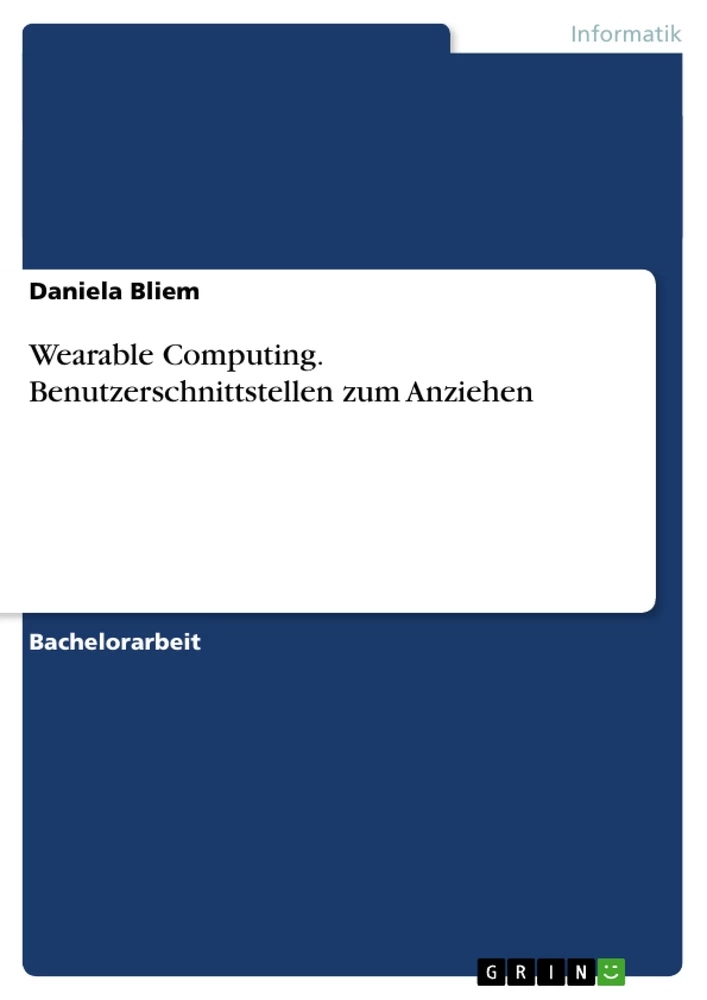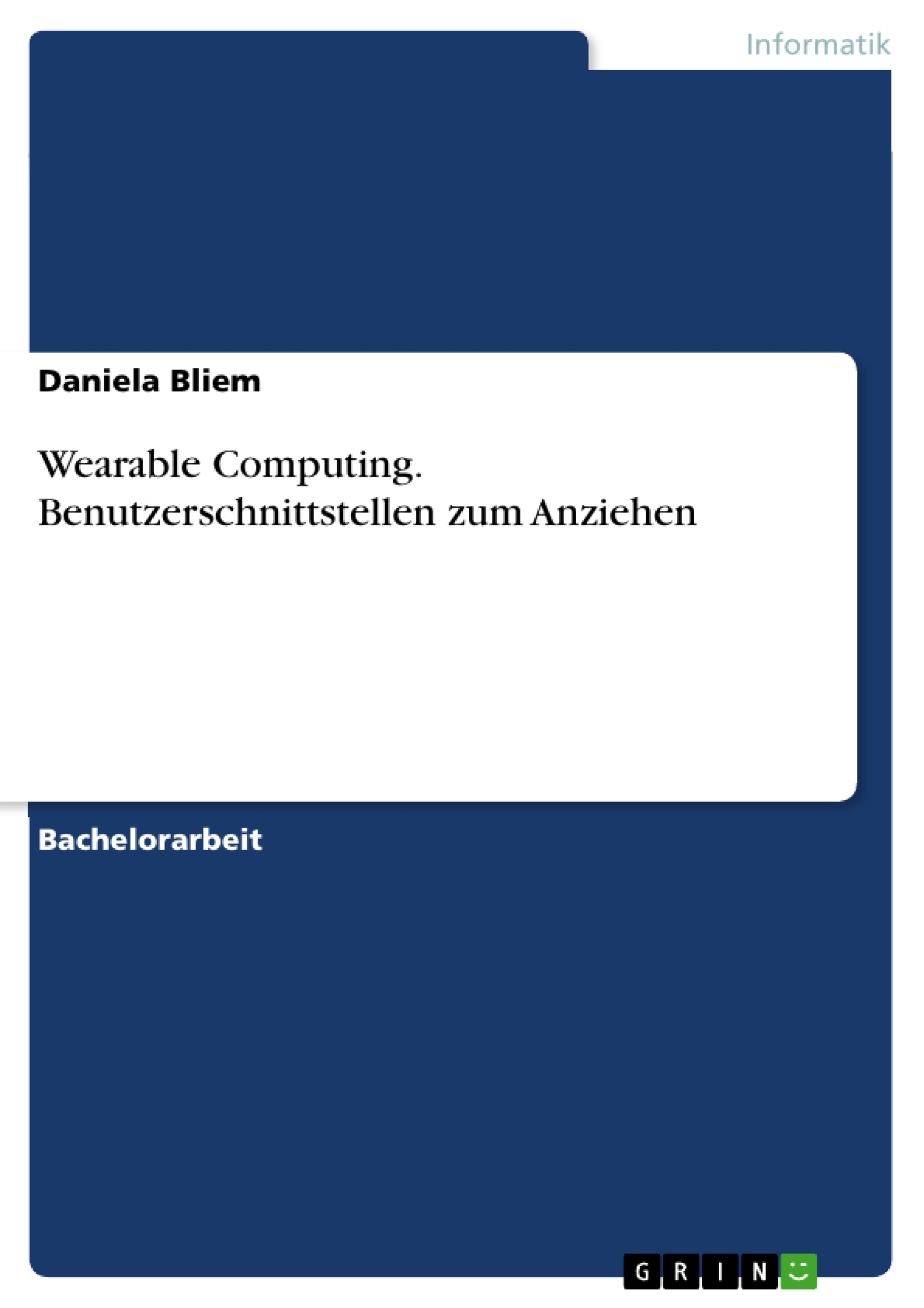Wearable Computing stellt eine Sonderform von Mobile Computing dar und kennzeichnet sich vor allem durch miniaturisierte Rechnermodule in Verbindung mit Sensornetzwerken die entweder auf, unter bzw. in der Kleidung angebracht werden und im Idealfall eine herkömmlichen Textilien vergleichbare Tragefreundlichkeit aufweisen. Wearable Computer bewegen sich stets mit dem Benutzer, sind immer aktiv und formen auf diese Art und Weise einen sehr persönlichen digitalen Informationsraum, der die jeweiligen Umgebungsbedingungen in Echtzeit erkennen und sich daran anpassen kann.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit allgemeinen Grundlagen von Wearable Computing auseinander und zeigt neben visionären Vorstellungen auch bereits realisierte Systeme und noch zu lösende Problembereiche. Als Schwerpunkt werden im daran anschließenden Teil neuartige I/O-Schnittstellen, an der menschlichen Physis orientierte Bustopologien und kontextsensible Herangehensweisen beschrieben und im Hinblick auf ihren praktischen Nutzen beurteilt. Ein weiterer Aspekt widmet sich darüber hinaus der derzeit größten Herausforderung im Bereich des Wearable Computing: einer ausreichenden Energieversorgung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Was ist Wearable Computing
- 2.1.1 Idee und Merkmale nach Steve Mann
- 2.1.2 Grenzen des Wearable Computing
- 2.1.3 Visionäre des Wearable Computing
- 2.2 Klassifikation von WearComps
- 2.2.1 Systemkomponenten
- 2.2.2 Entwicklungstendenzen
- 2.2.3 Wearable-Typisierung
- 2.2.4 Anwendungsbereiche
- 2.3 Meilensteine des Wearable Computing
- 2.3.1 Grundsteinlegung: 1960-1980
- 2.3.2 Medienpräsenz: 1981-1996
- 2.3.3 Marktdurchdringung: ab 1997
- 2.4 Wearability
- 2.4.1 Humanoide Grundlagen
- 2.4.2 Benutzerszenarien
- 2.1 Was ist Wearable Computing
- 3. Energieversorgung
- 3.1 Energiespeicher
- 3.1.1 Batterien
- 3.1.2 Folienbatterien
- 3.1.3 Brennstoffzellen
- 3.2 Mobile Energieerzeugung
- 3.2.1 Photovoltaik
- 3.2.2 Menschlicher Körper
- 3.3 Energieverbraucher
- 3.3.1 Durchschnittlicher Verbrauch
- 3.3.2 Beispielverbraucher für Anwendungen
- 3.4 Energiemanagement
- 3.1 Energiespeicher
- 4. Vernetzung
- 4.1 On-body communication
- 4.1.1 Body Area Network
- 4.1.2 Menschliche Elektrofelder
- 4.1.3 Nahbereichs-Funknetze
- 4.1.4 Leitende Textilien
- 4.1.5 Gewebebänder
- 4.2 Near-body communication
- 4.2.1 Personal Area Network
- 4.2.2 Bluetooth
- 4.2.3 ZigBee
- 4.3 Off-Body communication
- 4.3.1 Wireless LAN
- 4.1 On-body communication
- 5. Kontext
- 5.1 Kontext Grundlagen
- 5.1.1 Kontextbezogene Szenarien
- 5.1.2 Definition von Kontext
- 5.1.3 Kontextspezifische Klassifizierungen
- 5.2 Kontextmodelle
- 5.2.1 Erfassung von Kontextinformationen
- 5.2.2 Strukturierung und Interpretation durch Kontextmodelle
- 5.3 Kontextquellen zur Position
- 5.3.1 Positionssysteme
- 5.3.2 Satellitengestützt (GNSS/GPS)
- 5.3.3 Zellenbasiert (GSM/UMTS)
- 5.3.4 Innenraumsysteme (IR/Funk/US)
- 5.3.5 Relative Bewegungsmessung
- 5.3.6 Visuelle Marker (VisualTags)
- 5.3.7 Beobachtung der Umgebung
- 5.3.8 Verbundlösungen
- 5.4 Kontextquellen zur Identifikation
- 5.4.1 Identifikationssysteme
- 5.4.2 Funketiketten (RFID)
- 5.1 Kontext Grundlagen
- 6. I/O-Schnittstellen
- 6.1 Ausgabegeräte
- 6.1.1 Head-Mounted-Displays (HMD)
- 6.1.2 Alternative Displays
- 6.1.3 Lautsprecher
- 6.1.4 Taktile Ausgaben
- 6.2 Eingabegeräte
- 6.2.1 Tastaturen
- 6.2.2 Zeigegeräte
- 6.2.3 Zeichengeräte
- 6.2.4 Mikrofone & Kameras
- 6.3 I/O-Software
- 6.3.1 Gestenerkennung
- 6.3.2 Objekterkennung
- 6.3.3 Spracherkennung
- 6.1 Ausgabegeräte
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grundlagen und Herausforderungen von Wearable Computing. Sie beleuchtet visionäre Konzepte und bereits realisierte Systeme, analysiert Schlüsseltechnologien und bewertet deren praktischen Nutzen. Ein besonderer Fokus liegt auf neuartigen I/O-Schnittstellen, Energieversorgung und Kontextbewusstsein.
- Grundlagen und Definition von Wearable Computing
- Herausforderungen der Energieversorgung
- Konzepte und Technologien der Vernetzung
- Bedeutung und Umsetzung von Kontextinformationen
- Innovative I/O-Schnittstellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel liefert einen einführenden Überblick über Wearable Computing, seine Vorteile gegenüber traditionellen mobilen Geräten und die zentralen Themen der Arbeit. Es hebt die Bedeutung der Mensch-Maschine-Interaktion, den Kontext und die Herausforderungen bei der Energieversorgung und der Schnittstellengestaltung hervor.
2. Grundlagen: Das Kapitel beschreibt die grundlegenden Konzepte des Wearable Computing. Es definiert Wearable Computing im Kontext anderer Konzepte wie Ubiquitous Computing und Mobile Computing, unterscheidet verschiedene Systemarchitekturen und klassifiziert Wearable Computer nach verschiedenen Kriterien. Ein historischer Überblick und eine Diskussion der „Wearability“ runden das Kapitel ab.
3. Energieversorgung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Energieversorgung von Wearable Computern. Es analysiert verschiedene Energiespeichertechnologien, wie Batterien, Folienbatterien und Brennstoffzellen, und bewertet deren Eignung für den Dauerbetrieb. Methoden zur mobilen Energieerzeugung, der Energieverbrauch verschiedener Komponenten und Strategien zum Energiemanagement werden ebenfalls diskutiert.
4. Vernetzung: Das Kapitel beschreibt verschiedene Vernetzungsmethoden für Wearable Computer, unterteilt in On-body, Near-body und Off-body Kommunikation. Es beleuchtet Technologien wie Body Area Networks (BANs), die Nutzung menschlicher Elektrofelder, Nahbereichs-Funknetze (Bluetooth, ZigBee), leitende Textilien und Gewebebänder. Die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Methoden werden im Hinblick auf Wearable Computing bewertet.
5. Kontext: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Rolle von Kontextinformationen im Wearable Computing. Es definiert den Begriff Kontext und beschreibt verschiedene Kontextmodelle und -quellen, insbesondere zur Positionsbestimmung (Satellitennavigation, zellenbasierte Systeme, Innenraumsysteme, relative Bewegungsmessung, Visual Tags, Umgebungsbeobachtung, Verbundlösungen) und zur Identifikation (RFID). Verschiedene Strategien zur Erfassung, Strukturierung und Interpretation von Kontextdaten werden vorgestellt.
6. I/O-Schnittstellen: Das Kapitel befasst sich mit den Ein- und Ausgabegeräten von Wearable Computern. Es präsentiert verschiedene Display-Technologien (Head-Mounted Displays, alternative Displays, flexible Displays, LEDs, OLEDs, Projektoren, Linsendisplays), sowie Eingabegeräte (Tastaturen, Zeigegeräte, Zeichengeräte, Mikrofone und Kameras). Zusätzlich werden Softwarelösungen zur Gesten- und Objekterkennung sowie zur Spracherkennung diskutiert.
Schlüsselwörter
Wearable Computing, Benutzerschnittstelle, Miniaturisierung, Energieversorgung, Batterien, Brennstoffzellen, Photovoltaik, Vernetzung, Body Area Network (BAN), Bluetooth, ZigBee, Kontext, Kontextmodelle, Positionsbestimmung, GPS, RFID, Gestenerkennung, Spracherkennung, Head-Mounted Display (HMD), Tragekomfort (Wearability).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Wearable Computing
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Wearable Computing. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Grundlagen, Herausforderungen und Zukunftsaussichten von Wearable Computing-Systemen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Grundlagen und Definition von Wearable Computing, Herausforderungen der Energieversorgung (Energiespeicher, mobile Energieerzeugung, Energiemanagement), Konzepte und Technologien der Vernetzung (On-body, Near-body, Off-body Kommunikation), Bedeutung und Umsetzung von Kontextinformationen (Kontextmodelle, Kontextquellen zur Position und Identifikation), und innovative I/O-Schnittstellen (Ausgabe- und Eingabegeräte, Softwarelösungen zur Gesten-, Objekt- und Spracherkennung).
Welche Arten von Energiespeichern und Energieerzeugung werden diskutiert?
Das Dokument analysiert verschiedene Energiespeichertechnologien wie Batterien, Folienbatterien und Brennstoffzellen. Zusätzlich werden Methoden zur mobilen Energieerzeugung, wie Photovoltaik und die Nutzung des menschlichen Körpers, behandelt.
Welche Vernetzungsmethoden werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Vernetzungsmethoden, unterteilt in On-body Kommunikation (Body Area Networks (BANs), Nutzung menschlicher Elektrofelder, Nahbereichs-Funknetze, leitende Textilien, Gewebebänder), Near-body Kommunikation (Personal Area Network, Bluetooth, ZigBee) und Off-body Kommunikation (Wireless LAN).
Wie werden Kontextinformationen im Wearable Computing behandelt?
Das Dokument behandelt die Bedeutung von Kontextinformationen und beschreibt verschiedene Kontextmodelle und -quellen. Es werden insbesondere Kontextquellen zur Positionsbestimmung (Satellitennavigation, zellenbasierte Systeme, Innenraumsysteme, relative Bewegungsmessung, Visual Tags, Umgebungsbeobachtung, Verbundlösungen) und zur Identifikation (RFID) erläutert. Strategien zur Erfassung, Strukturierung und Interpretation von Kontextdaten werden vorgestellt.
Welche Ein- und Ausgabegeräte werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Display-Technologien (Head-Mounted Displays, alternative Displays), Eingabegeräte (Tastaturen, Zeigegeräte, Zeichengeräte, Mikrofone und Kameras) und Softwarelösungen zur Gesten-, Objekt- und Spracherkennung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Wearable Computing, Benutzerschnittstelle, Miniaturisierung, Energieversorgung, Batterien, Brennstoffzellen, Photovoltaik, Vernetzung, Body Area Network (BAN), Bluetooth, ZigBee, Kontext, Kontextmodelle, Positionsbestimmung, GPS, RFID, Gestenerkennung, Spracherkennung, Head-Mounted Display (HMD), Tragekomfort (Wearability).
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument enthält sieben Kapitel: Einleitung, Grundlagen, Energieversorgung, Vernetzung, Kontext, I/O-Schnittstellen und Ausblick. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Wearable Computing auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für Studierende, Forscher und alle, die ein umfassendes Verständnis der Grundlagen und Herausforderungen dieser Technologie erlangen wollen.
- Quote paper
- Daniela Bliem (Author), 2006, Wearable Computing. Benutzerschnittstellen zum Anziehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70947