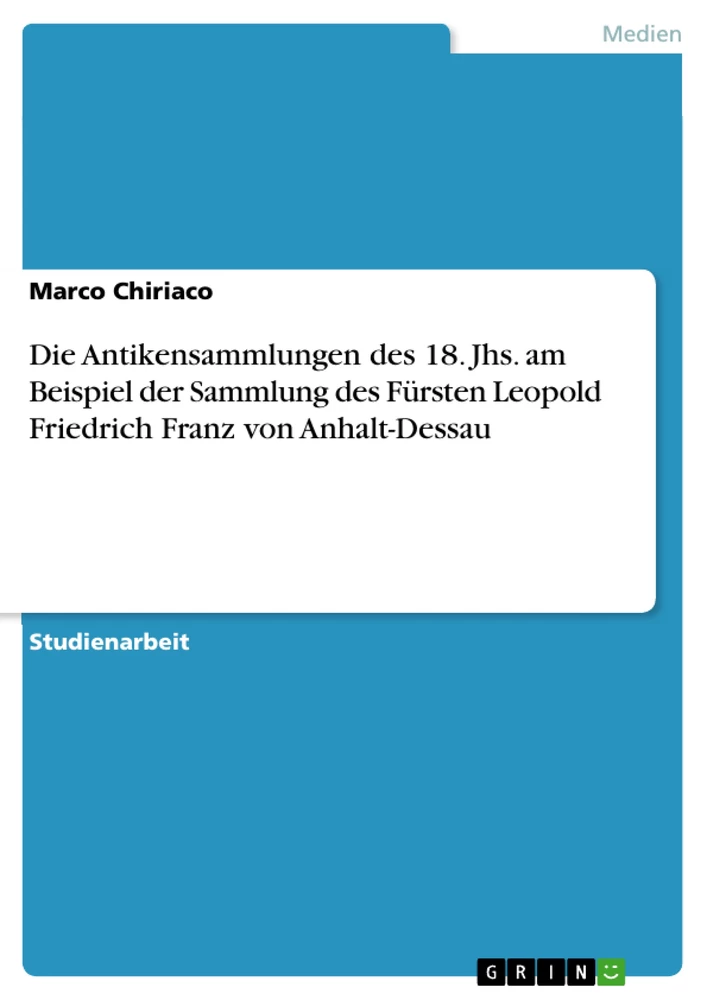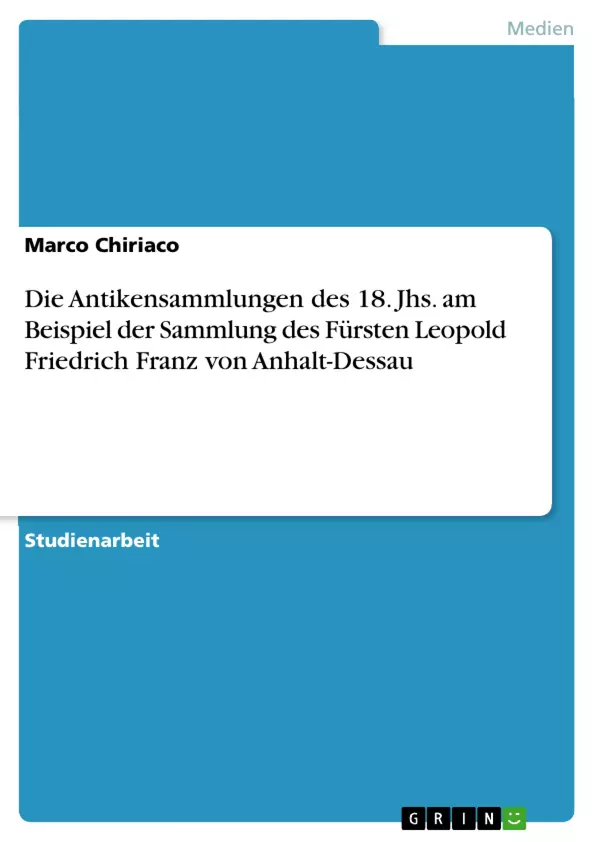Im 18. Jhdt. bildeten sich, trotz aller konfessionellen, sprachlichen und nationalen Antagonismen, Vorstufen eines europäischen Bewußtseins heraus. Eine besondere Rolle in diesem kollektiven Identifikationsgefühl spielte die Rückbesinnung auf die Antike, wodurch wiederum der Gegensatz zwischen Europa und den übrigen Kontinenten stark betont wurde. Kunst, Kultur und Wissenschaft waren, nach eigenem Selbstverständnis, die dominierenden Unterscheidungsmerkmale und bei allen außereuropäischen Völkern, wenn überhaupt, nur rudimentär vertreten; somit waren Religion und Hautfarbe nicht die einzigen Differenzen. Der gebildete Europäer wiederum sah sich ganz in der Tradition der Antike. Das förderte zum einen die stark angestiegene Kommunikation der Gelehrten untereinander durch Zeitschriften, Briefe und Kataloge, zum anderen Reisen zu den wichtigsten künstlerischen und antiken Schauplätzen Europas. An der Diskussion der Gelehrten beteiligten sich nun auch die Fürsten und Aristokraten. Sie unternahmen Reisen, vor allem nach Italien (Rom, Florenz, Venedig). Dort (insbesondere in Rom) trafen englische, französische, deutsche und polnische Gelehrte, Künstler und Adelige aufeinander. Hier wurden die wichtigen Kontakte geknüpft, die später Grundlage vieler Antikensammlungen sein sollte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Antike als Bezugspunkt des 18. Jahrhunderts
- II. Sammlungstypen im 18. Jhdt.
- II.1. Höfische Sammlungen
- II.2. Öffentliche Sammlungen
- II.3. Gelehrten- und Universitätssammlungen
- II.4. Aristokratische Sammlungen
- II.5. Bürgerliche Sammlungen
- III. Antikenhandel und -restaurierung im Rom des 18. Jhdts.
- IV. Die Antikensammlung des Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anh.-D.
- V. Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Antikensammlungen des 18. Jahrhunderts am Beispiel der Sammlung des Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau. Sie analysiert die Bedeutung der Antike als Bezugspunkt für die europäische Kultur und Gesellschaft dieser Zeit und beleuchtet die verschiedenen Sammlungstypen, die in diesem Kontext entstanden sind.
- Die Rolle der Antike im europäischen Selbstverständnis des 18. Jahrhunderts
- Die verschiedenen Sammlungstypen des 18. Jahrhunderts (höfische, öffentliche, gelehrte, aristokratische und bürgerliche Sammlungen)
- Der Antikenhandel und die Restaurierung antiker Objekte im Rom des 18. Jahrhunderts
- Die Antikensammlung des Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau als Beispiel für eine höfische Sammlung
- Die Bedeutung von Antikensammlungen für die ästhetische und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Antike als Bezugspunkt für das europäische Selbstverständnis des 18. Jahrhunderts. Es werden die vielfältigen Verbindungen zwischen Antike und Moderne aufgezeigt, die sich in der Kunst, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft niederschlugen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Sammlungstypen des 18. Jahrhunderts. Es werden die höfischen, öffentlichen, gelehrten, aristokratischen und bürgerlichen Sammlungen vorgestellt und ihre jeweiligen Charakteristika und Funktionen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Antikensammlungen, 18. Jahrhundert, Antike als Bezugspunkt, höfische Sammlungen, öffentliche Sammlungen, gelehrte Sammlungen, Aristokraten, Bürgertum, Antikenhandel, Restaurierung, Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, europäisches Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Antike im 18. Jahrhundert so bedeutend?
Die Rückbesinnung auf die Antike diente als kollektiver Identifikationspunkt für ein entstehendes europäisches Bewusstsein. Gebildete Europäer sahen sich in der Tradition der Antike, was Kunst, Kultur und Wissenschaft prägte.
Welche verschiedenen Sammlungstypen gab es im 18. Jahrhundert?
Man unterscheidet zwischen höfischen, öffentlichen, gelehrten (Universitätssammlungen), aristokratischen und bürgerlichen Sammlungen, die jeweils unterschiedliche Zwecke erfüllten.
Wer war Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau?
Er war ein Fürst, der durch seine Reisen (insbesondere nach Italien) eine bedeutende Antikensammlung aufbaute, die als exemplarisches Beispiel für eine höfische Sammlung dieser Zeit gilt.
Wie funktionierte der Antikenhandel im Rom des 18. Jahrhunderts?
Rom war das Zentrum des Antikenhandels. Gelehrte, Künstler und Adelige trafen dort zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Objekte zu erwerben und diese oft restaurieren zu lassen, bevor sie in europäische Sammlungen übergingen.
Was war die Funktion öffentlicher Sammlungen?
Im Gegensatz zu privaten Sammlungen dienten öffentliche Sammlungen der Bildung und dem ästhetischen Genuss einer breiteren Bevölkerungsschicht und markierten den Beginn des modernen Museumswesens.
Welche Rolle spielten Kataloge und Briefe für die Sammler?
Sie förderten die Kommunikation zwischen den Gelehrten und Sammlern europaweit, ermöglichten den Austausch über Neufunde und halfen bei der wissenschaftlichen Einordnung der Objekte.
- Citar trabajo
- Marco Chiriaco (Autor), 2003, Die Antikensammlungen des 18. Jhs. am Beispiel der Sammlung des Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70996