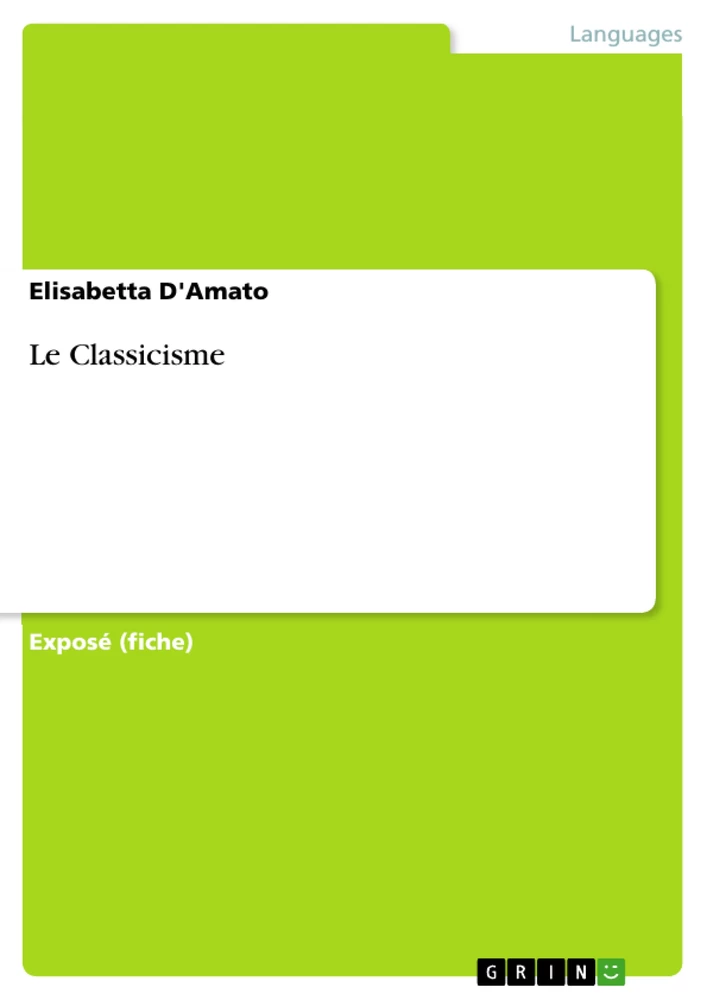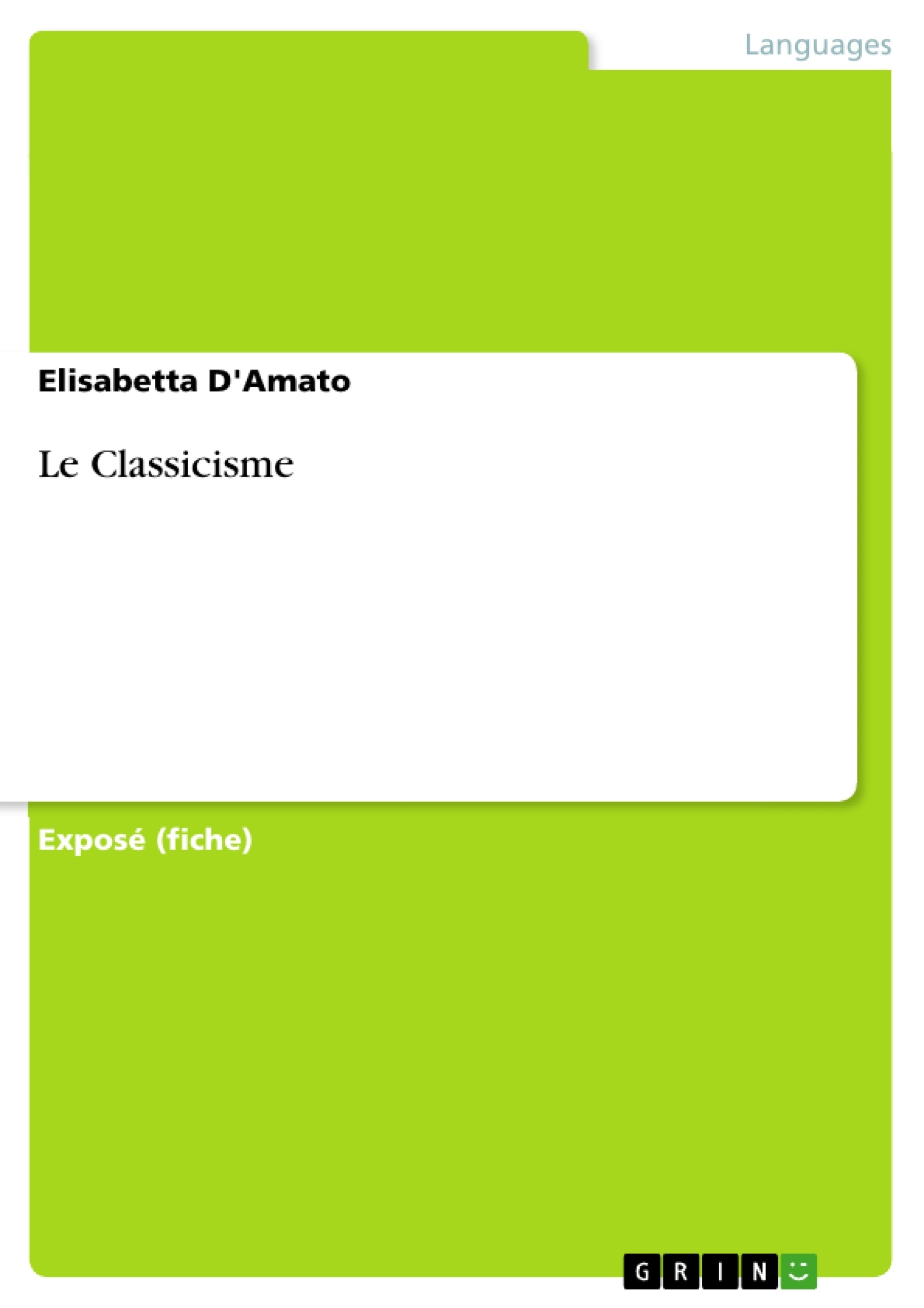Classicisme
La notion d’auteur classique ne s’est précisée en France peu à peu qu’au cours du XVIIIe siècle, alors que les écrivains du XVIIe siècle apparaissaient à la no uvelle génération littéraire
comme des modèles, tant pour la pureté de la langue que pour la perfection de l’art, et que l’on commençait à ce titre à les étudier dans les classes des collèges. Mais ce sont les polémiques romantiques qui ont achevé de dégager avec netteté les traits caractéristiques du classicisme.
Au sens strict, le terme de classique s’applique à la génération des écrivains dont les oeuvres commencent à paraître autour de 1660 : La Fontaine, Molière, Boileau, Racine. Sans former à proprement parler une école groupée autour d’un manifeste, ils sont unis par une communauté de goûts et de principes : imitation des Anciens, souci de vérité et de naturel, aversion pour le singulier ou l’exceptionnel (d’où élimination du lyrisme personnel), intérêt presque exclusif pour l’analyse morale, discipline de l’imagination et de la sensibilité par la raison, libre soumission aux règles qui régissent les différents genres, recherche de la clarté et de
l’harmonie. C’est la doctrine que Boileau finira par exposer dans son Art poétique (1674), et qui, peu à peu élaborée depuis Malherbe, a plus ou moins régi toute la littérature du siècle
jusqu’à La Bruyère et Fénelon, sauf quelques irréguliers, et compte tenu des nuances introduites par les tempéraments divers. Aussi désigne-t-on souvent aujourd’hui du terme de classiques tous nos écrivains du XVIIe siècle, et aussi ceux des écrivains du XVIIIe siècle qui, comme Voltaire, ont affirmé leur attachement à l’idéal littéraire du siècle de Louis XIV, sans parfois égaler (=gleichsetzen, jdm. Gleichkommen) les maîtres qu’ils s’étaient donnés comme modèles.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Le classicisme (1660 – 1700)
- Etymologie
- Classicisme
- Le Théatre
- La religion
- Formation de la tragédie classique
- Les règles
- Les trois unités
- La controverse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit dem Classicismus, einer bedeutenden literarischen Bewegung des 17. Jahrhunderts in Frankreich. Es zeichnet die Entwicklung des Classicismus von seiner Etymologie über seine wichtigsten Charakteristika bis hin zu seinem Einfluss auf das Theater und die Religion nach.
- Etymologie und Definition des Begriffs "Classicismus"
- Die zentralen Prinzipien des Classicismus, insbesondere die Nachahmung der Antike, der Fokus auf Wahrheit und Natürlichkeit und die Bedeutung von Vernunft und Regeln.
- Die Rolle des Theaters im Classicismus, die Entstehung wichtiger Theaterinstitutionen und die Kontroversen um die Moral des Schauspiels.
- Die Entstehung der klassischen Tragödie, ihre Regeln und die daraus resultierenden Debatten unter den Theoretikern und Autoren.
- Die Bedeutung des Classicismus für die französische Kultur und seinen Einfluss auf andere europäische Literaturen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil des Referats behandelt die Etymologie und die Entwicklung des Begriffs "Classicismus". Er beleuchtet die Bedeutung der Antike als Vorbild und die Entstehung des Classicismus als Gegenbewegung zum aufkommenden Romantismus.
- Im zweiten Teil werden die zentralen Prinzipien des Classicismus vorgestellt. Dazu gehören die Nachahmung der Antike, der Fokus auf Wahrheit und Natürlichkeit, die Bedeutung von Vernunft und Regeln sowie die Betonung der moralischen Dimension der Literatur.
- Der dritte Teil des Referats befasst sich mit dem Theater im Classicismus. Er beschreibt die Entstehung wichtiger Theaterinstitutionen wie der Comédie-Française und die Entwicklung der Oper.
- Der vierte Teil des Referats analysiert die Entstehung der klassischen Tragödie. Er behandelt die drei Einheiten von Handlung, Zeit und Ort, die Kontroversen um die Regeln und die Rolle von Corneille und Racine in der Entwicklung der Tragödie.
Schlüsselwörter
Classicismus, Französische Literatur, 17. Jahrhundert, Antike, Nachahmung, Regeln, Theater, Tragödie, Corneille, Racine, Molière, Comédie-Française, Oper, Religion, Moral.
Häufig gestellte Fragen
Wann war die Blütezeit des französischen Classicisme?
Die literarische Bewegung des Classicisme erreichte ihren Höhepunkt in der Generation um 1660 unter der Herrschaft von Louis XIV.
Wer sind die bedeutendsten Autoren des Classicisme?
Zu den zentralen Figuren gehören La Fontaine, Molière, Boileau und Racine.
Was sind die "Drei Einheiten" im klassischen Theater?
Es handelt sich um die Einheiten der Handlung (une seule action), der Zeit (innerhalb von 24 Stunden) und des Ortes (ein einziger Schauplatz).
Welche Rolle spielt die Antike für den Classicisme?
Die Nachahmung der antiken Vorbilder (imitation des Anciens) galt als höchstes ästhetisches Prinzip für Vollkommenheit und Harmonie.
Wie unterscheidet sich der Classicisme vom Barock?
Der Classicisme setzt auf Vernunft, Klarheit und Disziplin der Gefühle, während der Barock eher durch Üppigkeit und Unregelmäßigkeit geprägt war.
- Citar trabajo
- Elisabetta D'Amato (Autor), 2001, Le Classicisme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/709