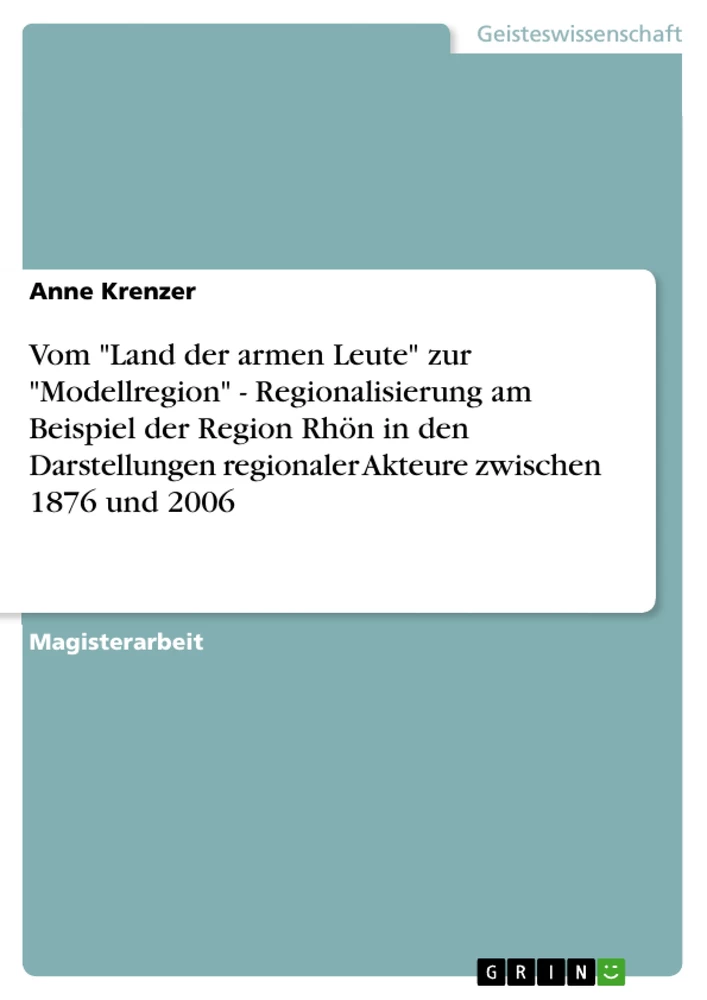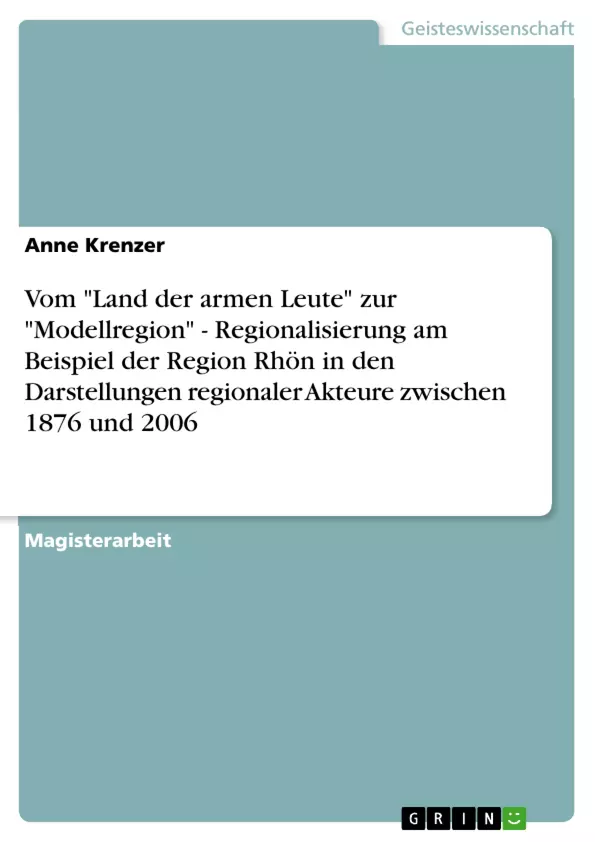Aus theoretischer Perspektive wurden Region und Regionalisierung von zahlreichen Autoren behandelt. Die aufgestellten Hypothesen und Systematisierungen sind allerdings wesentlich seltener auf die Praxis, sprich auf ein oder mehrere konkrete Beispiele, angewandt worden. Die für diese Arbeit maßgebliche „kulturwissenschaftliche Regionenforschung“ ist stark empirisch orientiert und bemüht sich u.a. Einzelergebnisse zu einer allgemeineren Theorie zu verknüpfen. Die vorliegende Arbeit soll mit Fokus auf eine Region, nämlich die Rhön, und die für sie maßgeblichen regionalisierenden Akteure, nämlich den Verein Rhönklub (RK) und das Biosphärenreservat Rhön (BRR), ein solches Einzelergebnis liefern. Die wesentliche Frage dabei ist:Welche Positionen lassen sich innerhalb der (schriftlich fixierten) Regionsdarstellungen der beiden Institutionen feststellen? Welche Strategien verfolgen sie, um die Region zu fördern, welche Bezüge setzen sie bei der Darstellung „ihrer“ Region?Das Ziel ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bezugnahme auf die Region Rhön festzustellen und wenn möglich Erklärungsansätze zu liefern. Zugleich wird das Thema der regionalen Identität aufgegriffen, das in der Wissenschaft ebenso wie im Umfeld der Regionalentwicklung eine Rolle spielt. Erst kürzlich haben mit dem BRR befasste Wissenschaftler die Frage nach der symbolischen Bedeutung von Naturraummerkmalen oder regionalen Produkten für die „Rhöner Identität“ aufgeworfen. Diese Frage nach dem „Selbstverständnis und Selbstbewusstsein“ in der Rhön könne allerdings nicht allein mit Umfragen beantwortet werden,5sondern erfordere die Untersuchung „zeitgeschichtlich entsprechend ausgewählter Texte unter Beachtung ihres Entstehungs-und
Verwendungszusammenhangs“. Genau das versucht die vorliegende Arbeit: Sie beleuchtet mit dem Vergleich von Schriftzeugnissen einer bereits seit 1876 bestehenden und einer in den 1990ern entstandenen Organisation Regionalisierungbestrebungen bzw. Regionsdarstellungen vor verschiedenen zeitlichen Hintergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Einbindung in die Forschungsdiskussion
- Zur Konjunktur des Regionsbegriffs innerhalb und außerhalb der Wissenschaft
- Substantialistische und konstruktivistische Ansätze
- Kulturwissenschaftliche Regionenforschung: Region als Sinnordnung
- Möglichkeiten regionaler Sinnordnung
- Akteurstypen und Handlungslogiken
- Regionskonzepte und Arten der Raumstrukturierung
- Begriffsklärung
- Kernbegriffe: Raum, Region, Heimat
- Hilfsbegriffe: Moderne, Identität, Erzählungen
- Erklärungsansätze und Theorien zu Region und Regionsbezug
- Zur Aktualität des Raumbezugs in Zeiten der „Globalisierung“
- Zum Raumbezug auf verschiedenen Ebenen: Region, Nation, Europa
- Raumbezug als Möglichkeit der Selbstverortung und Sinnstiftung: Regionale Identität und Identifizierung mit der Region
- Zusammenfassung und Folgerungen
- Einbindung in die Forschungsdiskussion
- Vorgehensweise
- Untersuchungsgegenstand: Die Rhön und die Akteure Rhönklub und Biosphärenreservat
- Verfahren zur Bearbeitung der Fragestellungen
- Die Diskursanalyse
- Der Vergleich und vergleichendes Vorgehen
- Methode
- Filterfragen: Unter welchen Gesichtspunkten werden Quellen ausgewählt?
- Korpusbildung: Welches sind die relevanten Dokumente?
- Analyseraster: Was sind diskursive Elemente?
- Untersuchung: Die Konstruktion der Region Rhön
- Kontext der Untersuchung: Beschreibung der Akteure
- Der Rhönklub
- Das Biosphärenreservat
- Zuordnung zu Akteurstypen und Regionskonzepten
- Untersuchung: Beschreibung der Regionskonzepte
- Gründungserzählungen und Selbstdarstellungen – Hintergründe der Regionalisierung
- Der Rhönklub
- Das Biosphärenreservat
- Zusammenfassung und Eckpunkte für die weitere Analyse
- Darstellung der Rhön und ihrer Bewohner – Strategien der Regionalisierung
- Räumliche Abgrenzung: Gemeinsame Aspekte statt eindeutige Grenzen (topografischer, ordnungspolitischer und kultureller Raum)
- Die Rhön als Grenzland und Raum der Grenzüberschreitung (ordnungspolitischer und kultureller Raum)
- Die Rhön als Kulturlandschaft zwischen Wirtschaftsraum und Schutzgebiet (ökonomischer und topografischer Raum)
- Die Rhön als Refugium und Qualitätsregion (ökonomischer und kultureller Raum)
- Der Begriff „Rhöner“: Gattungsname und Qualitätsattribut (kultureller und ökonomischer Raum)
- Gründungserzählungen und Selbstdarstellungen – Hintergründe der Regionalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Konstruktion der Region Rhön durch zwei unterschiedliche Akteure: den Rhönklub (RK) und das Biosphärenreservat Rhön (BRR). Ziel ist es, die unterschiedlichen Positionen der beiden Institutionen innerhalb ihrer schriftlichen Regionsdarstellungen zu analysieren. Dabei werden insbesondere die Strategien der Regionalisierung, die Bezüge in der Darstellung „ihrer“ Region und die Rolle der regionalen Identität untersucht.
- Die Entwicklung der Rhön als Kulturlandschaft zwischen Wirtschaftsraum und Schutzgebiet
- Die Herausforderungen der Modernisierung und die Suche nach Identität in der Rhön
- Die Rolle der Grenze als Integrationsfaktor und die Bedeutung der länderübergreifenden Zusammenarbeit
- Die Bedeutung von Tradition und Heimatverbundenheit für die Konstruktion der Region Rhön
- Die Entwicklung des Begriffs „Rhöner“ und die Darstellung der Rhön als Qualitätsregion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einordnung der Thematik in die aktuelle Forschungsdiskussion und der Klärung wichtiger Begriffe wie Raum, Region und Heimat. Anschließend werden verschiedene Erklärungsansätze und Theorien zum Regionsbezug vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Untersuchung genutzt werden.
Im dritten Kapitel wird die Vorgehensweise der Arbeit beschrieben. Dabei werden der Untersuchungsgegenstand, die Akteure RK und BRR, und die Untersuchungsmethoden, insbesondere die Diskursanalyse und der Vergleich, erläutert.
Im vierten Kapitel werden die beiden Akteure RK und BRR im Detail vorgestellt. Es werden ihre Gründungskonzepte und Selbstdarstellungen analysiert, um die Hintergründe ihrer Regionalisierung zu beleuchten. Anschließend werden verschiedene Strategien der Regionalisierung anhand der Darstellung der Rhön und ihrer Bewohner untersucht. Dabei werden Themenfelder wie die räumliche Abgrenzung, die Bedeutung der Grenze, die Kulturlandschaft als Wirtschaftsraum und Schutzgebiet, die Rhön als Refugium und Qualitätsregion sowie der Begriff „Rhöner“ analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Phänomen der Regionalisierung am Beispiel der Rhön. Im Mittelpunkt stehen die Konstruktionen der Region durch verschiedene Akteure, die Bedeutung von Kulturlandschaft, Heimatverbundenheit und Identität in Bezug auf die Rhön sowie die Herausforderungen der Modernisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Akteure werden in der Rhön-Studie verglichen?
Verglichen werden der Rhönklub (gegründet 1876) und das Biosphärenreservat Rhön (entstanden in den 1990er Jahren).
Was ist das Ziel der "kulturwissenschaftlichen Regionenforschung"?
Sie untersucht die Region als Sinnordnung und analysiert, wie Akteure durch Texte und Erzählungen eine regionale Identität konstruieren.
Wie wird die Rhön in diesen Darstellungen beschrieben?
Die Rhön wird als Grenzland, Kulturlandschaft zwischen Wirtschaftsraum und Schutzgebiet sowie als "Qualitätsregion" und Refugium dargestellt.
Was bedeutet der Begriff "Rhöner" in diesem Kontext?
Der Begriff dient nicht nur als Gattungsname für Bewohner, sondern wird als Qualitätsattribut zur Stärkung der regionalen Identität und Vermarktung genutzt.
Welche Methode wird zur Untersuchung der Texte verwendet?
Die Arbeit nutzt die Diskursanalyse und das vergleichende Vorgehen, um die schriftlich fixierten Regionsdarstellungen beider Institutionen zu prüfen.
- Kontext der Untersuchung: Beschreibung der Akteure
- Citar trabajo
- Anne Krenzer (Autor), 2006, Vom "Land der armen Leute" zur "Modellregion" - Regionalisierung am Beispiel der Region Rhön in den Darstellungen regionaler Akteure zwischen 1876 und 2006, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71177