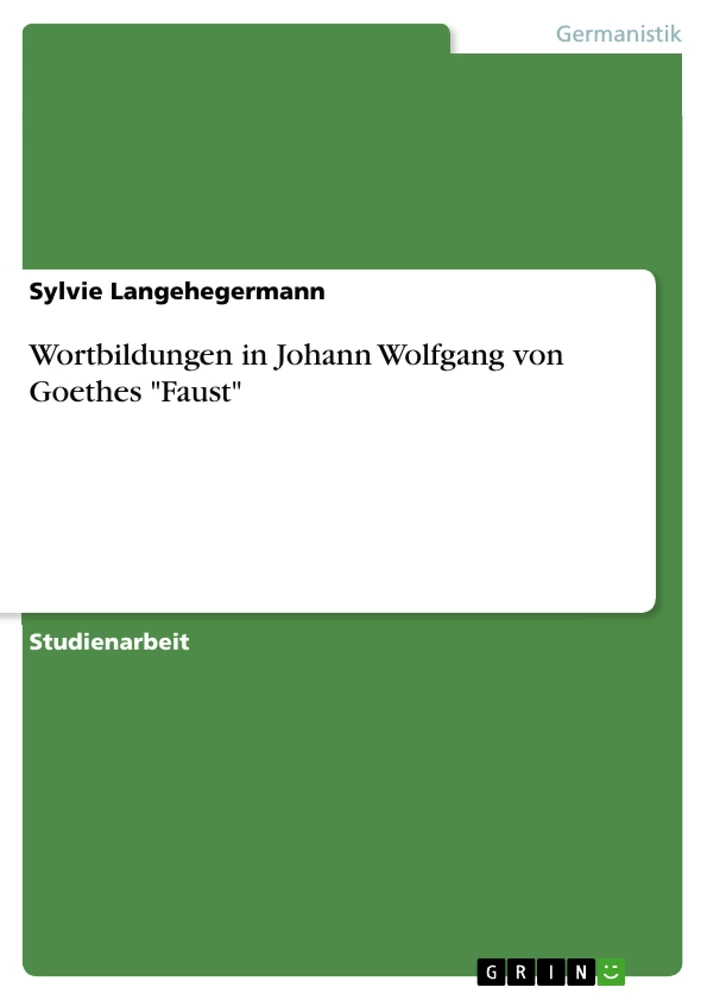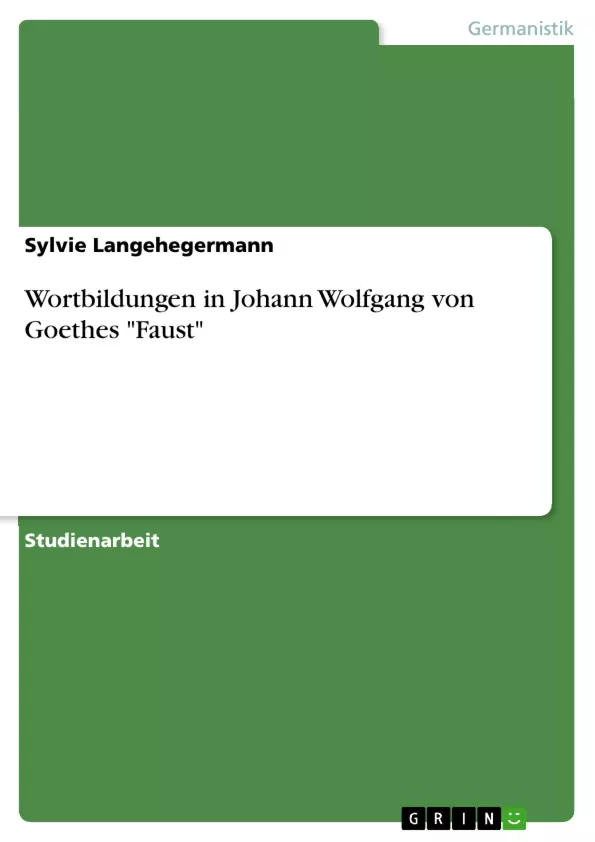Sprache (1774)
„Vieles hab ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen,
Öl gemalt, in Ton hab ich auch manches gedrückt,
Unbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet;
Nur ein einzig Talent bracht ich der Meisterschaft nah;
Deutsch zu schreiben. Und so verderb ich unglücklicher Dichter
In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst.“
Es ist bekannt, dass Johann Wolfgang von Goethe, wie dieses Zitat aus den ‚Venezianischen Epigrammen’ deutlich zeigt, zeitweise über die Mängel der deutschen Sprache seufzte. Diese Klagen beginnen in der Zeit, in der Goethe versucht mit dem italienischen Singspiel zu wetteifern, und eine Zeitlang ist sein Unmut so groß, dass er behauptet er würde lieber in der italienischen als in seiner eigenen Sprache dichten.
Arthur Hübner nennt die Sprache des Dichters einen kostbaren Wertstoff, und vergleicht sie mit dem Stein des Bildhauers. Dieses Bild zeigt meiner Meinung nach sehr deutlich, dass es Aufgabe des Dichters ist, sein „Material“, d.h. die Sprache, zu bearbeiten und so zu gestalten, dass es ihm möglich wird durch sie das auszudrücken, was er auszudrücken wünscht. Dadurch dass Johann Wolfgang von Goethe stets versucht, sein „Material“ zu bearbeiten, überwindet er die Schwierigkeiten, die ihm seine Muttersprache bereitet, es gelingt ihm, seinem Ausdruck Schärfe und Bestimmtheit zu verleihen.
Diese Arbeit des Dichters an seinem „Material“, führt dazu dass Goethe eine sehr bedeutende Rolle in der Entwicklung der deutschen Sprache übernimmt, insbesondere in der Festigung der nationalen Literatursprache.
Inhaltsverzeichnis
- I. Goethe und die deutsche Sprache ...
- II. Wortbildungen in Johann Wolfgang von Goethes „Faust“.
- 1 Wortbildungen des jungen Goethe
- a) Substantivbildung ........
- b) Adjektivbildung.......
- c) Bildung von Verben
- 2. Wortbildungen des klassischen Goethe.
- a) Substantiv- und Adjektivbildung nach dem Muster der antiken Sprachen.………………
- b) Bildungen von Verben
- 3. Wortbildungen des alten Goethe..
- a) Verbbildung durch Präfigierung
- b) Adjektivbildung durch Suffigierung .
- c) Goethes Streben nach größtmöglicher Kürze im Ausdruck
- 1 Wortbildungen des jungen Goethe
- III. Goethes Einfluss auf den deutschen Wortschatz ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wortbildungen in Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ und betrachtet deren Entwicklung im Laufe des Dichters Lebens. Dabei wird die Bedeutung Goethes für die Festigung der deutschen Literatursprache und sein Einfluss auf den Wortschatz beleuchtet.
- Die Entwicklung von Goethes Sprachverständnis
- Der Einfluss von Klopstock, Herder und anderen auf die Wortbildung
- Wortbildungen im Kontext von „Sturm und Drang“ und der griechischen Klassik
- Goethes Streben nach Prägnanz und Ausdruckskraft in der Sprache
- Goethes Beitrag zur Festigung der deutschen Literatursprache
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil beleuchtet Goethes Verhältnis zur deutschen Sprache und die Veränderungen seiner Sprachauffassung im Laufe seines Lebens. Es wird Goethes Werdegang als Dichter und sein Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Literatursprache dargestellt. Das zweite Kapitel widmet sich den Wortbildungen im „Faust“, wobei die Entwicklung der Wortbildungen in den verschiedenen Phasen von Goethes Leben betrachtet werden. Die Arbeit analysiert die sprachlichen Besonderheiten des jungen Goethe, die Einflüsse von Klopstock und Herder und die Verwendung von Wortbildungen im Kontext von „Sturm und Drang“. Im dritten Kapitel werden die Wortbildungen des klassischen Goethe untersucht, die von der griechischen Klassik beeinflusst sind. Außerdem wird Goethes Streben nach Prägnanz und Ausdruckskraft in der Sprache und sein Einfluss auf den deutschen Wortschatz betrachtet.
Schlüsselwörter
Johann Wolfgang von Goethe, „Faust“, Wortbildung, deutsche Sprache, Literatursprache, Sturm und Drang, klassische Literatur, Klopstock, Herder, Präfigierung, Suffigierung, Ausdruckskraft, Wortschatz.
- Citation du texte
- Sylvie Langehegermann (Auteur), 2004, Wortbildungen in Johann Wolfgang von Goethes "Faust", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71193