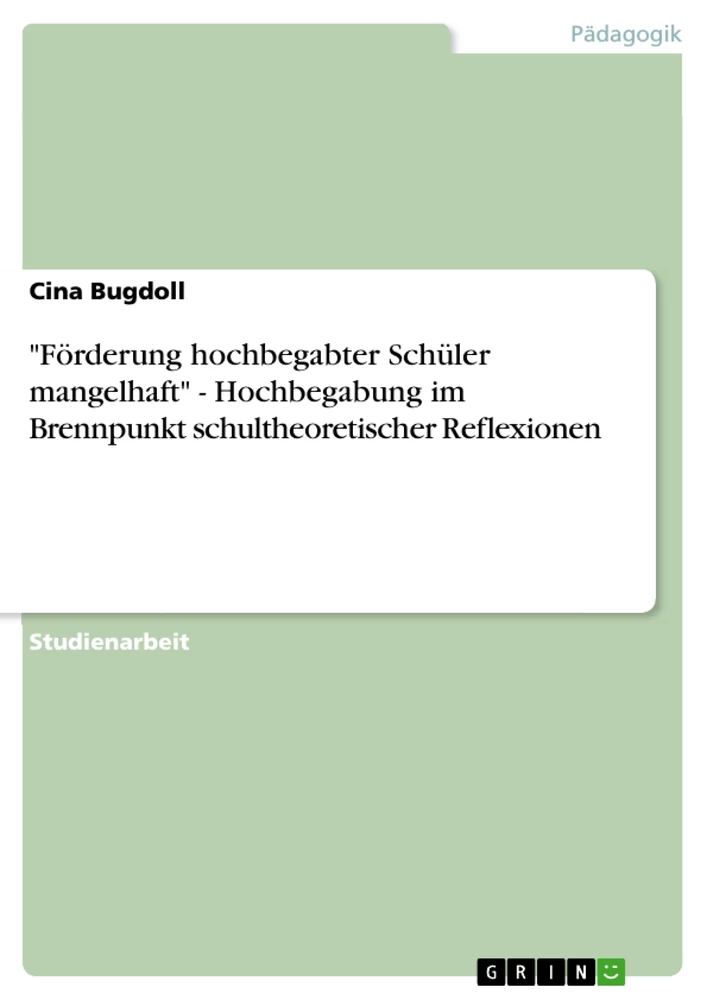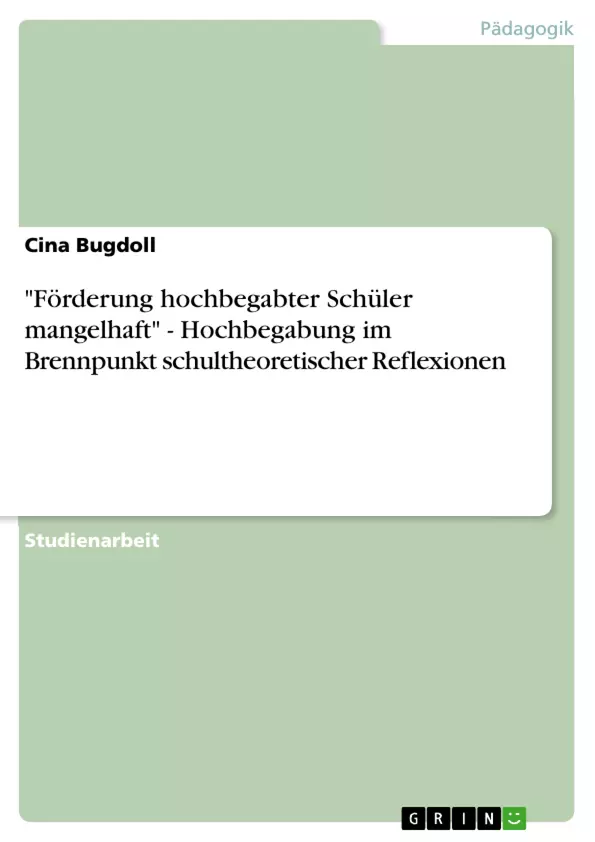„Hochbegabung“ als Hausarbeitsthema im Rahmen eines erziehungswissenschaftlichen Seminars mit dem Schwerpunkt „Schultheorien im 20. Jahrhundert“ - das ist der inhaltliche Ausgangspunkt dieses Textes. Das bedeutet, die Betrachtung der Hochbegabten ist vor allem in einen schultheoretischen Kontext eingebunden.
Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in die Problematik des Hochbegabungsbegriffs und den dazugehörigen Erklärungen wird das gesamte Spektrum der Schultheorie und -pädagogik auf das Thema „Hochbegabung“ bezogen.
Die Dokumentation über die Auseinandersetzungen zur Legitimität einer Hochbegabtenförderung leitet in die schultheoretische Betrachtung von „Hochbegabung“ ein. Der Überblick zur geschichtlichen Entwicklung pädagogischer und psychologischer Beschäftigungen mit besonders begabten Kindern und Jugendlichen ergänzt diesen Einstieg.
Der schultheoretische Diskurs unterliegt dann einer systematischen Logik, die von der Schule als ein System mit ihren makroorganisatorischen und curricularen Möglichkeiten und Grenzen für Hochbegabte ausgeht, um über die einzelne Schule zu Unterrichtsmethoden und zur Qualifikation von Lehrkräften zu gelangen.
In einem beschreibenden und zugleich argumentierendem Stil wird das Schulsystem daraufhin geprüft, inwiefern der Adressat namens „hochbegabter Schüler“ dort eingegliedert werden kann. Es ist Anliegen zu prüfen, ob die Schlagzeile der Berliner Morgenpost „Förderung hochbegabter Schüler mangelhaft“ (BERLINER MORGENPOST, 24.11.2000) ihre Berechtigung findet.
Die Analogie zu Kindern mit Lern- und Entwicklungsproblemen wird aufgenommen, indem aus rehabilitationspädagogischer Sicht Bilanz aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen wird und die Notwendigkeit eines integrativen Schulsystems, dass alle Begabungsbereiche und -niveaus berücksichtigt, erläutert und diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Hochbegabung als Gegenstand schultheoretischer Betrachtungen
- 2. Das Phänomen Hochbegabung
- 2.1 Denkweisen und Alltagsvorstellungen: Hochbegabte zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und Ablehnung
- 2.2 Definitions- und Erklärungsvielfalt: Hochbegabung als unfassbarer Begriff
- 3. Schultheoretische Reflexionen zur Hochbegabung
- 3.1 Disput über die Beschäftigung mit Hochbegabung
- 3.2 Geschichtlicher Überblick zur schulischen Förderung Hochbegabter
- 3.3 Schulorganisatorische Grenzen und Möglichkeiten des deutschen Schulsystems hinsichtlich der Hochbegabtenförderung
- 3.4 Die curriculare Dimension oder die Frage nach Quantität und Qualität des Schulwissens für Hochbegabte
- 3.5 Die Rolle des Lehrers: Fragen an die Professionalisierung für den Umgang mit Hochbegabten
- 4. Bilanz: Konstrukt einer Pädagogik ohne Klassifizierungs- und Aussonderungsmechanismen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Hochbegabung im Kontext der schultheoretischen Diskussion im 20. Jahrhundert. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf Hochbegabung, sowohl in Bezug auf gesellschaftliche Akzeptanz und Ablehnung als auch in Bezug auf die Definitions- und Erklärungsvielfalt des Begriffs.
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der schulischen Förderung Hochbegabter in einem geschichtlichen Kontext
- Der Disput um die Legitimität der Hochbegabtenförderung und die verschiedenen Perspektiven auf das Thema
- Die Analyse der schulorganisatorischen Grenzen und Möglichkeiten für die Förderung Hochbegabter im deutschen Schulsystem
- Die Rolle des Lehrers im Umgang mit Hochbegabten und die Notwendigkeit einer spezifischen Professionalisierung
- Die Suche nach einer Pädagogik, die ohne Klassifizierungs- und Aussonderungsmechanismen funktioniert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext der Schultheorie dar. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Phänomen der Hochbegabung und betrachtet die verschiedenen Denkweisen und Alltagsvorstellungen sowie die unterschiedlichen Definitionen und Erklärungsmodelle.
Kapitel 3 analysiert die schultheoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Hochbegabung, beleuchtet den historischen Diskurs und untersucht die schulorganisatorischen Grenzen und Möglichkeiten im deutschen Schulsystem. Die curriculare Dimension und die Rolle des Lehrers im Umgang mit Hochbegabten werden ebenfalls behandelt.
Das vierte Kapitel zieht eine Bilanz und diskutiert die Herausforderungen und Chancen einer Pädagogik, die ohne Klassifizierungs- und Aussonderungsmechanismen funktioniert.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Schultheorie, Förderung, Schulsystem, Lehrerrolle, Professionalisierung, Inklusion, Exklusion, Pädagogik, Lernprozesse, gesellschaftliche Akzeptanz, Definitionsvielfalt, Erklärungsmodelle, Historische Entwicklung, Schulorganisatorische Möglichkeiten, Curriculare Dimension.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Hochbegabung pädagogisch definiert?
Hochbegabung ist ein vielschichtiger Begriff, der weit über einen hohen IQ hinausgeht und verschiedene Begabungsbereiche sowie das Potenzial zu außergewöhnlichen Leistungen umfasst.
Warum ist die Förderung hochbegabter Schüler oft umstritten?
Es gibt einen gesellschaftlichen Disput über die Legitimität der Eliteförderung im Vergleich zur Unterstützung von Schülern mit Lernproblemen, was oft zu Vorwürfen der sozialen Ungerechtigkeit führt.
Welche Grenzen setzt das deutsche Schulsystem der Begabtenförderung?
Strukturelle Grenzen liegen oft in der mangelnden Flexibilität der Curricula, großen Klassenstärken und der traditionellen Ausrichtung auf den Durchschnittsschüler.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft beim Umgang mit Hochbegabten?
Lehrkräfte benötigen eine spezifische Professionalisierung, um Hochbegabung zu erkennen und den Unterricht qualitativ so zu differenzieren, dass Unterforderung vermieden wird.
Was ist das Ziel einer „Pädagogik ohne Aussonderungsmechanismen“?
Das Ziel ist ein integratives Schulsystem, das alle Begabungsniveaus wertschätzt und fördert, ohne Kinder durch Klassifizierungen zu stigmatisieren oder auszugrenzen.
- Citation du texte
- Cina Bugdoll (Auteur), 2001, "Förderung hochbegabter Schüler mangelhaft" - Hochbegabung im Brennpunkt schultheoretischer Reflexionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71200