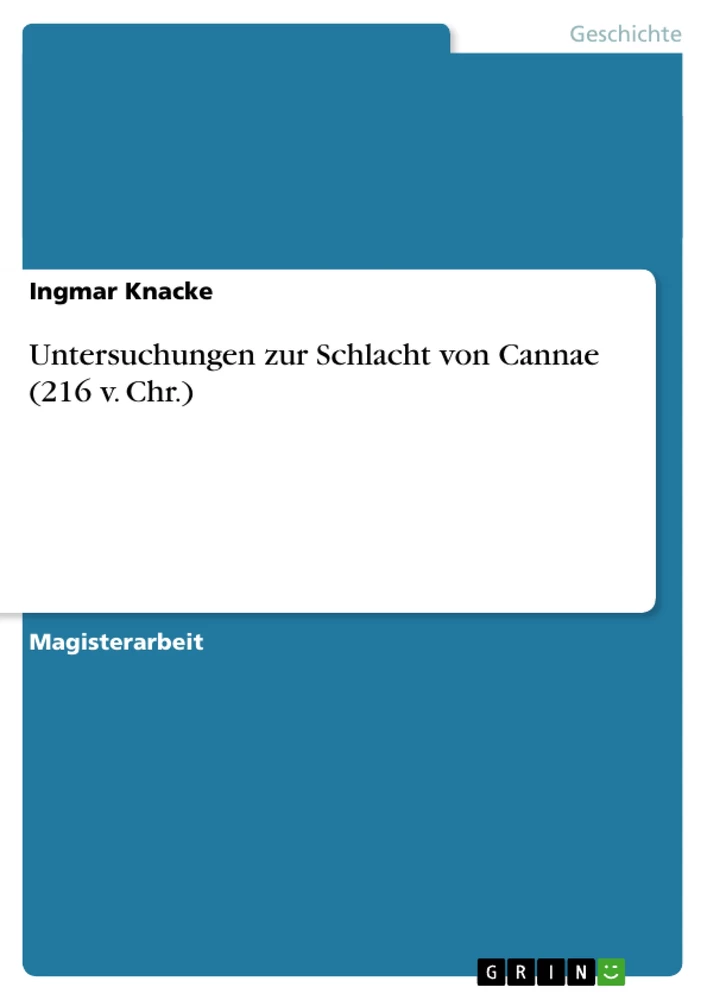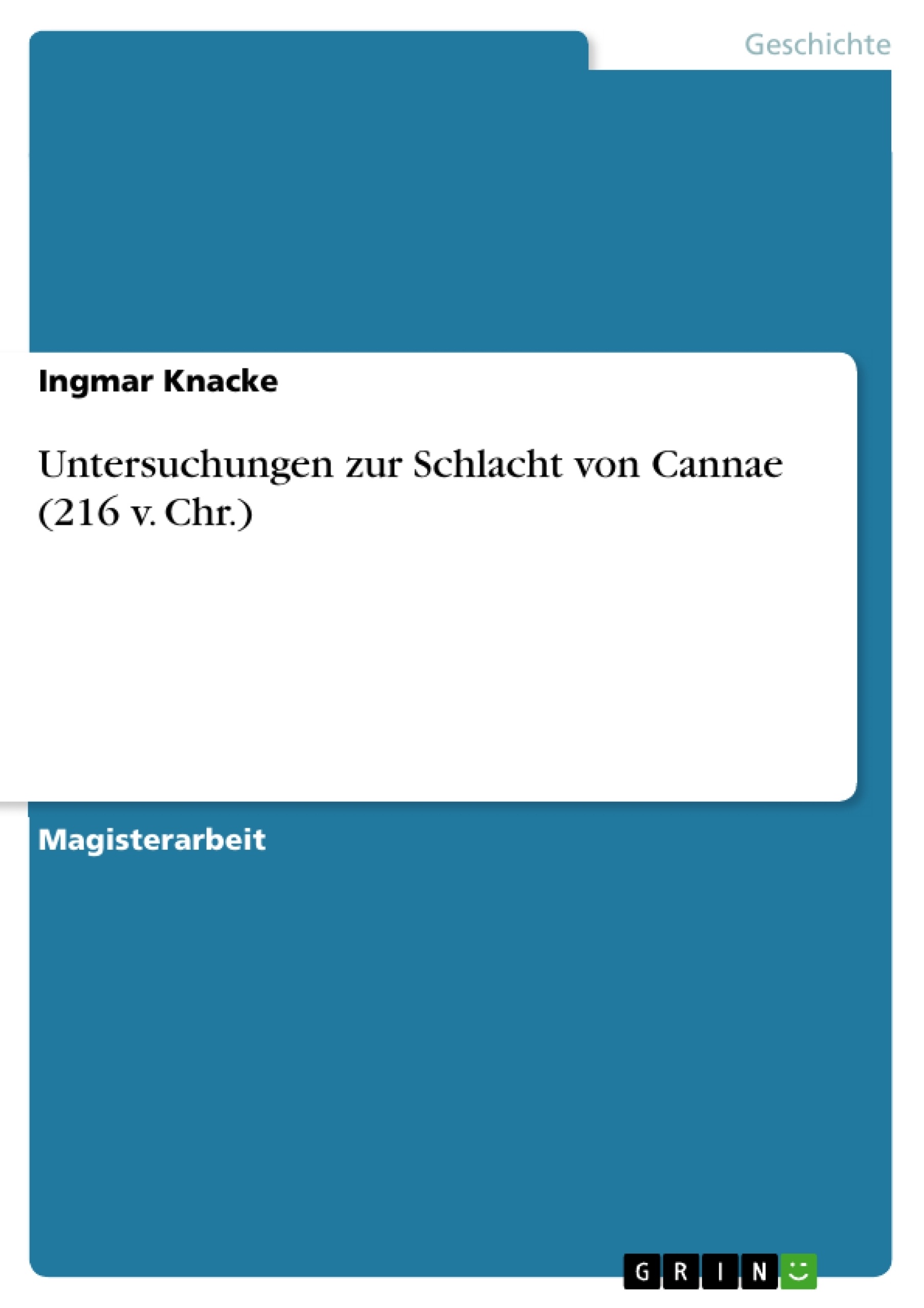Als Generalfeldmarschall Alfred Graf Schlieffen im Januar des Jahres 1906 als Chef des Generalstabes verabschiedet wurde, begann für ihn eine Zeit reger Beschäftigung mit historischen Fragen. Unermüdliche Tätigkeit kennzeichnete auch seinen letzten Lebensabschnitt, bis er im Jahre 1913 im Alter von 79 Jahren verstarb. Wie berichtet wird, bewahrte er sich bis zum Schluß seine geistige Beweglichkeit und Frische. Neben einer in diesem Zeitraum entstandenen Geschichte des gräflichen Hauses Schlieffen beschäftigte er sich in erster Linie mit kriegsgeschichtlichen Studien, welche größtenteils in den vom Generalstab herausgegebenen „Vierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde“ erschienen. Auch für das „Handbuch für Heer und Flotte“ verfaßte er zahlreiche Beiträge. Eine breitere Öffentlichkeit erreichte er mit seinem im Januar 1909 in der „Deutschen Revue“ erschienenen Artikel „Der Krieg in der Gegenwart“, in dem seine grundlegenden militärpolitischen Anschauungen besonders deutlich hervortreten. Die meisten von seinen Schriften wandten sich jedoch an ein begrenztes Fachpublikum. Aus dieser Gruppe hat seine Cannae-Studie, die gewissermaßen eine Erläuterung des „Kriegs in der Gegenwart“ darstellt, am meisten Aufsehen erregt und auch über seinen Tod hinaus mit Abstand die größte Wirkung erzeugt. Auslöser für die Beschäftigung mit der Materie war die „Geschichte der Kriegskunst“ des Berliner Historikers Hans Delbrück3, deren Studium er sich nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand eingehend widmete und die auf ihn eine außerordentliche Faszination ausübte. Hier fand er seine in jahrelanger Generalstabstätigkeit gewonnenen Ansichten über Wesen und Gesetz der Kriegführung bestätigt. Insbesondere Delbrücks Darstellung des Verlaufs von Cannae brachte ihn zu der Überzeugung, daß in dieser Schlacht gleichsam der Prototyp der Vernichtungsschlacht, welche er als höchstes anzustrebendes Ziel der Kriegführung bereits während seiner aktiven Dienstzeit als Generalstabschef postuliert hatte, in der Menschheitsgeschichte erstmalig in voller Klarheit erkennbar wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Rekonstruktion
- 2.1. Die Phalanx als Grundlage antiker Kriegführung
- 2.2. Das Heerwesen der Römer im Zeitalter der Punischen Kriege
- 2.3. Das Heerwesen der Karthager
- 2.3.1. Afrikaner
- 2.3.2. Iberer
- 2.3.3. Kelten
- 3. Rekonstruktion der Schlacht
- 3.1. Zur Quellenlage
- 3.1.1. Überlieferungsgeschichte
- 3.1.2. Appian, Silius und Plutarch
- 3.1.3. Livius und Polybios
- 3.2. Die Schlacht nach Livius und Polybios
- 3.2.1. Operationen vor der Schlacht
- 3.2.2. Vorgänge auf dem Schlachtfeld
- 3.3. Fragen der Forschung
- 3.3.1. Lokalisierung des Schlachtfeldes
- 3.3.2. Kräfteverhältnis
- 3.3.3. Schlachtverlauf
- 3.3.4. Verluste
- 3.1. Zur Quellenlage
- 4. Gesamtbild der Schlacht
- 5. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Rekonstruktion der Schlacht von Cannae im Jahre 216 v. Chr. und verfolgt das Ziel, die wichtigsten Aspekte dieser für die Geschichte des antiken Krieges bedeutenden Schlacht anhand historischer Quellen und Forschungsarbeiten zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Analyse der Quellenlage, die Darstellung des Schlachtverlaufs und die Beantwortung zentraler Forschungsfragen.
- Die Phalanx als Grundlage antiker Kriegführung
- Das Heerwesen der Römer und der Karthager
- Die Rekonstruktion des Schlachtverlaufs anhand der Quellen von Livius und Polybios
- Die Bedeutung der Schlacht von Cannae für die militärische Strategie
- Aktuelle Forschungsdebatten zur Lokalisierung des Schlachtfelds, dem Kräfteverhältnis und den Verläufen der Schlacht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz der Schlacht von Cannae in der Geschichte des antiken Krieges heraus. Kapitel zwei beleuchtet die Grundlagen der Rekonstruktion der Schlacht, indem es die wichtigsten Aspekte des römischen und karthagischen Heerwesens sowie die Rolle der Phalanx in der antiken Kriegführung erläutert. Kapitel drei widmet sich der Rekonstruktion des Schlachtverlaufs anhand der Quellen von Livius und Polybios. Dabei werden sowohl die Vorgänge vor der Schlacht als auch die Kampfhandlungen auf dem Schlachtfeld detailliert beschrieben. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Forschungsfragen zur Schlacht von Cannae diskutiert. Hierbei werden die Kontroversen zur Lokalisierung des Schlachtfeldes, dem Kräfteverhältnis und den Verläufen der Schlacht beleuchtet. Das fünfte Kapitel bietet eine abschließende Betrachtung der Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Schlüsselbegriffen und Themenfeldern: Schlacht von Cannae, Antike Kriegführung, Phalanx, Heerwesen, Römisches Heer, Karthagisches Heer, Hannibal, Scipio, Livius, Polybios, Quellenkritik, Rekonstruktion, Schlachtverlauf, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die Schlacht von Cannae (216 v. Chr.) militärhistorisch so bedeutend?
Sie gilt als der Prototyp der Vernichtungsschlacht, bei der ein zahlenmäßig unterlegenes Heer (Karthager unter Hannibal) ein überlegenes römisches Heer durch Umfassung fast vollständig vernichtete.
Welche Quellen werden für die Rekonstruktion der Schlacht genutzt?
Die wichtigsten historischen Quellen stammen von den antiken Geschichtsschreibern Livius und Polybios.
Welche Rolle spielte Generalfeldmarschall Graf Schlieffen in der Cannae-Forschung?
Schlieffen sah in Cannae das vollkommene Vorbild für moderne Kriegsführung und entwickelte basierend auf seinen Studien Strategien für den Generalstab.
Wie unterschieden sich das römische und das karthagische Heerwesen?
Das römische Heer basierte auf der Legionärsstruktur, während Hannibals Heer eine heterogene Mischung aus Afrikanern, Iberern und Kelten war.
Gibt es heute noch Unklarheiten über die Schlacht?
Ja, in der Forschung wird weiterhin über die exakte Lokalisierung des Schlachtfeldes, das genaue Kräfteverhältnis und die exakten Verlustzahlen debattiert.
- Citation du texte
- Ingmar Knacke (Auteur), 2002, Untersuchungen zur Schlacht von Cannae (216 v. Chr.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7138