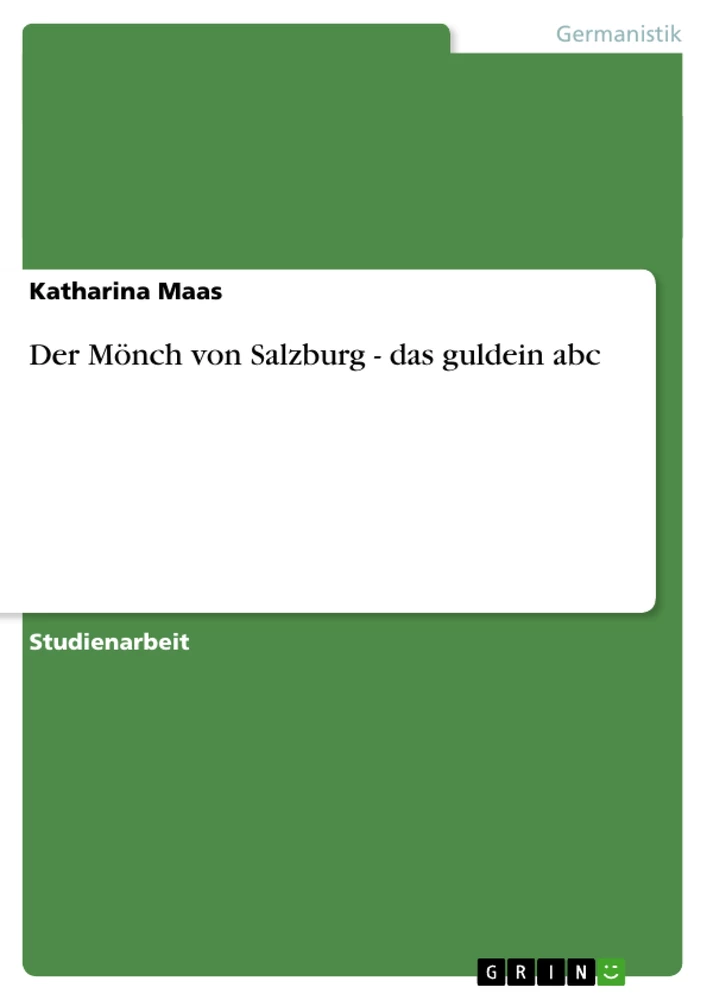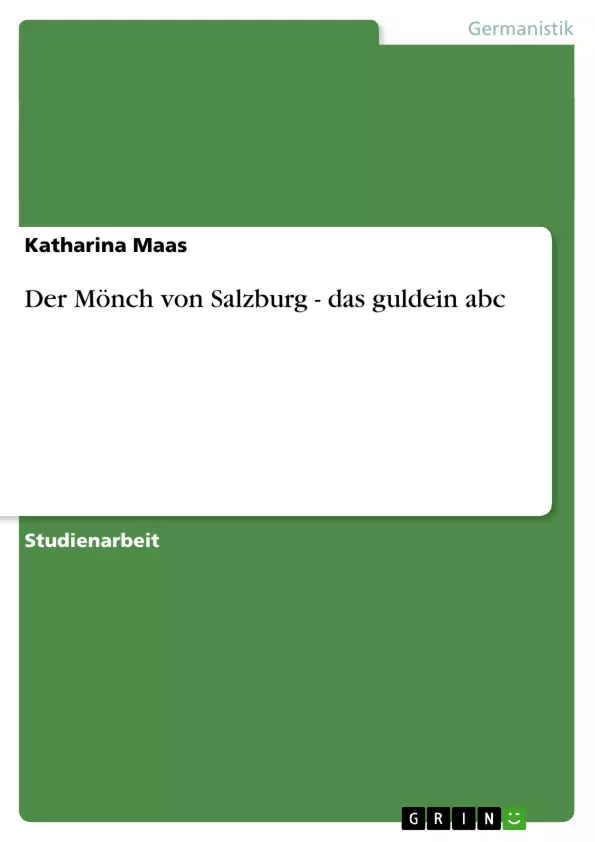Die Menschen im hohen und späten Mittelalter lebten in einer Zeit der Armut und der ständigen Seuchengefahr, einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Städten einerseits und des Ideals der Armut und Entsagung andererseits. Die christlichen Dokmen waren streng und vermittelten den Gläubigen eine ständige Angst vor der eigenen Vergänglichkeit und der ewigen Verdammnis. Demzufolge brauchten die Menschen eine besondere Fürsprecherin und Mittlerin bei Gott, die sie in der Jungfrau Maria fanden. Es entstanden eine Fülle von Mariendichtungen und - liedern. Einer der wichtigsten und am weitesten verbreitete Dichter dieser Zeit war der Mönch von Salzburg, der dem Hofe des Erzbischofs Pilgrim II von Puchheim angehörte. Er hinterließ neben weltlichen und christlichen Liedern viele Werke, die speziell der Mutter Gottes gewidmet waren.
In der vorliegenden Hausarbeit untersuche ich, nach einer kurzen Darstellung des Lebens und Werkes des Mönchs, eines seiner Marienlieder das guldein abc. Ich werde nach der Bedeutung Marias im Mittelalter fragen, die Gründe für ihre Verehrung im historischen Kontext betrachten und den Bezug zum guldein abc herstellen. Weiterhin behandel ich Form und Aufbau des Gedichtes. In den beiden letzten Kapiteln gehe ich auf die vom Dichter verwendeten Beiworte und Sinnbilder zur Beschreibung Marias und die Zahlenallegorese ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mönch von Salzburg, Leben und Werk
- Das guldein abc, ein Mariengedicht
- Warum ein Mariengedicht? Die Bedeutung Marias im hohen und späten Mittelalter
- Marienkult, Entstehung und Ursachen
- Anrufung Marias in Sündenklagen
- Die Verbindung von Loblied und Bittgedicht
- Warum ein Mariengedicht? Die Bedeutung Marias im hohen und späten Mittelalter
- Formale Betrachtung des Gedichtes
- Aufbau
- Abecedarium
- Die verwendeten Sinnbilder zur Beschreibung Marias
- Zahlenallegorese
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Marienlied „das guldein abc“ des Mönchs von Salzburg. Sie beleuchtet die Bedeutung Marias im Mittelalter, untersucht die Gründe für ihre Verehrung im historischen Kontext und analysiert die Verbindung zum „guldein abc“. Des Weiteren wird die Form und der Aufbau des Gedichtes betrachtet. Die Arbeit befasst sich mit den verwendeten Beiwörtern und Sinnbildern zur Beschreibung Marias sowie mit der Zahlenallegorese.
- Die Rolle Marias im hohen und späten Mittelalter
- Die Gründe für den Marienkult im Mittelalter
- Die Bedeutung des „guldein abc“ als Mariengedicht
- Formale Analyse des „guldein abc“
- Die Bedeutung von Sinnbildern und Zahlenallegorese im Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des „guldein abc“ vor und führt in die Thematik der Marienverehrung im Mittelalter ein. Kapitel 2 widmet sich dem Leben und Werk des Mönchs von Salzburg. Kapitel 3 analysiert das „guldein abc“ und betrachtet die Bedeutung Marias im hohen und späten Mittelalter. Hierbei wird die Entstehung des Marienkults sowie die Rolle Marias als Fürsprecherin und Mittlerin bei Gott erläutert. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der formalen Betrachtung des Gedichtes, insbesondere mit seinem Aufbau und dem Abecedarium. Kapitel 5 untersucht die verwendeten Sinnbilder zur Beschreibung Marias, während Kapitel 6 die Zahlenallegorese im Gedicht analysiert.
Schlüsselwörter
Marienkult, Spätmittelalterliche Lyrik, Mönch von Salzburg, das guldein abc, Mariengedicht, Sinnbilder, Zahlenallegorese, Sündenklagen, Fürbitte, Himmelskönigin, Reinheit, Liebe, Milde, Memento Mori.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der „Mönch von Salzburg“?
Ein bedeutender Dichter des späten Mittelalters, der am Hofe des Erzbischofs Pilgrim II. von Puchheim wirkte.
Was ist das Thema des Werkes „das guldein abc“?
Es handelt sich um ein Marienlied, das die Verehrung der Jungfrau Maria im historischen Kontext des Mittelalters thematisiert.
Warum war der Marienkult im Mittelalter so verbreitet?
In einer Zeit von Pest und Armut suchten die Menschen in Maria eine milde Fürsprecherin und Mittlerin bei Gott.
Was versteht man unter einem „Abecedarium“ in der Lyrik?
Ein Gedicht, bei dem die Anfangsbuchstaben der Verse oder Strophen dem Alphabet folgen.
Welche Rolle spielt die Zahlenallegorese im Gedicht?
Zahlen werden im Text symbolische Bedeutungen zugeschrieben, um theologische Wahrheiten zu vermitteln.
- Quote paper
- Katharina Maas (Author), 1996, Der Mönch von Salzburg - das guldein abc, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71512