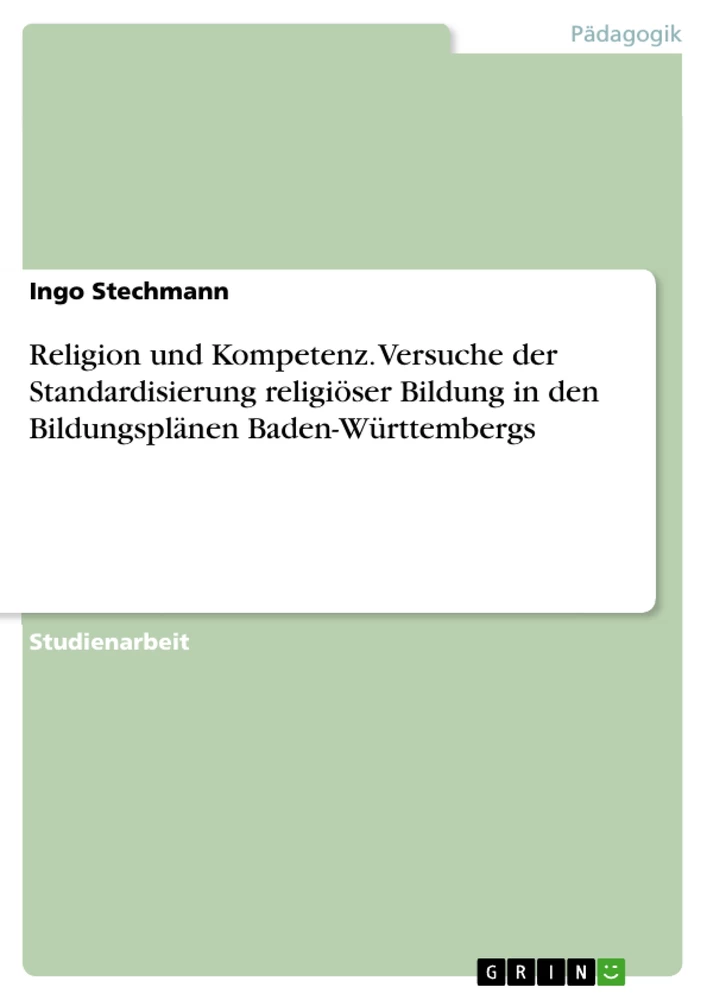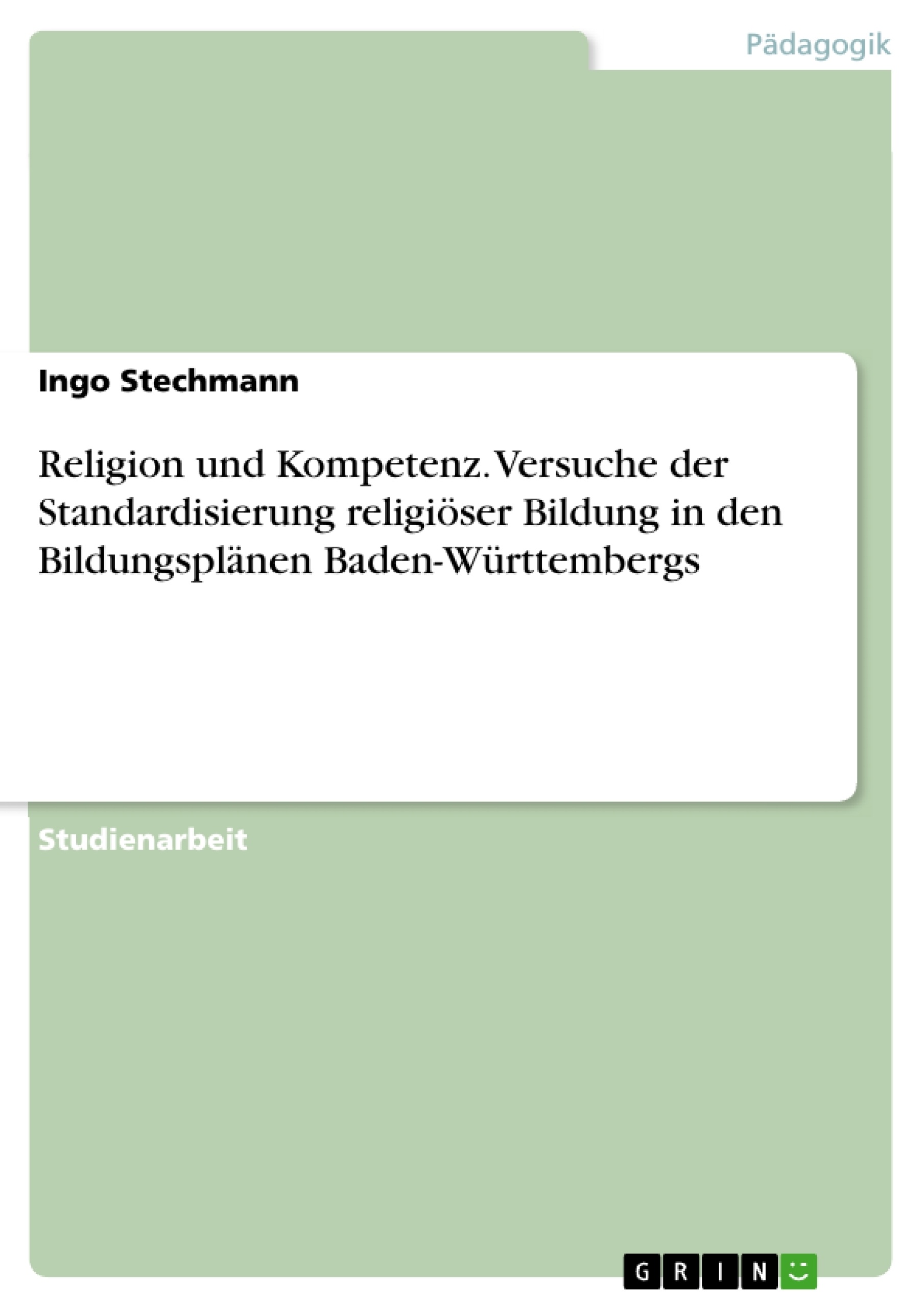Die wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen des Promotionsaufbaustudiums beschäftigt sich aus aktuellem Anlass mit der Vereinbarkeit einer "Kompetenzforderung" und des "Religionsunterrichts". Sowohl der Begriff "Kompetenz" als auch das Phänomen "Religion" werden eingehend analysiert und anschließend auf Vereinbarkeit hin überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Einführung in Themenstellung, Inhalt und Vorgehensweise.
- 1. Die Ausgangslage - Bestandsaufnahme und Situationsanalyse
- 1.1 Religionsunterricht und Schule.
- 1.2 Bildungsreform als Konsequenz von Schulleistungsstudien
- 1.3 „Outcome“ statt Input - Von Lehrplänen zu Bildungsstandards..
- 1.3.1 Lässt sich Bildung standardisieren?
- 1.3.2 Zur Einführung von Bildungsstandards in Deutschland.
- 1.4 Die neuen Bildungspläne Baden-Württembergs..
- 1.4.1 Inhalt und Aufbau......
- 1.4.2 Standardisierung des Religionsunterrichts.
- 2. Religion und Kompetenz
- 2.1 Vom „Heiligen“ einer „kollektiven Zwangsneurose“ - Was ist Religion?.
- 2.1.1 Allgemeine Einführung
- 2.1.2 Theologie und Religionskritik..
- 2.1.3 Religion „von Außen“.
- 2.1.3.1 Religionspsychologie
- 2.1.3.2 Religionsphilosophie ………….
- 2.1.3.3 Religionssoziologie.
- 2.1.3.4 Zur Funktion von Religion........
- 2.2 Zu Herkunft und Entwicklungsgeschichte des Kompetenzbegriffs.
- 2.3 Zur Vereinbarkeit zweier Begriffe: „Religiöse Kompetenz“.
- 2.1 Vom „Heiligen“ einer „kollektiven Zwangsneurose“ - Was ist Religion?.
- 3. Kompetenzformulierungen und die Frage nach religiöser Grundbildung
- 3.1 Die Formulierungen des baden-württembergischen Lehrplans
- 3.1.1 Bildungsplan 2004 - Evangelische Religionslehre
- 3.1.2 Bildungsplan 2004 - Katholische Religionslehre.
- 3.2 Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis.
- 3.3 Die Frage nach schulischem Bedarf und Lehrbarkeit von Religion .....
- 3.1 Die Formulierungen des baden-württembergischen Lehrplans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik „Religion und Kompetenz“ und analysiert die Versuche der Standardisierung religiöser Bildung in den Bildungsplänen Baden-Württembergs. Die Arbeit hinterfragt die zunehmende Standardisierung des Bildungssystems im Kontext von Schulleistungsstudien und beleuchtet kritisch den Einfluss des Kompetenzbegriffs auf den Religionsunterricht. Sie untersucht, ob der Religionsunterricht tatsächlich dem „Kompetenzwahn“ erliegen sollte und wie die Vereinbarkeit von „Religion“ und „Kompetenz“ im Bildungssystem aussehen kann.
- Entwicklung und Analyse des Kompetenzbegriffs
- Standardisierungstendenzen im Bildungssystem
- Der Einfluss von Schulleistungsstudien auf die Bildungspläne
- Die Rolle des Religionsunterrichts in der Bildungslandschaft
- Die Frage nach der Lehrbarkeit von Religion im Kontext von Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort bietet eine Einführung in die Themenstellung, den Inhalt und die Vorgehensweise der Arbeit. Es beschreibt den Hintergrund der Standardisierungstendenzen im Bildungssystem und die Entstehung der Frage nach der „Religiösen Kompetenz“. Kapitel 1 analysiert die Ausgangslage und die Situation des Religionsunterrichts in der heutigen Bildungslandschaft. Es betrachtet die Auswirkungen von Schulleistungsstudien und die Einführung von Bildungsstandards auf das Bildungssystem. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Begriffen „Religion“ und „Kompetenz“. Es erläutert die Entstehung und Entwicklung des Kompetenzbegriffs sowie die unterschiedlichen Perspektiven auf Religion. Zudem wird die Frage nach der Vereinbarkeit von „Religion“ und „Kompetenz“ erörtert. Kapitel 3 befasst sich mit der Frage nach religiöser Grundbildung und analysiert die Kompetenzen, die in den Bildungsplänen für den Religionsunterricht in Baden-Württemberg formuliert werden. Des Weiteren werden Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis zur Entwicklung und Implementierung von religiöser Kompetenz im Unterricht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenfelder „Religion und Kompetenz“, „Standardisierung“, „Bildungspläne“, „Schulleistungsstudien“, „Bildungsstandards“, „Religionsunterricht“, „Kompetenzentwicklung“, „Religiöse Grundbildung“, „Baden-Württemberg“ und „Lehrbarkeit von Religion“.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Kompetenz" im modernen Bildungssystem?
Im Zuge von Schulleistungsstudien wie PISA hat sich der Fokus von reinen Lehrplänen (Input) hin zu messbaren Bildungsstandards (Outcome) verschoben, die definieren, was Schüler am Ende können sollen.
Lässt sich religiöse Bildung überhaupt standardisieren?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Religion als persönliches und existenzielles Phänomen in messbare Kompetenzstufen gepresst werden kann, ohne ihren Kern zu verlieren.
Was sind die Bildungspläne 2004 in Baden-Württemberg?
Diese Pläne führten erstmals umfassende Bildungsstandards für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht ein, die sich an Kompetenzformulierungen orientieren.
Was versteht man unter "Religiöser Kompetenz"?
Es ist die Fähigkeit, religiöse Ausdrucksformen zu verstehen, über religiöse Fragen reflektiert zu urteilen und eine eigene Position in Glaubensfragen zu entwickeln.
Welche Kritik gibt es am "Kompetenzwahn" im Religionsunterricht?
Kritiker befürchten, dass durch die Fixierung auf Lehrbarkeit und Prüfbarkeit die Tiefe religiöser Erfahrung und die Freiheit des Glaubens im schulischen Kontext vernachlässigt werden.
- Quote paper
- Ingo Stechmann (Author), 2006, Religion und Kompetenz. Versuche der Standardisierung religiöser Bildung in den Bildungsplänen Baden-Württembergs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71604