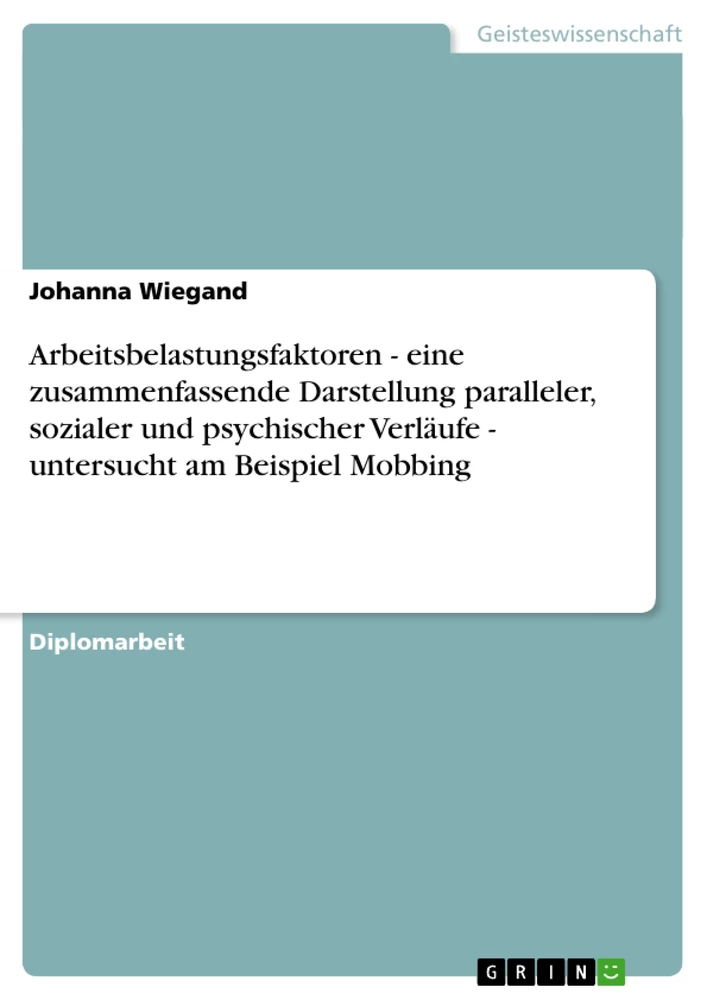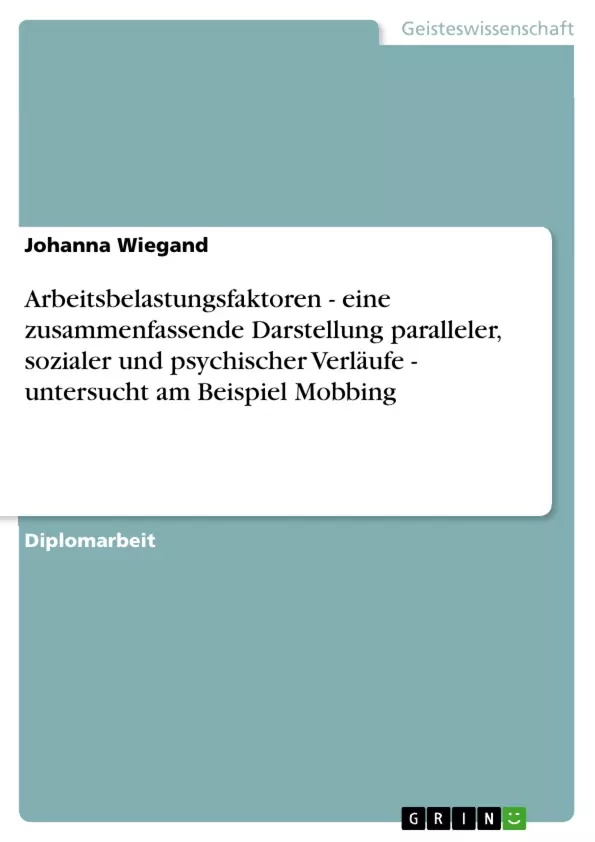Die Arbeit an sich ist heute dank des technischen Fortschritts wesentlich
vereinfacht worden. Auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft
sind gesundheitliche Probleme aufgrund körperlicher Arbeit
vielfach aus dem Alltag verschwunden. An diese Stelle sind
andere Faktoren getreten, die den Arbeitsalltag zunehmend belasten.
Zu diesen Belastungsfaktoren, denen ein Mensch am Arbeitsplatz
ausgesetzt sein kann, gehören: Mangel an Herausforderung,
tägliche Reibereien und Ärgernisse (z.B. wichtige Informationen
erreichen den Arbeitsplatz nur unvollständig oder wichtige Arbeitsmittel
sind unzuverlässig) und quantitative Überforderung
(z.B. Arbeit unter hohem Zeitdruck, Überstunden und Schichtarbeit).
Weitere Faktoren können soziale Konflikte oder traumatisierende
Ereignisse bei psychisch anspruchsvollen Berufen, wie etwa
bei dem Polizeidienst, sein. Eine besondere Belastungssituation
kann entstehen, wenn mehrere der genannten Phänomene gleichzeitig
auftreten.
Das Thema „Mobbing“, welches in der jüngeren Vergangenheit
verstärkt in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt worden ist,
nimmt dabei aufgrund seiner Berufsimmanenz einen besonderen
Stellenwert ein. Dabei ist das Problem Mobbing nicht neu, dies belegen
die Befragungen von Levenstein aus dem Jahre 1912, der
sich mit der Qualität der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz beschäftigte.
Doch ähnlich wie bei anderen Themen wurde Mobbing
erst zum Gesprächsgegenstand, als erste populärwissenschaftliche
Veröffentlichungen die Gesellschaft erregten.
Der Grund für die Verbreitung des Themas mag wohl abgesehen
von der menschlichen Seite überwiegend der volkswirtschaftliche
Schaden für die Bundesrepublik Deutschland sein, der auf ca. 15
bis 50 Mrd. Euro jährlich geschätzt wird. Allerdings gibt es keine gesicherten Zahlen, die Schätzung scheint aber angesichts der
weiten Verbreitung von Mobbing durchaus realistisch.3
Der schwedische Psychologe Heinz Leymann hat eine der umfangreichsten
Untersuchungen auf dem Gebiet „Mobbing“ durchgeführt.
Er interviewte Anfang der Neunziger zahlreiche Betroffene
und führte Umfragen in schwedischen Unternehmen durch. Die
Ergebnisse und seine Schlussfolgerungen genießen einen hohen
Stellenwert innerhalb der Fachwelt. Seine Arbeiten sollen deshalb
Grundlage für diese Arbeit sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing
- Definition
- Begriffsabgrenzung
- Was unterscheidet Mobbing vom alltäglichen beruflichen Ärger?
- Mobbinghandlungen
- Mobbing anhand einer Umfrage
- Vier Phasen des Mobbings
- Mobbingursachen
- Organisation und Gestaltung der Arbeitsaufgaben
- Leitungs- und Führungsverhalten
- Soziale Dynamik der Arbeitsgruppe
- Mangelnde Konfliktbewältigung
- Theorien der Persönlichkeit
- Mobbing als psychosozialer Stress
- Psychische Auswirkungen
- Körperliche und psychosomatische Beschwerden
- Folgen für das Unternehmen und den Betroffenen
- Psychische Auswirkungen
- Interventionsmöglichkeiten und Prävention
- Konfliktverständnis und Handhabung durch den Vorgesetzten
- Konflikthandhabung durch den Betroffenen
- Hilfe durch professionelle Berater
- Mobbingtagebuch
- Betriebsvereinbarung
- Juristische Lösungsansätze
- Prävention auf der strukturell-organisatorischen Ebene
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz und verfolgt das Ziel, die Ursachen, Auswirkungen und Interventionen in diesem Kontext zu beleuchten. Sie untersucht den Prozess des Mobbings, die psychischen und sozialen Folgen für Betroffene sowie die Möglichkeiten der Prävention und Intervention.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing
- Ursachen und Entstehungsbedingungen von Mobbing
- Psychische und soziale Folgen von Mobbing
- Interventionsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen
- Möglichkeiten der Konfliktlösung und der Bewältigung von Mobbingsituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Mobbing als relevantes Problem in der Arbeitswelt dar, beleuchtet die Verbreitung und die Auswirkungen auf Betroffene. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „Mobbing“ und unterscheidet ihn von alltäglichem beruflichen Ärger. Kapitel 3 analysiert Mobbing anhand einer durchgeführten Umfrage. Die vier Phasen des Mobbings werden in Kapitel 4 dargestellt, während Kapitel 5 die Ursachen von Mobbing untersucht, die von organisatorischen Faktoren über Führungsverhalten bis hin zu sozialer Dynamik der Arbeitsgruppe reichen. Kapitel 6 beleuchtet die psychischen und physischen Auswirkungen von Mobbing auf den Betroffenen und das Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Aspekten von Mobbing am Arbeitsplatz. Sie beleuchtet die Definition, Abgrenzung, Ursachen und Folgen von Mobbing sowie die Möglichkeiten der Intervention und Prävention. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören Mobbing, psychosozialer Stress, Konfliktlösung, Intervention, Prävention, Arbeitsbelastungsfaktoren, psychische Gesundheit, Arbeitsklima, Führungsverhalten, soziale Dynamik, und juristische Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Mobbing von normalem beruflichem Ärger?
Mobbing zeichnet sich durch die Systematik, Häufigkeit und Dauer der negativen Handlungen aus, die darauf abzielen, eine Person auszugrenzen oder zu schädigen.
Welche Phasen des Mobbings gibt es?
Nach Heinz Leymann verläuft Mobbing typischerweise in vier Phasen, beginnend bei ungelösten Konflikten bis hin zur Abschiebung oder dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.
Was sind die häufigsten Ursachen für Mobbing am Arbeitsplatz?
Ursachen liegen oft in der Arbeitsorganisation (Zeitdruck), mangelhaftem Führungsverhalten, einer gestörten sozialen Dynamik in der Gruppe oder fehlender Konfliktkultur im Unternehmen.
Welche gesundheitlichen Folgen hat Mobbing für Betroffene?
Betroffene leiden häufig unter psychosomatischen Beschwerden, Depressionen, Angstzuständen und langfristigen psychischen Belastungen, die bis zur Erwerbsunfähigkeit führen können.
Wie hoch ist der volkswirtschaftliche Schaden durch Mobbing?
Schätzungen belaufen sich für Deutschland auf jährlich ca. 15 bis 50 Milliarden Euro, bedingt durch Fehlzeiten, Produktionsausfälle und Behandlungskosten.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es?
Möglichkeiten umfassen das Führen eines Mobbingtagebuchs, Mediation, den Abschluss von Betriebsvereinbarungen sowie juristische Schritte und professionelle Beratung.
- Quote paper
- Johanna Wiegand (Author), 2002, Arbeitsbelastungsfaktoren - eine zusammenfassende Darstellung paralleler, sozialer und psychischer Verläufe - untersucht am Beispiel Mobbing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7165