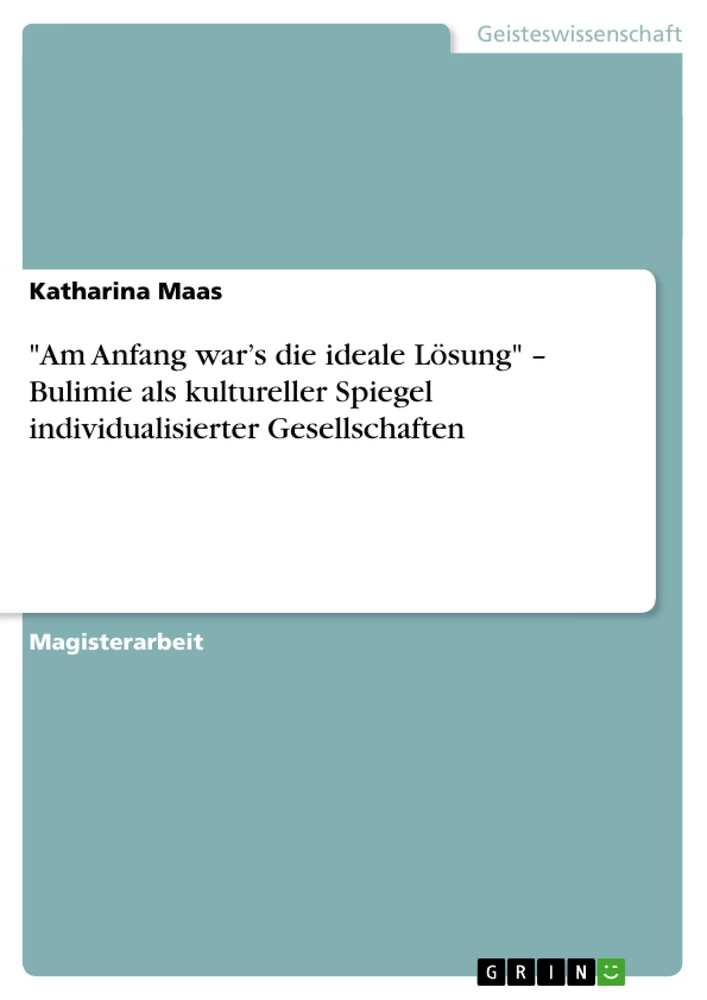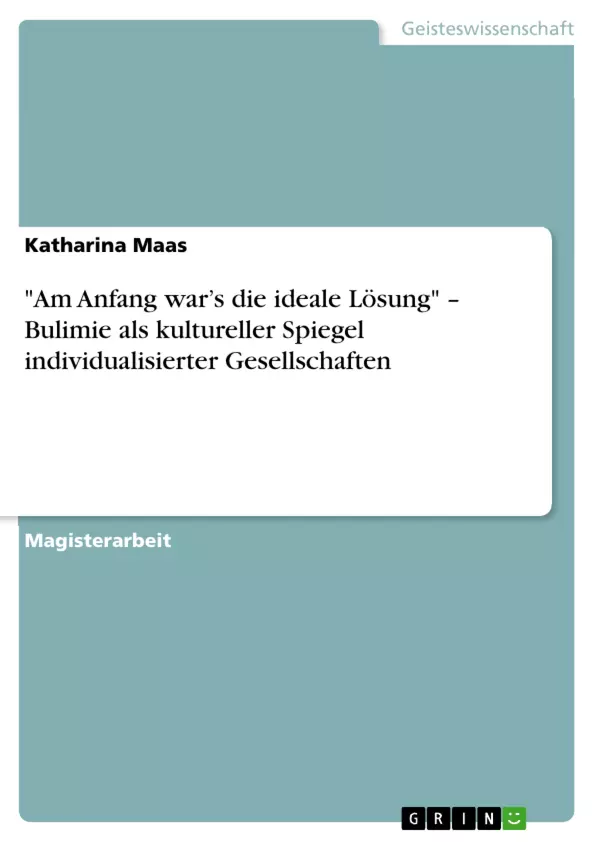Die Ess-Störung Bulimie breitet sich unter Frauen und Mädchen in westlichen Industrienationen seit den achtziger Jahren zunehmend aus und ist immer stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Das rege Medieninteresse ist einerseits positiv und wünschenswert, andererseits ist jedoch die Darstellung und das hiermit transportierte Frauenbild, oftmals problematisch. In der Regel wird das Bild einer Frau gezeichnet, die aufgrund einer meist schwierigen Familien- oder Lebenssituation „erkrankt“ ist und nun wahllos, unkontrolliert – tierisch – riesige Essensmengen verschlingt. Hinterher erbricht sie sich schamvoll und selbsterniedrigend auf der Toilette, um nicht zuzunehmen. Sie wird als übertrieben leistungsorientiert, perfektionistisch und abhängig von Schlankheitsnormen beschrieben. Bulimie wird damit als individuelles Defizit betrachtet und als Störung oder – „gestörte weibliche Entwicklung“ – festgeschrieben. Wer an Bulimie „leidet“, wird in der Regel als tragischer Einzelfall behandelt, und auch so erklärt.
Eine Darstellungsweise jedoch, die Bulimie auf die Individualgeschichte einzelner Frauen reduziert, lässt entscheidende Fragen offen: Wie kommt es zur rapiden Zunahme von Bulimie? Was ist das ‚zeitgemäße‘ an dieser ‚Frauenkrankheit‘?
Um sich dieser Frage annähern zu können, müssen auch soziokulturelle Faktoren systematisch in die Betrachtungsweise miteinbezogen werden. Ohne diese bleibt unerklärlich, warum die Zahlen zur Zunahme von Bulimie erschreckend sind und warum immer mehr Frauen ein gestörtes Verhältnis zum Essen und ihrem Körper entwickeln, wenn auch außerhalb pathologischer Zuschreibungskategorien.
Trotz der Erkenntnis, „dass es sich bei Bulimie um ein allgemein gesellschaftliches Problem handelt, das sich mehr als andere Formen psychosomatischer Störungen mit gesellschaftlichen Normierungen verbinden lässt“ und dass insbesondere das Schlankheits- und Schönheitsdiktat eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Bulimie spielen, werden die ausschlaggebenden Gründe weitestgehend im individuellen Bereich verortet.
[...] Das legt die Vermutung nahe, dass es aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen geben muss, die die Entstehung bulimischen Verhaltens begünstigen und dass jenseits der individualpsychologischen auch soziokulturelle Faktoren hier eine entscheidende Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Bulimie - Annäherung an ein Phänomen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
- 2.1 Klassifizierungsprobleme – Grenzen bisheriger Betrachtungsweisen
- 2.1.1 Normal oder krank?
- 2.1.2 Sucht und Kontrollverlust
- 2.2 Eine erweiterte Perspektive von Bulimie
- 2.2.1 Zur Konjunktur eines Phänomens
- 2.2.2 Besonderheiten der Bulimie aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
- 3. Ernährung, Körperdisziplinierung und die Konstruktion weiblicher Identität
- 3.1 Soziokulturelle Aspekte von Ernährung und Ernähren
- 3.1.1 Essverhältnisse: Von der Fremd-zur Selbstkontrolle des Appetits
- 3.1.2 Ernährung, Körper und die Konstruktion von Weiblichkeit
- 3.1.3 Die Formung des nackten Körpers
- 3.1.3.1 Diät als kulturelle Praxis zur Körperformung
- 3.1.3.2 Weitere anerkannte Kulturtechniken der Körperformung
- 4. Körper(leit)bilder und Normalisierung
- 4.1 Dickleibigkeit als gesellschaftliches Stigma und individuelles Manko
- 4.2 Die Bedeutung von Körper und der Spiegel der Anderen
- 4.3 Schönheit ist machbar
- 4.3.1 Schön schlank - weiblich
- 4.3.2 Schön schlank - modisch
- 4.4 Schönheit als soziales Zeichen – Körperrepräsentation und Verunsicherung
- 4.5 Bulimie auf dem Weg zur anerkannten Kulturtechnik?
- 5. Bulimie als Spiegel individualisierter Gesellschaften?
- 5.1 ,Kulturimperialismus' und ,Selbstregierung'
- 5.2 Ausblick: Wider Privatisierung und Individualisierung: Prävention und Kollektivität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziokulturellen Bedingungen, die zur Entstehung und Verbreitung von Bulimie beitragen. Sie hinterfragt die gängige individualpsychologische Sichtweise und beleuchtet, inwieweit bulimisches Verhalten ein Bestandteil unserer alltäglichen Normalität sein könnte. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Pathologisierung und Individualisierung von Bulimie.
- Soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Bulimie
- Der Einfluss von Schlankheits- und Schönheitsnormen
- Kritik an der Pathologisierung und Individualisierung von Bulimie
- Die Konstruktion weiblicher Identität im Kontext von Ernährung und Körper
- Bulimie als Spiegel individualisierter Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bulimie ein und beschreibt die zunehmende Verbreitung dieser Essstörung in westlichen Industrienationen. Sie kritisiert die gängige Darstellung von Bulimie in Medien und Fachliteratur, welche das Phänomen oft auf individuelle Defizite reduziert. Die Arbeit stellt die Frage nach den soziokulturellen Faktoren, die zur Entstehung und Zunahme von Bulimie beitragen, und kündigt eine systematische Untersuchung dieser Faktoren an. Die Individualisierung und Pathologisierung von Bulimie werden als unzureichende Erklärungsmuster kritisiert, da sie das weitverbreitete, "normal gestörte" Essverhalten von Frauen ausblenden.
2. Bulimie - Annäherung an ein Phänomen aus kulturwissenschaftlicher Perspektive: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten der Klassifizierung von Bulimie. Es hinterfragt die Grenzen der bisherigen Betrachtungsweisen und beleuchtet das Problem der Abgrenzung zwischen "normalem" und "kranken" Essverhalten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer erweiterten Perspektive, die soziokulturelle Faktoren systematisch miteinbezieht und die Konjunktur des Phänomens im gesellschaftlichen Kontext untersucht. Die Besonderheiten von Bulimie aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive werden hervorgehoben.
3. Ernährung, Körperdisziplinierung und die Konstruktion weiblicher Identität: Dieses Kapitel untersucht die soziokulturellen Aspekte von Ernährung und der Disziplinierung des Körpers, insbesondere im Kontext der weiblichen Identität. Es analysiert, wie Essverhalten und Körperbild durch gesellschaftliche Normen geprägt werden. Die Kapitel behandelt die Entwicklung von der Fremd- zur Selbstkontrolle des Appetits sowie die Rolle von Diäten und anderen Körperformungstechniken in der Konstruktion von Weiblichkeit. Der Einfluss von gesellschaftlichen Schönheitsidealen auf das Körperbild wird kritisch beleuchtet.
4. Körper(leit)bilder und Normalisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Übergewicht und der Bedeutung des Körpers im sozialen Kontext. Es untersucht, wie Körperbilder konstruiert und normalisiert werden, und die Rolle von Schönheitsidealen in der Entstehung von Unsicherheit und dem Druck zur Konformität. Der Zusammenhang zwischen Schlankheitsidealen und weiblicher Schönheit wird analysiert und die Frage aufgeworfen, inwieweit Bulimie als anerkannte Kulturtechnik betrachtet werden kann.
5. Bulimie als Spiegel individualisierter Gesellschaften?: Dieses Kapitel untersucht Bulimie im Kontext von Individualisierung und Kulturimperialismus. Es analysiert die Rolle von Selbstregierung und die Frage, wie gesellschaftliche Strukturen die Verbreitung von Bulimie begünstigen. Der Ausblick des Kapitels beschäftigt sich mit Strategien zur Prävention und der Bedeutung von kollektiven Ansätzen zur Bewältigung der Thematik.
Schlüsselwörter
Bulimie, Essstörung, Soziokultur, Körperbild, Weiblichkeit, Schlankheitsideal, Individualisierung, Pathologisierung, Normalisierung, Kulturtechnik, Selbstregierung, Prävention, Kollektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziokulturelle Aspekte von Bulimie
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die soziokulturellen Bedingungen, die zur Entstehung und Verbreitung von Bulimie beitragen. Sie geht über die individualpsychologische Sichtweise hinaus und beleuchtet, inwieweit bulimisches Verhalten ein Bestandteil unserer alltäglichen Normalität sein könnte. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Pathologisierung und Individualisierung von Bulimie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Bulimie, den Einfluss von Schlankheits- und Schönheitsnormen, die Kritik an der Pathologisierung und Individualisierung von Bulimie, die Konstruktion weiblicher Identität im Kontext von Ernährung und Körper sowie Bulimie als Spiegel individualisierter Gesellschaften.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Bulimie aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, Ernährung, Körperdisziplinierung und die Konstruktion weiblicher Identität, Körper(leit)bilder und Normalisierung, sowie Bulimie als Spiegel individualisierter Gesellschaften. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die zunehmende Verbreitung von Bulimie und kritisiert die gängige Darstellung in Medien und Fachliteratur. Sie stellt die Frage nach den soziokulturellen Faktoren und kündigt eine systematische Untersuchung dieser an. Die Individualisierung und Pathologisierung von Bulimie werden als unzureichende Erklärungsmuster kritisiert.
Wie wird Bulimie aus kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet?
Kapitel 2 analysiert die Schwierigkeiten der Klassifizierung von Bulimie und hinterfragt die Grenzen bisheriger Betrachtungsweisen. Es beleuchtet die Abgrenzung zwischen "normalem" und "kranken" Essverhalten und entwickelt eine erweiterte Perspektive, die soziokulturelle Faktoren miteinbezieht und die Konjunktur des Phänomens im gesellschaftlichen Kontext untersucht.
Welche Rolle spielen Ernährung, Körperdisziplinierung und weibliche Identität?
Kapitel 3 untersucht die soziokulturellen Aspekte von Ernährung und Körperdisziplinierung im Kontext der weiblichen Identität. Es analysiert, wie Essverhalten und Körperbild durch gesellschaftliche Normen geprägt werden, die Entwicklung von der Fremd- zur Selbstkontrolle des Appetits und die Rolle von Diäten und anderen Körperformungstechniken in der Konstruktion von Weiblichkeit.
Wie werden Körperbilder und Normalisierung behandelt?
Kapitel 4 befasst sich mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Übergewicht und der Bedeutung des Körpers im sozialen Kontext. Es untersucht die Konstruktion und Normalisierung von Körperbildern, die Rolle von Schönheitsidealen und den Zusammenhang zwischen Schlankheitsidealen und weiblicher Schönheit. Die Frage, inwieweit Bulimie als anerkannte Kulturtechnik betrachtet werden kann, wird gestellt.
Wie wird Bulimie im Kontext individualisierter Gesellschaften gesehen?
Kapitel 5 untersucht Bulimie im Kontext von Individualisierung und Kulturimperialismus. Es analysiert die Rolle von Selbstregierung und die Frage, wie gesellschaftliche Strukturen die Verbreitung von Bulimie begünstigen. Der Ausblick beschäftigt sich mit Strategien zur Prävention und der Bedeutung von kollektiven Ansätzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Bulimie, Essstörung, Soziokultur, Körperbild, Weiblichkeit, Schlankheitsideal, Individualisierung, Pathologisierung, Normalisierung, Kulturtechnik, Selbstregierung, Prävention und Kollektivität.
- Quote paper
- Katharina Maas (Author), 2003, "Am Anfang war’s die ideale Lösung" – Bulimie als kultureller Spiegel individualisierter Gesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71712