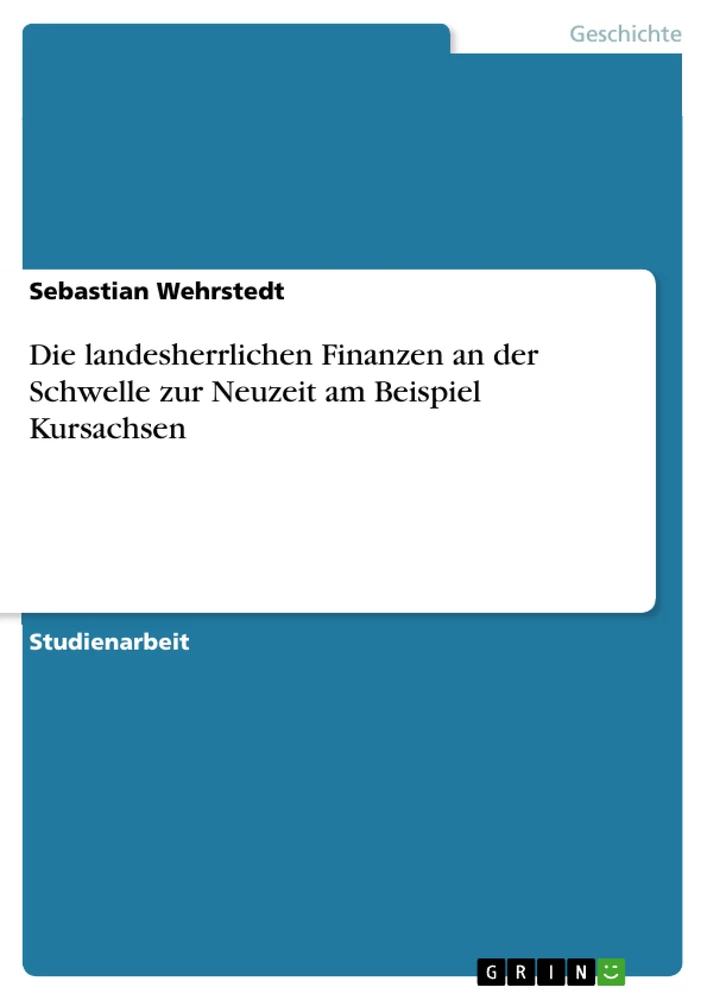In den letzten Jahren hat sich die Geschichtsforschung in verstärktem Maße vom Bild des “dunklen” Mittelalters abgewandt. Es ist dem allgemeinen Trend zu verdanken, dass auch die Entwicklungen des 15. Jahrhunderts eine differenzierte Betrachtung erfahren hat. Die Schwelle zur Neuzeit war eine Zeit der technologischen Innovationen und staatspolitischen Zäsuren, wie etwa dem Wormser Reichstag von 1495 mit der Festlegung des ewigen Landfriedens und der Forderung nach einer Reichssteuer, aber auch außenpolitischem Druck wie z.B. den Hussitenkriegen oder der Türkengefahr. Erst diese politischen Probleme erzwangen Einigkeit im “alten” Reich, dementsprechend sorgte die absolute Geldknappheit zumindest auf der kleinstaatlichen Ebene für eine Verbesserung des Steuersystems, diese ging Hand in Hand mit der Herausbildung frühmoderner Territorialstaatlichkeit 1 , d.h. der Entwicklung vom mittelalterlichen Lehensstaat zum frühneuzeitlichen Ständestaat. So sind viele Forscher dazu übergegangen diese Zeit als Phase des “Frühkapitalismus” zu bezeichnen. Dies erklärt z.B. Boockmann indem er aufzeigt dass, die Gesellschaft der Fugger im 15. Jahrhundert wohl mehr mit einer heutigen Großbank gemeinsam hatte, als mit den Runtingern des frühen Mittelalters. Europäische Fürsten um 1500 waren ständig auf der Suche nach Einkommensquellen und bemüht die Verwaltung und das Finanzwesen zu zentralisieren, den Zugriff auf Land und Leute zu erweitern. Erst aus dieser ökonomischen Notwendigkeit (“necessitas in actu“) heraus, entstanden allmählich Institutionen 2 . Auch das Verhältnis zwischen Albrecht und dem Kaiser wird uns später noch beschäftigen. Während weitgreifende Entwicklungen sich in den meisten Nachbarländern auf nationalstaatlicher Ebene abspielten, geschah dies im “alten” Reich auf territorialstaatlicher Ebene und wurde durch die verschiedenen Landesherren auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt. Es ist jedoch festzuhalten, dass nicht der Staat sondern der Unterhalt des Fürsten der Gegenstand spätmittelalterlicher “Finanzpolitik” ist. 3 Am Beispiel Sachsens lässt sich dieser europaweite Trend auf sehr gute Art und Weise nachvollziehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Einnahmequellen Albrechts (1488/89-1496)
- 2.1 Einnahmen durch Steuern
- 2.2. Der Silberbergbau im Erzgebirge
- 3. Ausgaben des Fürstentums
- 3.1 Struktur
- 3.2 Albrechts politisches Engagement und dessen (finanzielle) Folgen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die landesherrlichen Finanzen in Kursachsen an der Schwelle zur Neuzeit, am Beispiel des Herzogs Albrecht (1488/89-1496). Die Arbeit zeigt die Entwicklung des Steuersystems im späten Mittelalter und die Herausbildung frühmoderner Territorialstaatlichkeit auf.
- Einnahmequellen des Kurfürstentums
- Bedeutung des Silberbergbaus im Erzgebirge
- Struktur und Verwaltung des Fürstlichen Haushalts
- Politisches Engagement Albrechts und dessen finanzielle Folgen
- Entwicklung des frühneuzeitlichen Staates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die historische Entwicklung des späten Mittelalters, die Herausforderungen der Zeit und die Entwicklung frühmoderner Territorialstaatlichkeit. Kapitel 2 befasst sich mit den Einnahmequellen Albrechts, insbesondere mit Steuern und dem Silberbergbau im Erzgebirge. Kapitel 3 beleuchtet die Ausgaben des Fürstentums, einschließlich der Struktur und den Auswirkungen von Albrechts politischem Engagement.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: landesherrliche Finanzen, Kursachsen, Albrecht der Beherzte, Silberbergbau, Erzgebirge, Steuerwesen, Territorialstaatlichkeit, Frühkapitalismus, Frühneuzeit, Steuersystem, Lehensstaat, Ständestaat.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte der Silberbergbau für Kursachsen um 1500?
Der Silberbergbau im Erzgebirge war eine der wichtigsten Einnahmequellen für Herzog Albrecht und ermöglichte die Finanzierung seiner politischen Ambitionen.
Was versteht man unter „frühmoderner Territorialstaatlichkeit“?
Es beschreibt den Übergang vom mittelalterlichen Lehensstaat zum Ständestaat, geprägt durch eine Zentralisierung der Verwaltung und des Finanzwesens.
Wie entwickelte sich das Steuersystem in dieser Zeit?
Aufgrund ständiger Geldknappheit und äußerer Bedrohungen (wie der Türkengefahr) wurden effizientere Steuersysteme und Reichssteuern wie der "Gemeine Pfennig" diskutiert und eingeführt.
Wer war Albrecht der Beherzte?
Albrecht war Herzog von Sachsen, dessen Regierungszeit (1488–1496) als Beispiel für die finanzielle Haushaltsführung eines spätmittelalterlichen Fürsten analysiert wird.
Was war der Hauptgegenstand der spätmittelalterlichen Finanzpolitik?
Im Gegensatz zum modernen Staatsverständnis stand primär der Unterhalt des Fürsten und seines Hofstaates im Mittelpunkt der Finanzpolitik.
- Citar trabajo
- Sebastian Wehrstedt (Autor), 2005, Die landesherrlichen Finanzen an der Schwelle zur Neuzeit am Beispiel Kursachsen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71765