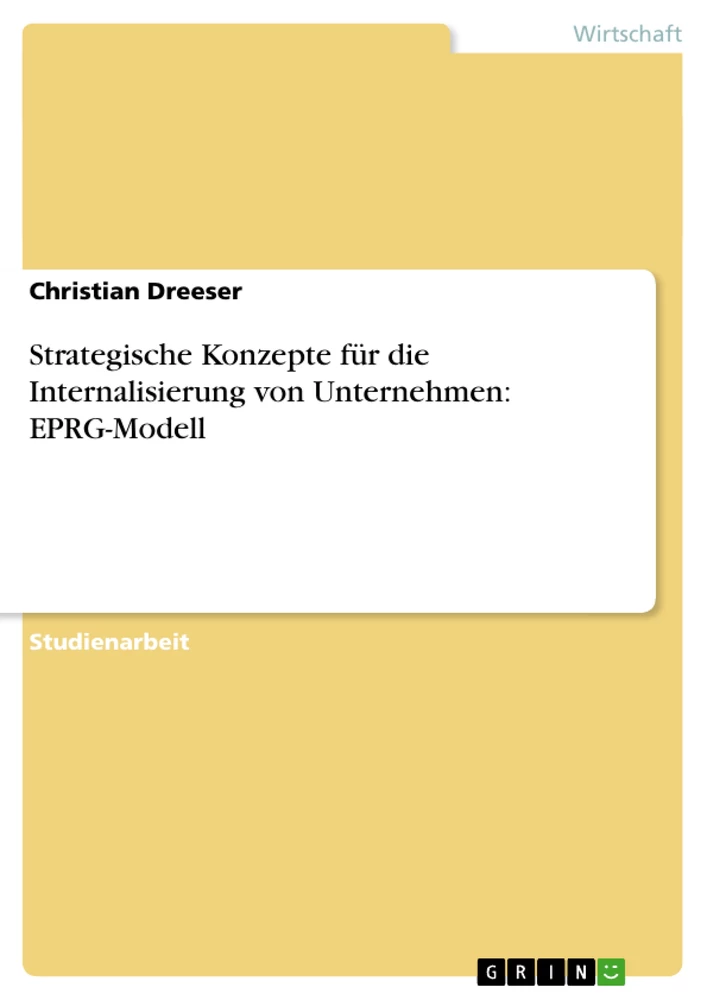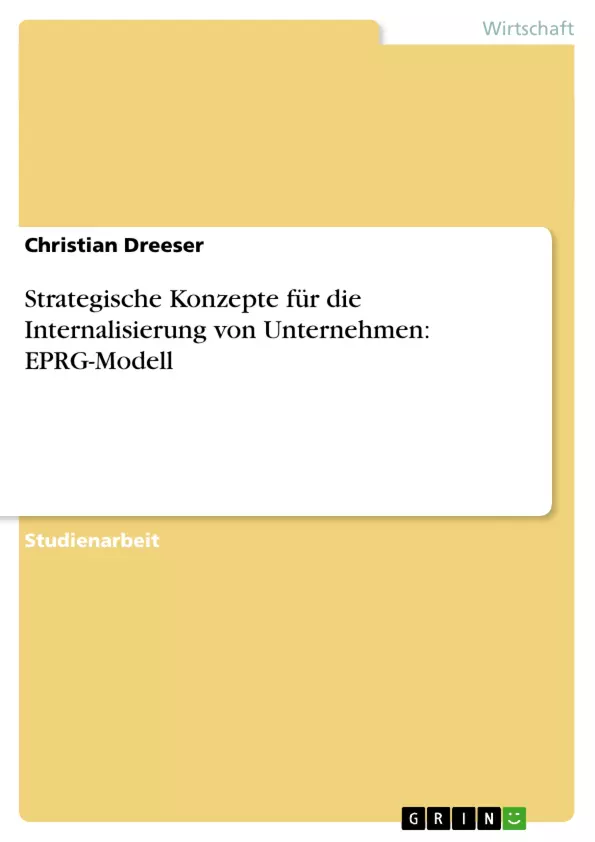In der heutigen Zeit sind Unternehmen gezwungen sich international auszurichten. Steigender Wettbewerbsdruck, zunehmend national gesättigte Märkte, das verstärkte Aufkommen neuer Wettbewerbsländer aus Schwellenländern sowie die verstärke Betrachtung von Prozessen hinsichtlich der Transaktionskosten forcieren die länderübergreifende Denk- und Handlungsweise bei den Unternehmen.
Damit ein Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen kann, ist es wichtig, frühzeitig konkrete Internationalisierungsstrategien zu entwickeln. Vor der Erstellung solcher Strategien (bspw. Markteintrittsstrategien) ist es für ein Unternehmen zwingend notwendig sich strategisch zu orientieren. Eine richtungsweisende strategische Orientierung wird vor allem durch die Einstellung des Top-Managements gegenüber Auslandsaktivitäten geprägt und beeinflusst alle Bereiche der Unternehmung. Perlmutter unterscheidet in seinem EPRG-Modell zwischen einer ethno-, regio-, poly- und geozentrischen Orientierung der Unternehmen. Mit dem EPRG Modell, welches in dieser Arbeit eingehend thematisiert wird, liefert er ein bedeutendes Konzept für international agierende Unternehmen. Maßgröße für den Grad der Internationalisierung ist nicht eine eindimensionale Größe (z.B. die Filialenanzahl), sondern die Orientierung zu fremden Menschen, Ideen und Ressourcen.
In der vorliegenden Publikation wird zunächst der Begriff Internationalisierung erläutert und deren Vor-, Nachteile und Formen aufgezeigt. Im Anschluss wird das EPRG Modell in seiner Struktur vorgestellt und im Folgenden werden die einzelnen Strategien detailiert beschrieben. Auf Basis dieser Informationen erfolgt eine Differenzierung des Konzeptes anhand der wichtigsten Unterscheidungskriterien um darauf aufbauend die Vor- und Nachteile der einzelnen Phasen darzustellen. Im sechsten Kapitel erfolgt eine übergreifende Beurteilung des EPRG Modells und im siebten Kapitel wird der Ansatz von Perlmutter kritisch gewürdigt. Eine Zusammenfassung rundet die Publikation schließlich ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Internationalisierung.
- 3. EPRG-Konzept
- 3.1 Ethnozentrische Orientierung
- 3.2 Polyzentrische Orientierung
- 3.3 Regiozentrische Orientierung
- 3.4 Geozentrische Orientierung.
- 4. Differenzierung des Konzeptes.
- 5. Vor- und Nachteile der Strategien
- 6. Beurteilung des EPRG-Modells
- 7. Kritik am EPRG – Modell
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem EPRG-Modell, einem wichtigen Konzept für international agierende Unternehmen. Das Ziel ist es, das Modell zu analysieren und seine verschiedenen strategischen Orientierungen zu erläutern. Die Arbeit beleuchtet die Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien und diskutiert kritisch die Anwendbarkeit des Modells in der Praxis.
- Internationalisierungsstrategien von Unternehmen
- Das EPRG-Modell und seine vier Orientierungen (ethnozentrisch, polyzentrisch, regiozentrisch, geozentrisch)
- Vorteile und Nachteile der verschiedenen EPRG-Strategien
- Kritik am EPRG-Modell
- Relevanz des EPRG-Modells für die strategische Ausrichtung von Unternehmen in der globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Internationalisierung von Unternehmen ein und erklärt die Bedeutung strategischer Orientierung für Unternehmen im globalen Wettbewerb. Das EPRG-Modell wird als zentrales Konzept vorgestellt.
- Kapitel 2: Internationalisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Internationalisierung und erläutert die Ursachen und Ziele der Internationalisierung von Unternehmen. Es werden verschiedene Formen der Internationalisierung und deren Vor- und Nachteile dargestellt.
- Kapitel 3: EPRG-Konzept: Das Kapitel beschreibt das EPRG-Modell und seine vier Orientierungen: ethnozentrisch, polyzentrisch, regiozentrisch und geozentrisch. Es erläutert die charakteristischen Merkmale und Besonderheiten jeder Orientierung.
- Kapitel 4: Differenzierung des Konzeptes: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Unterscheidungskriterien des EPRG-Modells und zeigt die spezifischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Strategien auf.
- Kapitel 5: Vor- und Nachteile der Strategien: Hier werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen EPRG-Strategien detailliert dargestellt.
- Kapitel 6: Beurteilung des EPRG-Modells: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Beurteilung des EPRG-Modells und bewertet seine Anwendbarkeit und Relevanz in der Praxis.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Hausarbeit sind: Internationalisierung, EPRG-Modell, strategische Orientierung, ethnozentrische Orientierung, polyzentrische Orientierung, regiozentrische Orientierung, geozentrische Orientierung, Vor- und Nachteile, Kritik, globaler Wettbewerb, Unternehmensausrichtung, Internationalisierungsstrategien.
- Arbeit zitieren
- Christian Dreeser (Autor:in), 2007, Strategische Konzepte für die Internalisierung von Unternehmen: EPRG-Modell, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71936