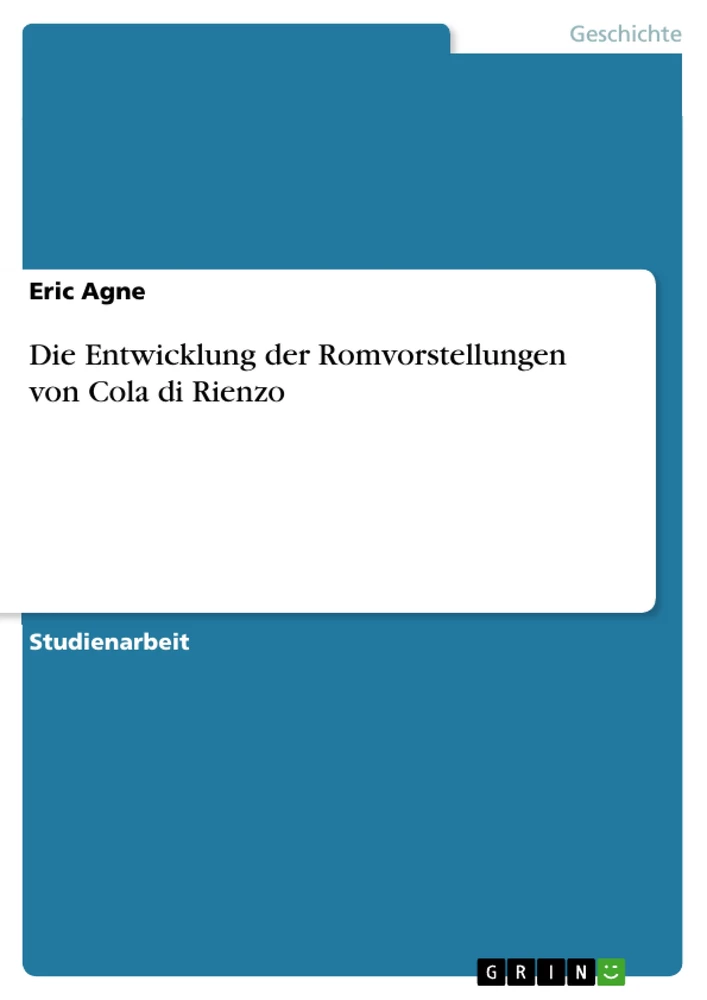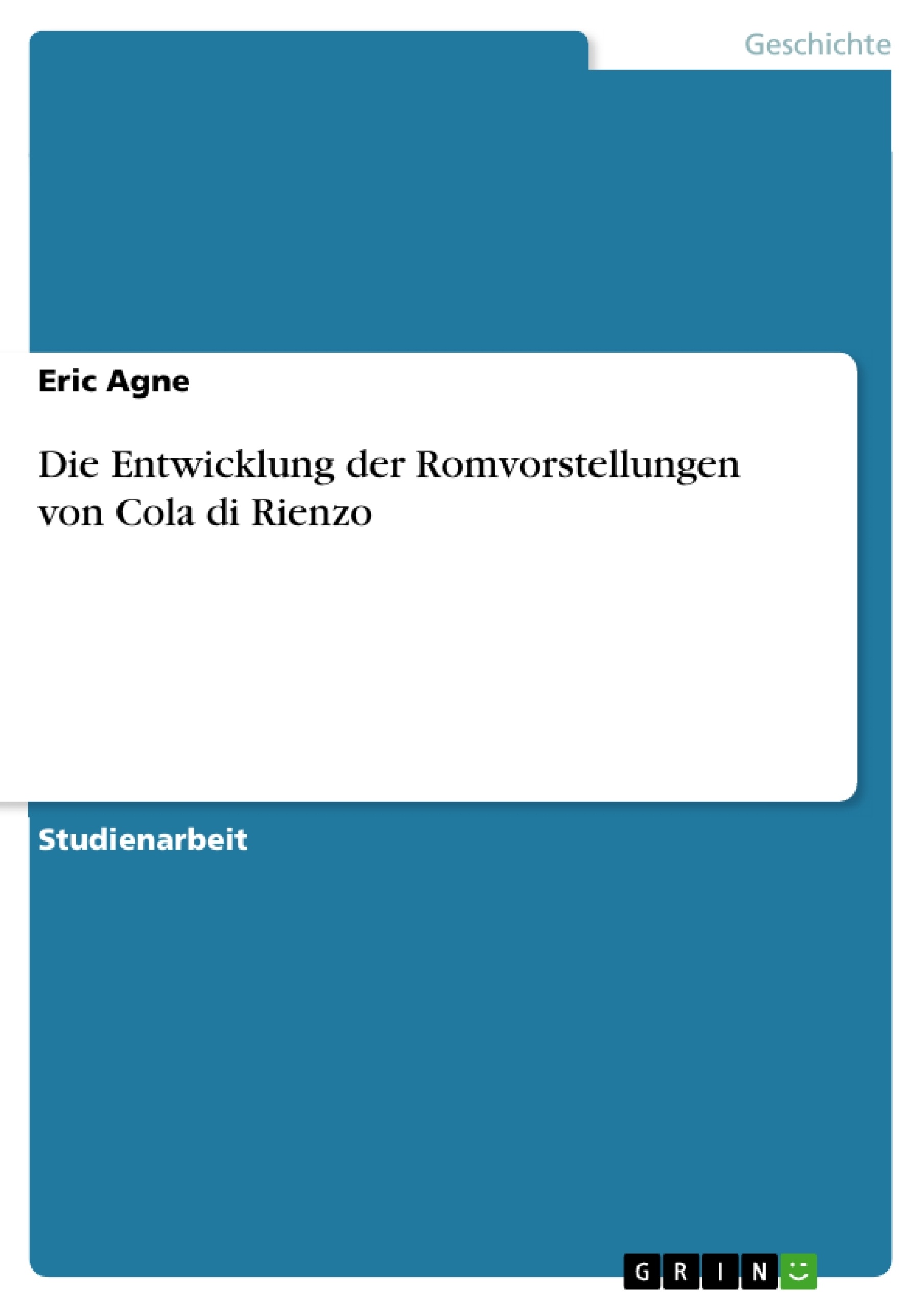Gerade zu einer Zeit , als die einstige Millionenstadt Rom auf eine in jeglicher Beziehung,
politisch , wirtschaftlich wie kulturell unbedeutende Stadt herabgesunken war1,verlieh Cola di
Rienzo in seinem Manifest, welches an die ganze Welt gerichtet war, der Verherrlichung
Roms den maßlosesten Ausdruck. Die Päpste hatten Rom den Rücken gekehrt und zogen
Südfrankreich Rom als Residenz vor doch unbeirrt hielt Cola di Rienzo an Rom als
Mittelpunkt der Welt fest. Eine solche Vorstellung wurde im Laufe der Jahrhunderte stets
aufrechterhalten, so das sich auch andere Städte wie Moskau mit dem Namen „drittes Rom“
brüsteten. Das Ende der Antike war keineswegs das Ende solcher Vorstellungen. Denn den
Zusammenbruch der antiken Staatenwelt überlebten die Werke der großen Autoren dieser Zeit
und damit auch deren Romgedanken. Diese waren jedoch in einen völlig anderen geistig
kulturellen Umkreis gestellt:2
„aus der Kaiserstadt ist die Papststadt Rom geworden, Mittelpunkt einer Kirche , die den
gleichen Anspruch auf Universalität stellt wie das römische Kaiserreich.“
Die im Mittelalter gebrauchten Begriffe „caput mundi“ und „caput orbis“ zur Bezeichnung
Roms, bezeichnen nicht mehr das aus der Antike bekannte, straff organisierte Weltreich,
sondern „größtenteils eben Ansprüche einer der drei Parteien in diesem Dreieck Papst/
Bischof – Kaiser – Stadtrömer den beiden anderen Parteien gegenüber.3
==
1 Juhar, Monika –Beate: Der Romgedanke bei Cola di Rienzo. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des
Fachbereichs Philosophie der Christian – Albrechts – Universität zu Kiel. Kiel 1977, S. I (Einleitung)
2 Vgl. Juhar, S. II (Einleitung)
3 Juhar, S. III (Einleitung)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Figur des Cola di Rienzo in Literatur und Musik
- Biographie bis 1347
- Rienzos Romvorstellungen in Avignon 1343/44
- Rienzos Romvorstellungen von 1344 – 1347
- Rienzos Tribunat 1347
- Vorgeschichte
- Rienzo und Francesco Petrarca
- Die Romvorstellungen während des Tribunats
- Der sanctus status
- Der Papst
- Der Kaiser
- der Zusammenhalt der römischen Städte
- Fazit zu den Romvorstellungen während des Tribunats
- Die böhmische Gefangenschaft
- Eine Veränderung in der Kaiserfrage
- Veränderung der Kirche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Cola di Rienzos Romvorstellungen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten (1347 und 1350-52) und untersucht, ob sich diese in diesem Zeitraum grundlegend verändert haben. Dabei wird die Sekundärliteratur weitgehend ausgeklammert und der Fokus auf die zahlreichen Briefwechsel von Cola di Rienzo gelegt, um seine Positionen transparent darzustellen.
- Entwicklung von Cola di Rienzos Romvorstellungen
- Vergleich seiner Romvorstellungen in unterschiedlichen Phasen seines Lebens
- Analyse der Romgedanken di Rienzos anhand seiner Briefe
- Bedeutung des römischen Mittelalters für di Rienzos Visionen
- Einfluss von Personen wie Francesco Petrarca auf di Rienzos Romvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Cola di Rienzos Romgedanken in den historischen Kontext des spätmittelalterlichen Roms. Sie beleuchtet den Niedergang der Stadt und die Rolle der Päpste in Avignon. Sie stellt auch die Kontinuität des „Romgedankens“ im Mittelalter fest und betont die Besonderheit von di Rienzos Vorstellungen innerhalb dieser Tradition.
- Die Figur des Cola di Rienzo in Literatur und Musik: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Figur des Cola di Rienzo auf die Literatur und Musik des 19. Jahrhunderts. Es nennt verschiedene literarische und musikalische Werke, die sich mit ihm auseinandersetzen, und stellt die Ambivalenz der Interpretationen (Bewunderung oder Ablehnung) heraus.
- Biographie bis 1347: Dieses Kapitel skizziert die Jugend und die frühen Jahre von Cola di Rienzo. Es beleuchtet die Unsicherheiten über seine Herkunft und seine Bildung, und stellt den Zusammenhang zwischen seinem Interesse an Politik und dem Gerücht über seine Abstammung von Heinrich VIII. dar.
- Rienzos Romvorstellungen in Avignon 1343/44: Dieses Kapitel beschreibt di Rienzos Reise nach Avignon und seinen Kontakt mit Francesco Petrarca. Es skizziert die politische Situation in Rom und di Rienzos Anliegen, die Beschwerden des römischen Volkes vorzutragen.
- Rienzos Romvorstellungen von 1344 – 1347: Dieses Kapitel befasst sich mit di Rienzos Rückkehr nach Rom und seiner Position als Notar. Es beleuchtet seine Rolle in der Stadt und die Entwicklung seiner Romvorstellungen in dieser Phase.
- Rienzos Tribunat 1347: Dieses Kapitel schildert di Rienzos Aufstieg zum Volkstribun im Jahr 1347. Es befasst sich mit der Vorgeschichte seines Tribunats, seiner Beziehung zu Francesco Petrarca und seinen Romvorstellungen während dieser Zeit. Es analysiert die verschiedenen Aspekte seiner Vision, wie der „sanctus status“, die Rolle des Papstes und des Kaisers, sowie die Einheit der römischen Städte.
- Die böhmische Gefangenschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit di Rienzos Gefangennahme in Böhmen und den Veränderungen, die sich während dieser Zeit in Bezug auf die Kaiserfrage und die Rolle der Kirche vollzogen haben.
Schlüsselwörter
Cola di Rienzo, Romvorstellungen, Spätmittelalter, Romgedanke, „caput mundi“, „caput orbis“, Papsttum, Kaiser, Francesco Petrarca, sanctus status, Tribunat, römische Städte, böhmische Gefangenschaft, Briefwechsel.
- Citation du texte
- Eric Agne (Auteur), 2006, Die Entwicklung der Romvorstellungen von Cola di Rienzo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71938