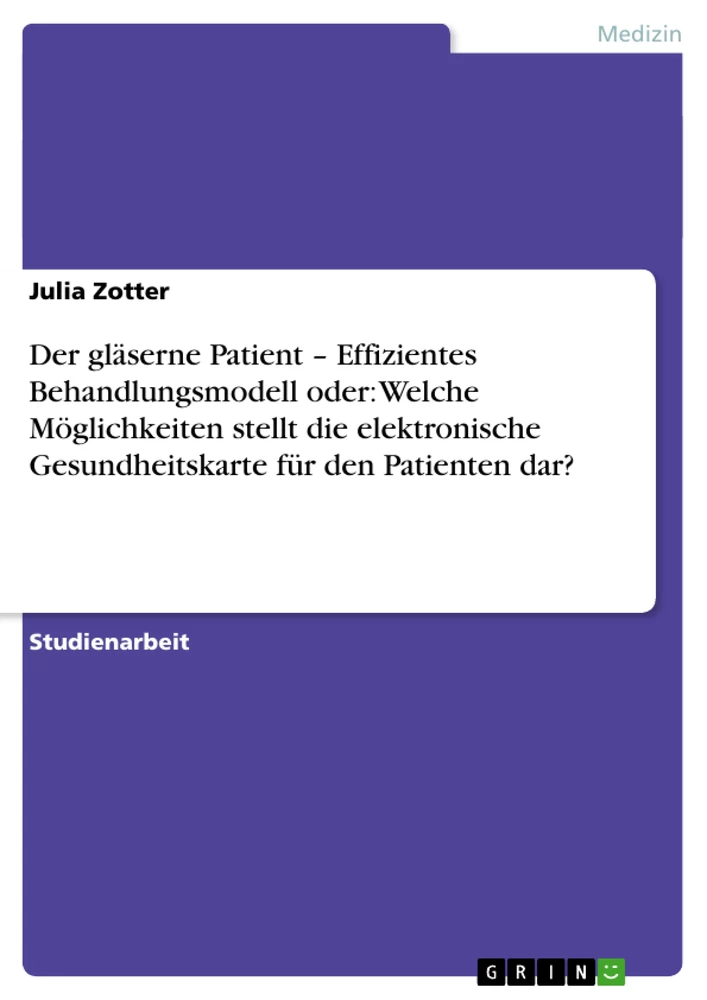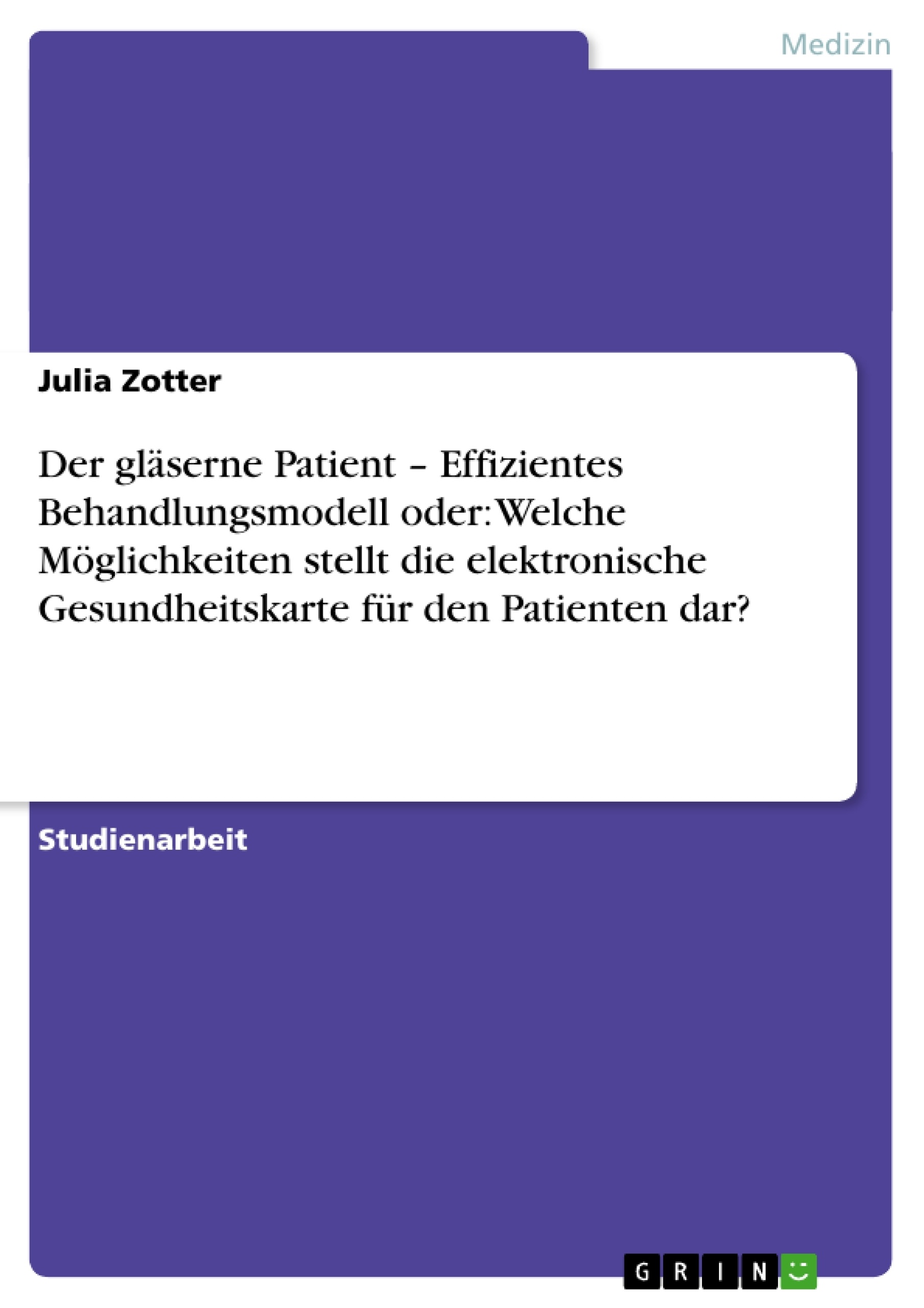Durch eine Vernetzung aller an der Gesundheitsversorgung in Deutschland Beteiligten und der Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte - als Ersatz für die bisherige Versichertenkarte - ist eine Verbesserung von Prozessabläufen möglich, die zu höherer Qualität und Effizienz im Gesundheitssystem führen kann. Die dazu erforderlichen Kommunikations- und Informationstechnologien sind heute verfügbar. Neben den automatisch ablaufenden Datenströmen, wie Abrechnungsdaten für die KVen, Abzweigung von pseudonymisierten und anonymisierten Daten für Statistiken und Patienteninformationssysteme wird es einen sehr sensiblen Bereich geben, der dem Selbstbestimmungsrecht des Patientens unterliegt, dessen „Herr der Daten“ nur der Patient sein kann und er folglich die Schlüsselgewalt darüber haben muss. Jeder Leistungserbringer wird weiterhin eigene Ordner über den Patienten verwalten, es sprechen aber gewichtige Argumente dafür, dass der Patient Mitbesitzer oder sogar Eigentümer seiner medizinischen Daten sein muss, wenn sie in den elektronischen Datenpool eingestellt werden. Die Entwicklung einer elektronischen Gesundheitskarte darf gesetzliche und zugesagte Patientenrechte nicht unberücksichtigt lassen; die Mitwirkungsbereitschaft von Patienten erhöht sich und eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungstransparenz wird erreicht. Datenschützer appellieren eindringlich an die Datenhoheit der Patienten, denn sie sollen entscheiden, welche Daten gelöscht und welche Daten welchem Leistungserbringer zugänglich gemacht werden. Die Verwendung der Patientendaten soll nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens und des bestehenden Schutzniveaus erlaubt werden. In Zukunft haben Patienten jederzeit selbst die Möglichkeit, Daten auf der Karte einzusehen und bekommen somit einen Überblick über erbrachte Leistungen und entstandene Kosten. Der sichere Zugang erfolgt über die Gesundheitskarte des Patientens zusammen mit der „Health Professional Card“ des Arztes oder anderer Leistungserbringer, für die jeweils unterschiedliche Zugangsberechtigungen zu Patientendaten gelten. Patient und Arzt müssen sich dabei authentifizieren, bspw. über biometrische Merkmale. Die Gesundheitskarte soll neben den Daten zur Identifizierung und Authentifizierung des Patientens nur eine Verweisfunktion auf die zukünftige elektronische Patientenakte sowie einen Notfalldatensatz enthalten. Durch diese Transparenz im Gesundheitswesen wird dem Patienten die Mündigkeit zugesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Executive Summary
- Einleitung
- Hauptteil
- Situation im Gesundheitswesen
- Informationsdefizit als Kernproblem im Gesundheitswesen
- Transparenz durch Vernetzung
- Rahmenbedingungen der eGK
- Card Enabled Network
- Konzept: Kartenmodell
- Datenschutz und „,digital divide❝
- Der Mensch im Mittelpunkt
- Sicherstellung informationeller Selbstbestimmung der Patienten
- Datenschutzrechtliche Grundsätze
- Weitergabe von Daten
- Datenschutzfreundliche Techniken
- Datenübertragung
- Durchblick statt Einblick
- Anforderungen an medizinische Daten
- Arzneimitteldokumentation
- Notfallrelevante Informationen aus Patientenpässen
- Die eGK - ein Schlüsselprojekt für das Gesundheitswesen?
- Messung des Nutzens einer eGK
- Abschlussteil
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in Deutschland und der EU. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser technologischen Innovation auf das Gesundheitswesen zu analysieren, insbesondere hinsichtlich der Effizienzsteigerung und der Auswirkungen auf den Datenschutz.
- Die eGK als Instrument zur Verbesserung von Prozessen und Effizienz im Gesundheitswesen
- Die Rolle der eGK bei der Vernetzung aller am Gesundheitswesen Beteiligten
- Die Bedeutung des Datenschutzes im Kontext der eGK und die Herausforderung, die informationelle Selbstbestimmung des Patienten zu gewährleisten
- Die Vorteile der eGK für Patienten in Bezug auf Transparenz und Zugang zu eigenen Gesundheitsdaten
- Die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Nutzung der eGK, um die „gläsernen Patienten“ zu vermeiden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der eGK für das Gesundheitswesen hervorhebt. Es wird die Notwendigkeit einer effizienten und gleichzeitig datenschutzsicheren Lösung betont, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Im Hauptteil werden die verschiedenen Aspekte der eGK genauer beleuchtet, angefangen von der aktuellen Situation im Gesundheitswesen mit den Herausforderungen des Informationsdefizits und dem Potenzial der Vernetzung. Die Rahmenbedingungen der eGK werden vorgestellt, sowie das Konzept der Kartenmodellierung und die damit verbundenen Datenschutz- und Datensicherheitsaspekte.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Sicherstellung der informationellen Selbstbestimmung des Patienten und den Anforderungen an die medizinische Datenverarbeitung. Die eGK wird als ein Schlüsselprojekt für das Gesundheitswesen betrachtet, wobei die Messung des Nutzens und die Vorteile der eGK für Patienten hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), dem Gesundheitswesen, dem Datenschutz, der Datensicherheit, der informationellen Selbstbestimmung des Patienten und der Vernetzung im Gesundheitswesen.
Häufig gestellte Fragen zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK)
Welchen Nutzen bietet die eGK für Patienten?
Die eGK verbessert die Transparenz, ermöglicht den schnellen Zugriff auf Notfalldaten und vermeidet Doppeluntersuchungen durch eine bessere Vernetzung der Ärzte.
Wer ist der "Herr der Daten" bei der Gesundheitskarte?
Der Patient hat die Datenhoheit. Er entscheidet selbst, welche Daten gespeichert, gelöscht oder welchem Arzt zugänglich gemacht werden.
Wie wird der Datenschutz bei der eGK gesichert?
Durch Verschlüsselung, Authentifizierung mittels PIN und die Notwendigkeit, dass auch der Arzt sich mit einem Heilberufsausweis (HPC) legitimieren muss.
Was versteht man unter dem "gläsernen Patienten"?
Kritiker befürchten, dass durch die zentrale Speicherung sensibler medizinischer Daten der Patient vollständig durchleuchtbar wird, was Missbrauchspotenzial birgt.
Enthält die Karte selbst alle medizinischen Akten?
Nein, die Karte dient primär als Schlüssel und Verweisfunktion auf gesicherte Server, auf denen die elektronische Patientenakte (ePA) liegt.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Betriebswirtin (FH) Julia Zotter (Autor:in), 2005, Der gläserne Patient – Effizientes Behandlungsmodell oder: Welche Möglichkeiten stellt die elektronische Gesundheitskarte für den Patienten dar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72221