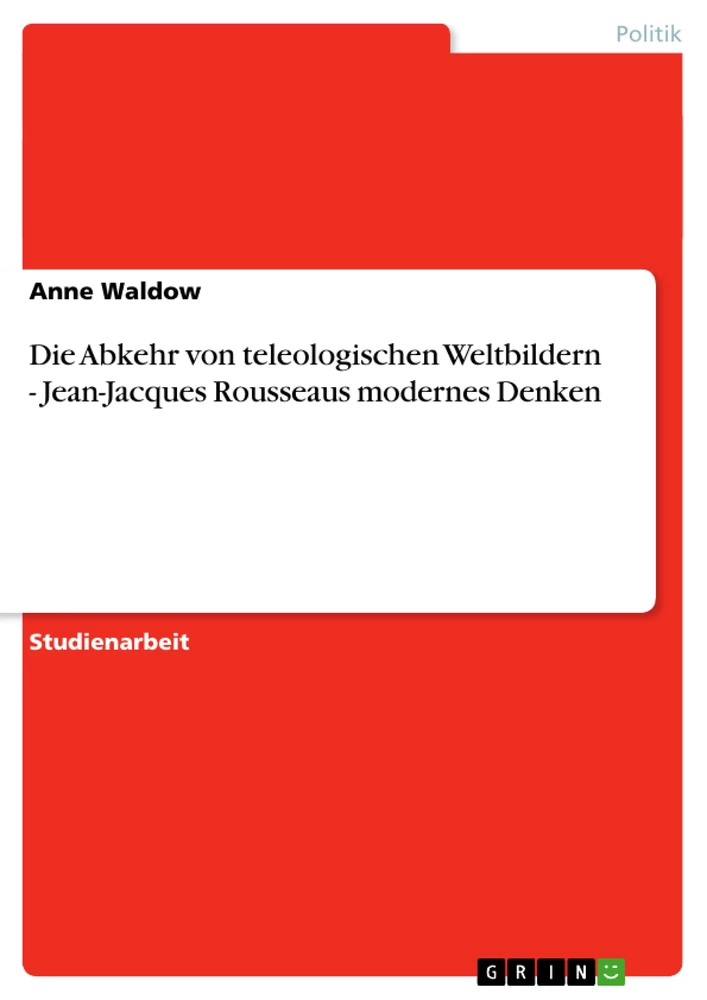Die Vorstellung, dass menschliche Handlungen und natürliche Prozesse aus einem Ziel oder einem Zweck heraus bestimmt sind, hat in der Philosophie eine lange Geschichte. Sie beginnt in einfachsten Formen in der Antike, genauer mit der Literatur HOMERs, in der aus der Darstellung einer polytheistischen Götterwelt menschliche Organisationsformen wie z.B. die Familie abgeleitet werden. Sophisten sehen den Menschen dann als ein Wesen, das sich gegenüber Tieren nur behaupten kann, weil es von den Göttern bestimmte Fähigkeiten geschenkt bekommen hat. Dieser Gedanke wird von SOKRATES (470-399 v. Chr.) aufgegriffen, wobei er den Göttern eine Sorge um den Menschen zuspricht, die ihm hilft, sich zu perfektionieren. Zur klassischen Teleologie schließlich kann ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) gezählt werden. Seine Schriften prägten die philosophischen Wissenschaften über Jahrtausende hinweg und werden auch heute noch rezipiert. Dessen ungeachtet, gab erst Christian WOLFF (1679-1754) der Lehre von der Zielgerichtetheit menschlichen Handelns den Namen »Teleologie«. Noch in demselben Jahrhundert kamen kritische Stimmen auf, die dieses Gedankengut vehement abwehrten. Zu den bedeutendsten dieser Philosophen zählt Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Anthropologie entwarf, die im Gegensatz zu der ARISTOTELES´ und WOLFFs steht. Welche Argumente und Begriffe der ROUSSEAU´schen Lehre darauf aufmerksam machen, soll in der vorliegenden Hausarbeit geklärt werden, die im Rahmen eines Seminars über die Anthropologie und Staatstheorie Jean-Jacques ROUSSEAUs entstand. Dieses Ziel macht zunächst eine Betrachtung teleologischer Weltbilder in der politischen Ideengeschichte notwendig. ARISTOTELES und WOLFF, die dem zielgerichteten Handeln im individuellen wie politischen Bereich eine wichtige Rolle zuweisen, sollen dabei klassische Vertreter dieses Denkens darstellen. Der Fokus der Arbeit liegt darüber hinaus auf der stark modifizierten Lehre ROUSSEAUs im Zeichen der Aufklärung und deren Konsequenzen für Mensch und Staat.
Inhaltsverzeichnis
- Teleologische Weltbilder - eine Einleitung
- Teleologische Lehren in der Philosophie
- ARISTOTELES' klassische Teleologie
- Das Streben nach »Vollkommenheit« als Naturrecht - Christian WOLFF
- Die Abkehr von teleologischen Weltbildern - ROUSSEAUS neuzeitliches Denken
- Der Begriff »Perfektibilität« und dessen Herleitung aus dem Naturzustand
- Von individueller zu politischer Freiheit - Legitimation von Staatlichkeit
- Konträre Rezeptionen der Teleologie in der Neuzeit - abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Abkehr von teleologischen Weltbildern im Denken von Jean-Jacques ROUSSEAU. Im Rahmen einer Analyse der ROUSSEAU'schen Anthropologie werden die Argumente und Begriffe beleuchtet, die eine Abgrenzung zu den teleologischen Lehren von ARISTOTELES und WOLFF verdeutlichen. Die Arbeit untersucht die Rolle der Teleologie in der politischen Ideengeschichte und zeigt die Konsequenzen von ROUSSEAUS neuzeitlichem Denken für Mensch und Staat auf.
- Teleologische Weltbilder in der politischen Ideengeschichte
- Die Teleologie bei ARISTOTELES und WOLFF
- ROUSSEAUS Kritik an teleologischen Weltbildern
- Der Begriff der »Perfektibilität« bei ROUSSEAU
- Die Legitimation von Staatlichkeit bei ROUSSEAU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der teleologischen Weltbilder und zeigt deren historische Entwicklung auf. Es wird die Rolle der Teleologie in der Antike, insbesondere bei HOMER und SOKRATES, beleuchtet. ARISTOTELES wird als Vertreter der klassischen Teleologie vorgestellt, dessen Schriften die philosophischen Wissenschaften über Jahrtausende prägten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit teleologischen Lehren in der Philosophie. In Kapitel 2.1. wird die teleologische Lehre von ARISTOTELES analysiert, insbesondere die Rolle der Teleologie in seiner politischen Anthropologie. Kapitel 2.2. widmet sich Christian WOLFF und seinem Begriff der »Vollkommenheit« als Rezeption der aristotelischen Teleologie.
Das dritte Kapitel untersucht die Abkehr von teleologischen Weltbildern im Denken von Jean-Jacques ROUSSEAU. Es werden die Argumente und Begriffe der ROUSSEAU'schen Lehre beleuchtet, die im Gegensatz zu den teleologischen Lehren von ARISTOTELES und WOLFF stehen. Insbesondere wird der Begriff der »Perfektibilität« und dessen Herleitung aus dem Naturzustand erörtert. Weiterhin werden die Konsequenzen von ROUSSEAUS neuzeitlichem Denken für die Legitimation von Staatlichkeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Teleologie, politische Ideengeschichte, ARISTOTELES, WOLFF, ROUSSEAU, Perfektibilität, Naturzustand, Staatlichkeit, Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Teleologie in der Philosophie?
Teleologie ist die Lehre von der Zielgerichtetheit. Sie besagt, dass Handlungen und natürliche Prozesse auf einen bestimmten Zweck oder ein Endziel hin ausgerichtet sind.
Wer sind die klassischen Vertreter des teleologischen Denkens?
Aristoteles gilt als Begründer der klassischen Teleologie. Im 18. Jahrhundert vertrat Christian Wolff die Auffassung, dass das Streben nach Vollkommenheit ein Naturrecht sei.
Warum lehnte Jean-Jacques Rousseau die Teleologie ab?
Rousseau entwickelte ein modernes Denken, das den Menschen nicht als auf ein göttliches Ziel fixiert sah, sondern den Fokus auf die menschliche Freiheit und Veränderbarkeit legte.
Was versteht Rousseau unter "Perfektibilität"?
Perfektibilität ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu vervollkommnen. Im Gegensatz zur Teleologie ist dieses Streben jedoch offen und nicht auf ein vorbestimmtes Ziel ausgerichtet.
Welche Konsequenzen hat Rousseaus Denken für den Staat?
Die Abkehr von festen Zweckvorgaben führt zu einer neuen Legitimation von Staatlichkeit, die auf dem Willen des Volkes und der politischen Freiheit basiert.
- Citation du texte
- Anne Waldow (Auteur), 2007, Die Abkehr von teleologischen Weltbildern - Jean-Jacques Rousseaus modernes Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72294