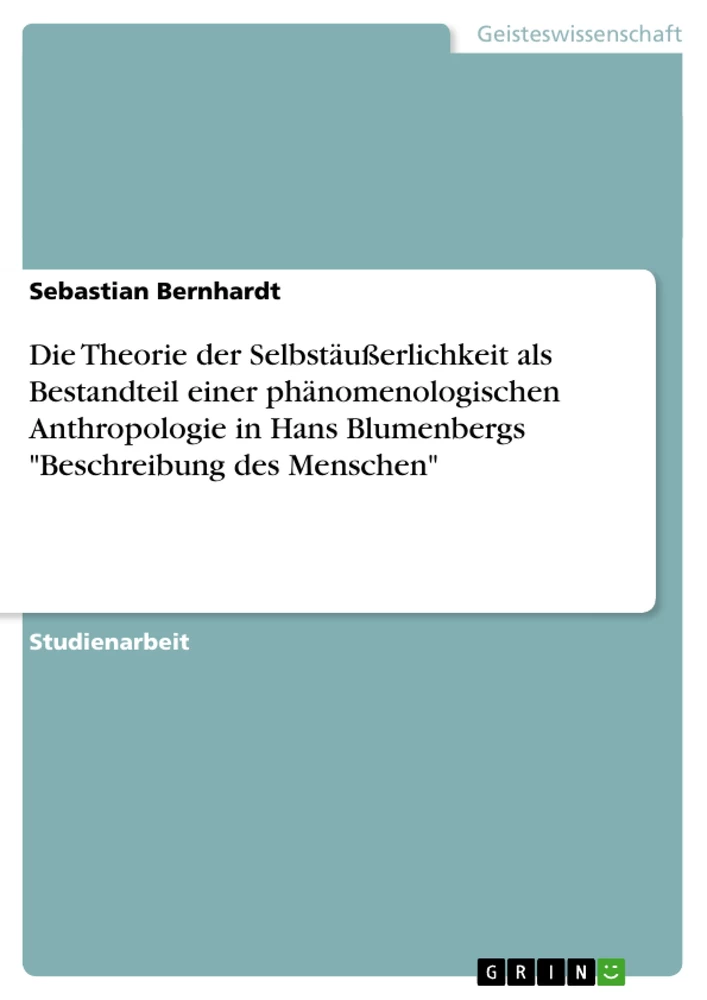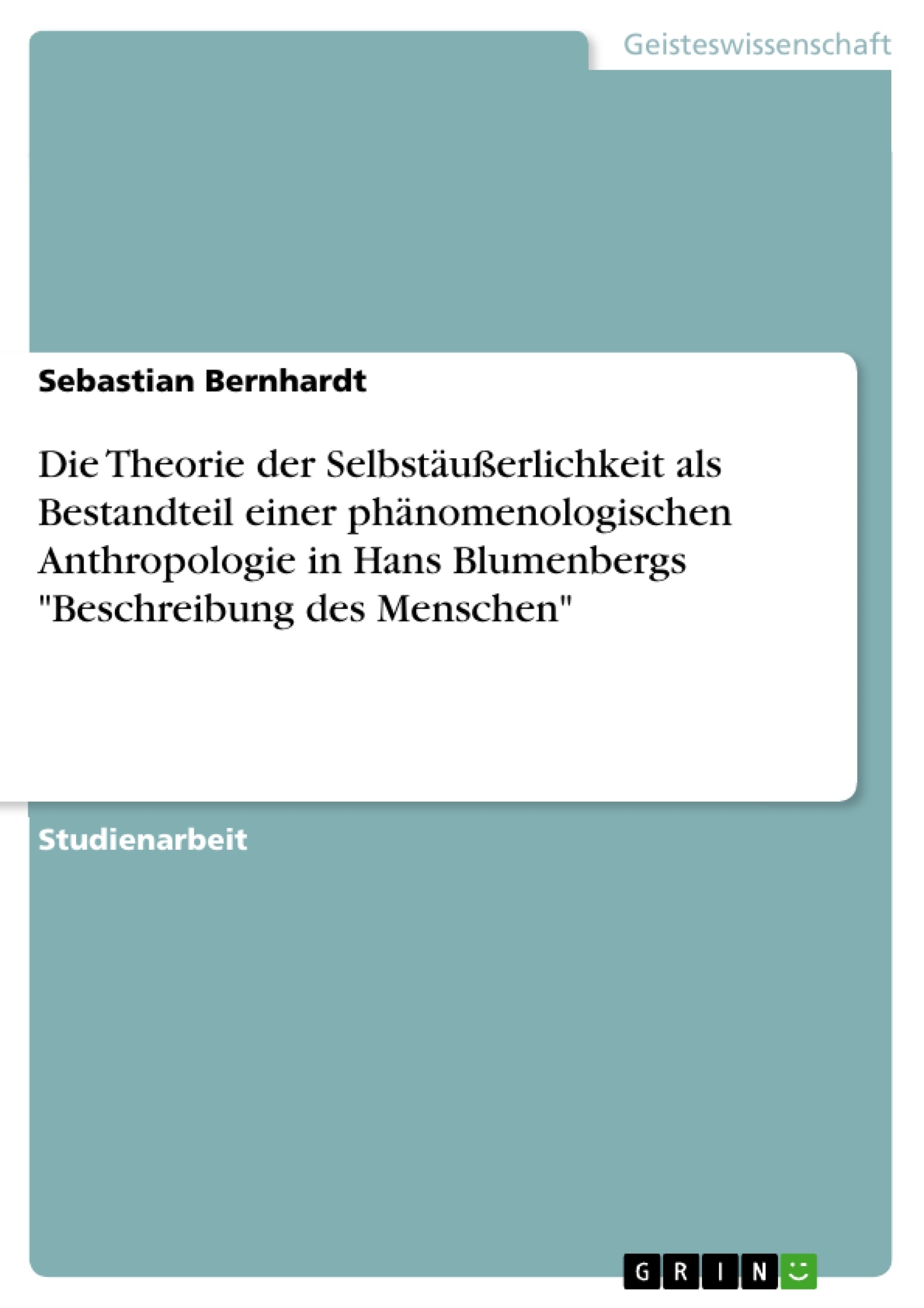In seinem aus dem Nachlass herausgegebenen Werk "Beschreibung des Menschen" (2006) stellt Hans Blumenberg den Versuch einer phänomenologischen Anthropologie vor. Nach einer grundlegenden Auseinandersetzung mit Husserls Prämisse der Unmöglichkeit einer Bestimmung des Menschen unter Anwendung der phänomenologischen Methode handelt er im zweiten Teil seines Werks im Abschnitt über "Kontingenz und Sichtbarkeit" die eigentliche Konkretisierung ab.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit seinem Kernpunkt, der Visibilität. Blumenberg zufolge richtete sich der Mensch beim Austritt aus dem Regenwald in die Steppe auf, womit er den Vorteil der weiteren Sicht mit dem gleichzeitigen Nachteil der weiteren Sichtbarkeit vereinbaren musste. Die leibliche Opazität sorgt für die äußere Sichtbarkeit des Menschen unter gleichzeitiger Verbergung des Inneren. Jedoch kommt es zu einer Intentionalitätsausstrahlung durch den Leib, welche für das Zusammenleben immanent wichtig ist, da sie die reine Äußerlichkeit zu durchbrechen hilft. Der Mensch muss sich dazu allerdings seiner Wirkung bewusst sein, bedarf der Selbstkonstitution zur Selbstdarstellung.
Blumenbergs Argumentationsgang zeigt an, dass die passive Optik elementares Merkmal des Menschen ist. Es handelt sich um eine Entthronisierung der Idee des animal rationale oder des logos als Wesensbestimmung des Menschen.
In dieser Ausarbeitung soll die These nachvollzogen und konturiert werden, die passive Optik definiere den Menschen. Dazu soll die Selbstlokalisierung des Leibes untersucht sowie die sich aus dem Bewusstsein des eigenen Leibes ergebenden Konsequenzen herausgearbeitet werden. Stets wird versucht, angeführte Gedanken zu deuten oder weiterzuführen, um die Thesen schlüssig zusammengefasst vorzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aussehenskonstitution als anthropina
- Selbstäußerlichkeit und Selbstkonstitution
- Visibilität im Kulturzustand: Scham und Verlegenheit
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hans Blumenbergs phänomenologische Anthropologie in seiner „Beschreibung des Menschen“, insbesondere den Aspekt der Visibilität als konstitutives Merkmal des Menschen. Sie analysiert, wie die passive Optik und die daraus resultierende Selbstlokalisierung den Menschen definieren und seine soziale Interaktion prägen.
- Die Rolle der Visibilität in der menschlichen Selbstkonstitution
- Der Einfluss der passiven Optik auf die soziale Interaktion
- Blumenbergs Kritik am Konzept des "animal rationale"
- Die Bedeutung der Selbstäußerlichkeit für das menschliche Zusammenleben
- Die Abgrenzung des Menschen von Tier und Göttlichem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Blumenbergs „Beschreibung des Menschen“ als Versuch einer phänomenologischen Anthropologie vor und fokussiert auf den Kernpunkt der Visibilität. Blumenbergs Argument, dass der aufrechte Gang des Menschen zu einer erhöhten Sichtbarkeit, aber auch Sichtweite führte, wird eingeführt. Die Arbeit kündigt an, die These der passiven Optik als definierendes Merkmal des Menschen zu untersuchen und die daraus resultierende Selbstlokalisierung und deren Konsequenzen zu analysieren.
Aussehenskonstitution als anthropina: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der gegenseitigen Visibilität für das menschliche Zusammenleben. Die optische Wahrnehmung des Anderen minimiert das Risiko der Begegnung und ermöglicht Kalkulierbarkeit im sozialen Kontext. Im Gegensatz zu Hobbes' „Leviathan“ wird die Notwendigkeit eines Präventivkrieges durch die Möglichkeit, die Intentionalität des anderen zu erkennen, obsolet. Die Undurchsichtigkeit der Leiber ermöglicht Konstanzannahmen über das Verhalten anderer. Blumenberg hebt die optische Evidenz als rationale Basis der Kontextbeurteilung hervor und betrachtet olfaktorische Einflüsse als Evolutionsrelikte. Der Vorteil der unmittelbaren optischen Wahrnehmung im Gegensatz zur akustischen wird betont, da letztere ohne Sprache keine fremde Intentionalität vergegenwärtigt.
Selbstäußerlichkeit und Selbstkonstitution: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Selbstäußerlichkeit und Selbstkonstitution des Menschen im Kontext seiner Visibilität. Blumenberg definiert den Menschen nicht mehr als "animal rationale", sondern als ein Wesen, das sich seiner Sichtbarkeit bewusst ist und sich in Bezug auf andere lokalisiert. Diese Selbstlokalisierung gegenüber fremder Sinnlichkeit und Intention wird als genetischer Ansatz zu aller Reflexivität dargestellt. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch seine Fähigkeit zur Reflexion über seine Visibilität und seine Selbstkonstitution. Die Selbstobjektivierung, nicht als innere Erfahrung, sondern als Reaktion auf die Sichtbarkeit anderer, wird als fundamental für die menschliche Entwicklung gesehen.
Schlüsselwörter
Phänomenologische Anthropologie, Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Visibilität, Passive Optik, Selbstäußerlichkeit, Selbstkonstitution, Selbstlokalisierung, Animal rationale, Intentionalität, Sozialität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Blumenbergs „Beschreibung des Menschen“
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hans Blumenbergs phänomenologische Anthropologie, insbesondere die Rolle der Visibilität als konstitutives Merkmal des Menschen. Der Fokus liegt auf der passiven Optik, der daraus resultierenden Selbstlokalisierung und deren Einfluss auf die menschliche Selbstkonstitution und soziale Interaktion.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Visibilität für die menschliche Selbstkonstitution, den Einfluss der passiven Optik auf soziale Interaktionen, Blumenbergs Kritik am Konzept des „animal rationale“, die Bedeutung der Selbstäußerlichkeit für das menschliche Zusammenleben und die Abgrenzung des Menschen von Tier und Göttlichem.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Aussehenskonstitution als anthropina, Selbstäußerlichkeit und Selbstkonstitution, Visibilität im Kulturzustand: Scham und Verlegenheit und einen Abschluss. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Rolle spielt die passive Optik in Blumenbergs Anthropologie?
Die passive Optik, d.h. die Fähigkeit, gesehen zu werden und die Sichtbarkeit anderer wahrzunehmen, ist zentral für Blumenbergs Anthropologie. Sie ermöglicht Selbstlokalisierung und beeinflusst maßgeblich die soziale Interaktion und die Selbstkonstitution des Menschen. Die Möglichkeit, die Intentionalität anderer optisch einzuschätzen, minimiert Konflikte und ermöglicht Kalkulierbarkeit im sozialen Kontext.
Wie unterscheidet Blumenberg den Menschen vom Tier?
Blumenberg kritisiert das traditionelle Konzept des „animal rationale“. Er betont stattdessen die Bedeutung der Selbstäußerlichkeit und der reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Sichtbarkeit als Unterscheidungsmerkmal zum Tier. Der Mensch ist sich seiner Sichtbarkeit bewusst und lokalisiert sich in Bezug auf andere, was eine fundamentale Grundlage für Reflexivität darstellt.
Welche Bedeutung hat die Selbstkonstitution im Kontext der Visibilität?
Die Selbstkonstitution des Menschen wird als Prozess verstanden, der eng mit der Visibilität verbunden ist. Die Reaktion auf die Sichtbarkeit anderer führt zu einer Selbstobjektivierung und prägt die menschliche Entwicklung. Die Selbstlokalisierung gegenüber fremder Sinnlichkeit und Intention ist ein genetischer Ansatzpunkt für alle Reflexivität.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Phänomenologische Anthropologie, Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Visibilität, Passive Optik, Selbstäußerlichkeit, Selbstkonstitution, Selbstlokalisierung, Animal rationale, Intentionalität, Sozialität.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Die Arbeit argumentiert, dass die Visibilität und die daraus resultierende passive Optik ein konstitutives Merkmal des Menschen sind, welches seine Selbstkonstitution und soziale Interaktion prägt und ihn von Tier und Göttlichem abgrenzt. Blumenbergs Konzept der passiven Optik bietet eine alternative Perspektive zur traditionellen Vorstellung des „animal rationale“.
- Quote paper
- Sebastian Bernhardt (Author), 2007, Die Theorie der Selbstäußerlichkeit als Bestandteil einer phänomenologischen Anthropologie in Hans Blumenbergs "Beschreibung des Menschen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72328