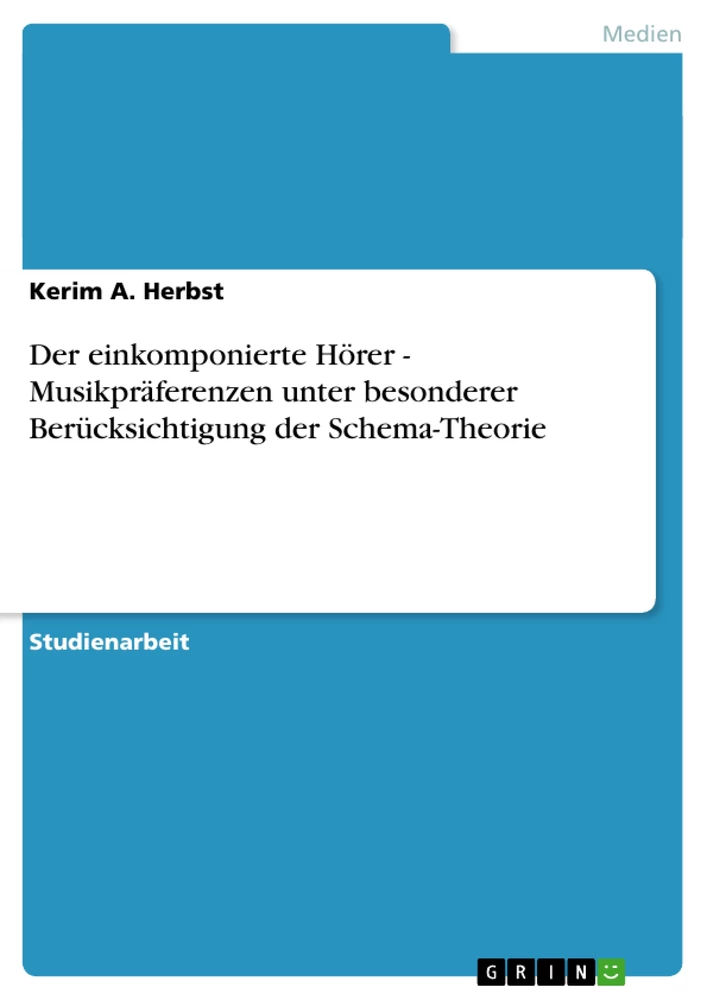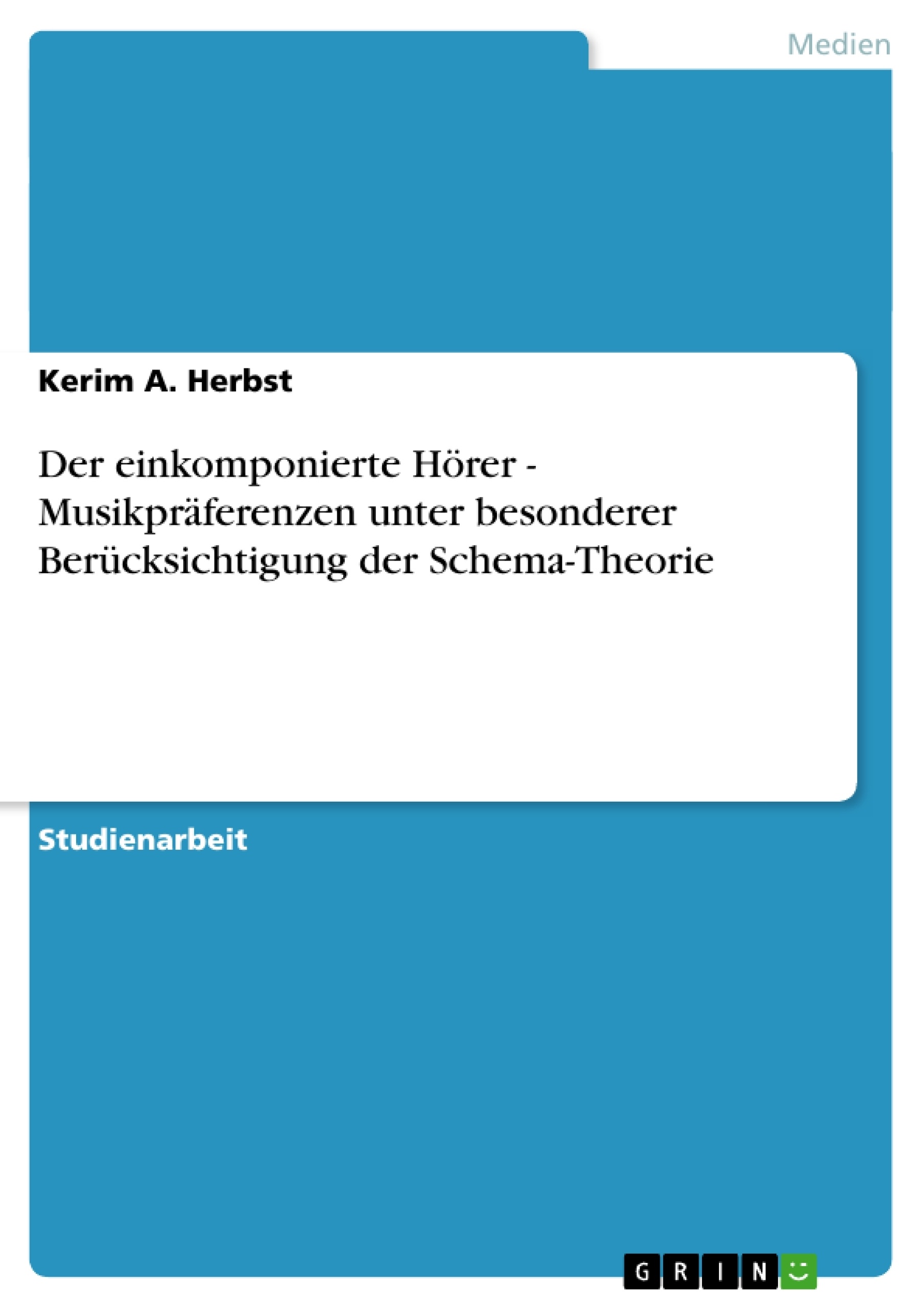„Über Geschmäcker lässt sich streiten.“ Dies gilt gleichwohl für jegliche Formen der Wahrnehmung über unsere klassischen fünf Sinne: So kann man sich über Skulpturen und Bilder (Sehen), kulinarische Vorlieben (Schmecken), den Duft eines Parfums (Riechen), die Beschaffenheit eines Wollpullovers (Tasten), aber natürlich auch über ein Musikstück im Radio (Hören) streiten. In allen diesen Feldern gibt es also keinen klaren, gesellschaftlichen Konsens darüber, wie etwas geartet sein muss, damit es „der Masse“ gefällt. Und um es auf den Bereich der Musik zu beziehen: warum scheint es dennoch Konsens darüber zu geben, was gefällt und was nicht? Nimmt man aktuelle Plattenverkaufszahlen als Indikator für Musikgeschmack, dann müssten die Musikproduktionen mit den meisten Abverkäufen von hoher gesellschaftlicher Akzeptanz sein – oder ist das schon Geschmack?
Auf dem Gebiet der kognitiven Psychologie zeichnen sich Theorien ab, die unterschiedlich Geschmackspräferenzen zu erklären versuchen. Eine, die Schema-Theorie, soll in dieser Hausarbeit als Arbeitsgrundlage dafür dienen, musikalische Präferenzen zu erklären. Wieso gefallen uns Musikstücke, Komponisten oder Interpreten besonders gut, andere wiederum gar nicht? Wie lassen sich die unterschiedlichen Musikgeschmäcker verschiedener Kulturkreise erklären? Warum erscheint uns ein fernöstliches Folklore-Stück
schief und intonal?
Licht in das Dunkel dieser Fragen zu bringen ist vornehmliches Ziel dieser Hausarbeit. Dabei wird in Kapitel zwei auf kognitive Informationsverarbeitung eingegangen, die den Ausgangspunkt für die folgenden theoretischen Ansätze liefert. Einen Schwerpunkt findet sich in Kapitel drei, der sich mit der Schema-Theorie im kommunikationswissenschaftlichen Verständnis nähert. Diese Gewichtung rechtfertigt sich mitunter auch in dem Versuch an das im Sommersemester 2006 stattgefundene Seminar „Framing & Priming“
anzuknöpfen, in dem die Schema-Theorie eher Stiefmütterlich behandelt wurde. Den Brückenschlag bildet Kapitel vier, indem, anknüpfend auf vorangegangenes Kapitel, aufgezeigt wird, was musikalische Schemata sind und in welcher Form diese auftreten. Den Abschluss bildet Kapitel fünf, das mit der Beschreibung von Determinanten von Musikpräferenzen versucht, oben genannter Fragestellung näher zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kognitive Informationsverarbeitung
- Das „Drei-Speicher-Modell“ von Atkinson & Shiffrin (1968)
- Konsistenztheoretische Modelle
- Schema-Theorie
- Soziale Schemata nach Fiske & Taylor
- Personen-Schemata
- Selbst-Schema
- Rollen-Schemata
- Ereignis-Schemata
- Erwerb und Modifikation von Schemata
- Einfluss von Schemata auf die Informationsverarbeitung
- Soziale Schemata nach Fiske & Taylor
- Musikalische Schemata
- Typen musikalischer Schemata
- Stil- und Formschemata
- Strukturschemata
- Typen musikalischer Schemata
- Determinanten der Musikpräferenz
- Theoretischer Hintergrund
- Einflussfaktoren
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht musikalische Präferenzen unter Anwendung der Schema-Theorie. Ziel ist es, zu erklären, warum Menschen unterschiedliche Musikstücke bevorzugen und wie sich diese Präferenzen erklären lassen, beispielsweise kulturell bedingte Unterschiede im Musikgeschmack. Die Arbeit beleuchtet die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung als Grundlage für das Verständnis musikalischer Präferenzen.
- Kognitive Informationsverarbeitung und deren Modelle
- Die Schema-Theorie und ihre Anwendung auf die Musik
- Musikalische Schemata und ihre verschiedenen Typen
- Determinanten der Musikpräferenz
- Erklärung von individuellen und kulturellen Unterschieden im Musikgeschmack
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Musikpräferenzen ein und stellt die zentrale Frage nach den Gründen für unterschiedliche Geschmäcker. Sie skizziert den Ansatz der Schema-Theorie zur Erklärung dieser Präferenzen und benennt die Ziele der Arbeit. Das Zitat von Adorno verdeutlicht die Problematik von vorgegebenen Hörerwartungen und betont die Bedeutung einer unabhängigen Hörerfahrung. Die Arbeit knüpft an das Seminar „Framing & Priming“ an und fokussiert auf die Rolle der Schema-Theorie bei der Verarbeitung musikalischer Informationen.
Kognitive Informationsverarbeitung: Dieses Kapitel beschreibt die Notwendigkeit der Selektion und Strukturierung von Informationen im menschlichen Wahrnehmungsprozess. Es werden kognitive Strukturen als Grundlage der Informationsverarbeitung eingeführt und anhand des „Drei-Speicher-Modells“ von Atkinson & Shiffrin (1968) erläutert. Der Prozess der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung wird detailliert dargestellt, inklusive der Funktionen des Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses. Die Rolle der kognitiven Strukturen bei der Vereinfachung komplexer Informationen und der Selektivität der Informationsverarbeitung wird hervorgehoben, mit der Implikation unterschiedlicher Medienwirkungen bei verschiedenen Rezipienten.
Schlüsselwörter
Musikpräferenzen, Schema-Theorie, Kognitive Informationsverarbeitung, Drei-Speicher-Modell, Musikalische Schemata, Stil- und Formschemata, Strukturschemata, Informationsverarbeitung, Selektivität, Kultur, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Musikpräferenzen und Schema-Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Gründe für unterschiedliche Musikpräferenzen unter Anwendung der Schema-Theorie. Sie beleuchtet die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung als Grundlage für das Verständnis musikalischer Präferenzen und erklärt, warum Menschen verschiedene Musikstücke bevorzugen, einschließlich kulturell bedingter Unterschiede.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die kognitive Informationsverarbeitung und deren Modelle (inkl. des Drei-Speicher-Modells von Atkinson & Shiffrin), die Schema-Theorie und ihre Anwendung auf die Musik, verschiedene Typen musikalischer Schemata (Stil- und Formschemata, Strukturschemata), Determinanten der Musikpräferenz und die Erklärung individueller und kultureller Unterschiede im Musikgeschmack.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kognitive Informationsverarbeitung, Schema-Theorie, Musikalische Schemata, Determinanten der Musikpräferenz und Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Wie wird die Schema-Theorie in der Hausarbeit angewendet?
Die Schema-Theorie dient als zentrales Erklärungsmodell für Musikpräferenzen. Die Arbeit untersucht, wie musikalische Schemata (Stil-, Form- und Strukturschemata) die Informationsverarbeitung und damit die Präferenzbildung beeinflussen.
Welche Rolle spielt die kognitive Informationsverarbeitung?
Die kognitive Informationsverarbeitung bildet die Grundlage für das Verständnis der Musikpräferenz. Die Hausarbeit erläutert, wie der Mensch Informationen selektiert, strukturiert und speichert, und wie diese Prozesse die Wahrnehmung und Beurteilung von Musik beeinflussen.
Welche Arten musikalischer Schemata werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Stil- und Formschemata sowie Strukturschemata als verschiedene Typen musikalischer Schemata.
Welche Faktoren beeinflussen die Musikpräferenz?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Determinanten der Musikpräferenz, darunter kulturelle Einflüsse und die Rolle kognitiver Prozesse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Musikpräferenzen, Schema-Theorie, Kognitive Informationsverarbeitung, Drei-Speicher-Modell, Musikalische Schemata, Stil- und Formschemata, Strukturschemata, Informationsverarbeitung, Selektivität, Kultur, Wahrnehmung.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, die unterschiedlichen Musikpräferenzen zu erklären und zu verstehen, wie diese Präferenzen durch kognitive Prozesse und Schemata beeinflusst werden.
Wie wird das Drei-Speicher-Modell von Atkinson & Shiffrin verwendet?
Das Drei-Speicher-Modell dient als Grundlage für das Verständnis der kognitiven Informationsverarbeitung und erklärt die Prozesse der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung im Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis.
- Quote paper
- Kerim A. Herbst (Author), 2006, Der einkomponierte Hörer - Musikpräferenzen unter besonderer Berücksichtigung der Schema-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72332