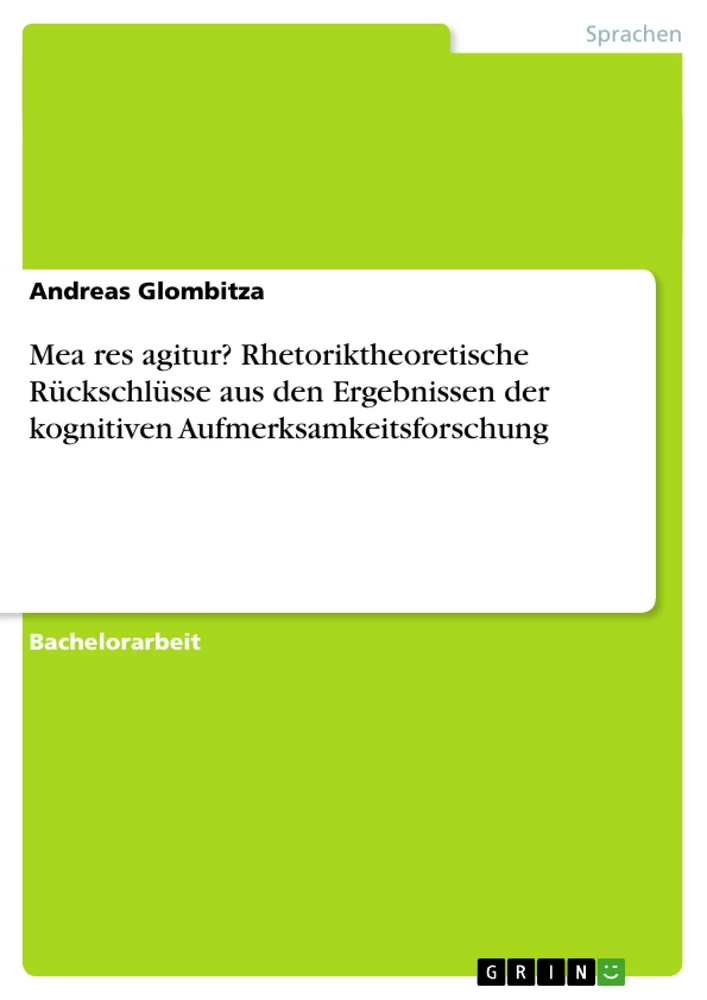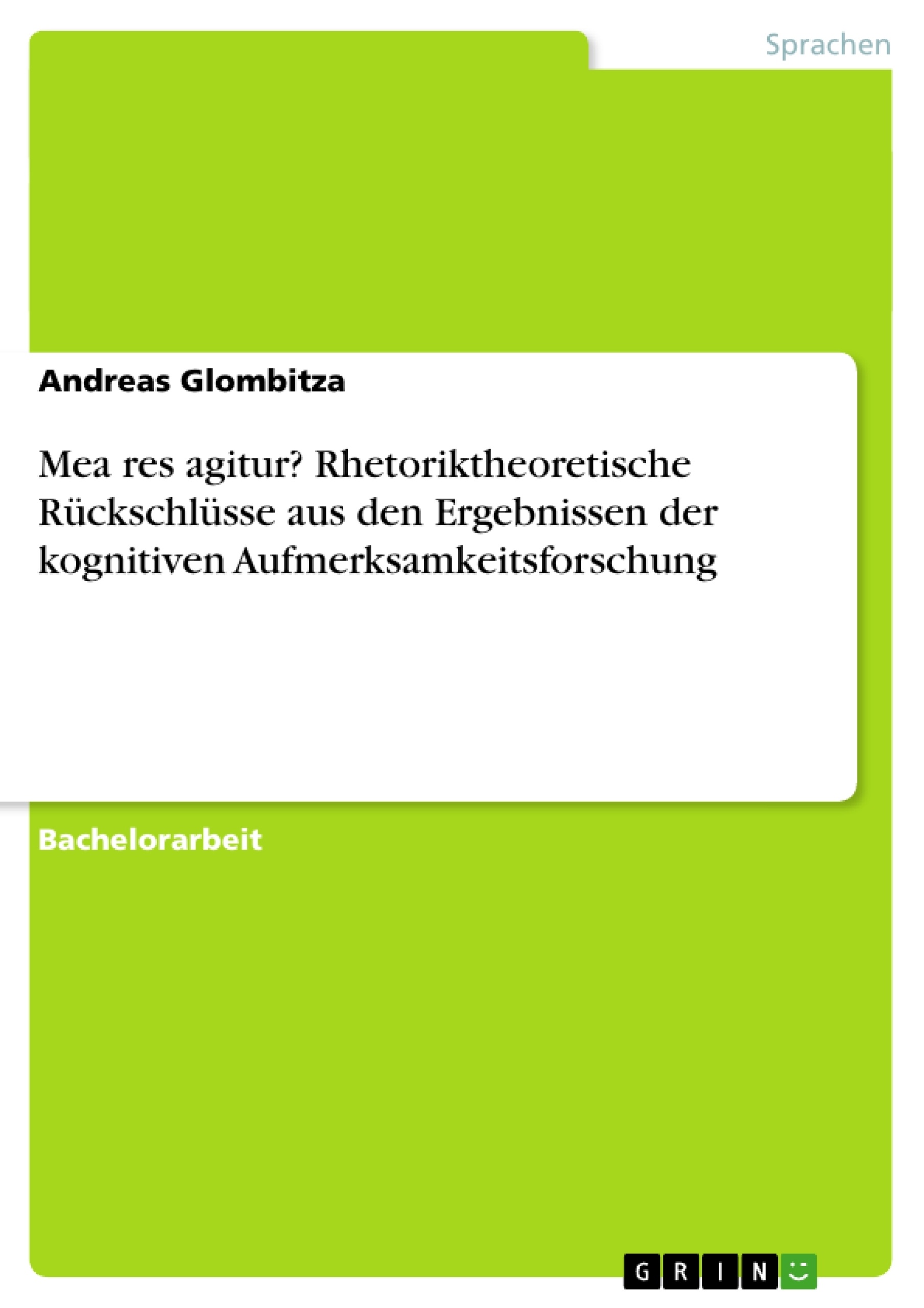Diese Arbeit zielt darauf ab, theoretische Kopnzepte der Kognitionspsychologischen Forschung für die Rhetoriktheorie nutzbar zu machen und Anschlussstellen aufzuzeigen. Nach einer kurzen Betrachtung der kognitionspsychologischen Hauptkonzepte zum Thema Aufmerksamkeit und deren Bewertung, wenden sie sich dem Problem zu, oratorische Techniken zu deren Herstellung zu finden. Aufmerksamkeit wird dazu analytisch in zwei Qualitäten aufgespalten: eine unwillkürliche, automatisch und tendenziell gleichförmig nach dem Stimulus- Response-Prinzip beeinflussbare "Aufmerksamkeit I", die hauptsächlich mit Performanzphänomenen in Verbindung gebracht werden kann, und eine willentlich und kognitiv steuerbare verbaltextuell orientierte "Aufmerksamkeit II". Die Unterscheidung wird getroffen analog zur Unterscheidung der auslösenden Reize und nach dem Kriterium ihrer semiotischen Komplexität. Der zweite Teil zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster sich mit der Möglichkeit und Nützlichkeit einer allgemeinen Topik zur Erzeugung von Aufmerksamkeit I beschäftigen wird. Im zweiten Abschnitt wird versucht, auf Basis konstruktivistischer Vorstellungen und einer pragmatischen Theorie einen kognitiv fudierten Zugang zu Aufmerksamkeit II zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Begriffsbestimmung
- Analyse
- Aufmerksamkeit in der Kognitionspsychologie
- Das Filtermodell
- Das Kapazitätsmodell
- Stellenwert der kognitiven Aufmerksamkeitsforschung für die Rhetorik, Anschlussstellen
- Aufmerksamkeit als Präsenz des Orators im Adressatenbewusstsein
- Aufmerksamkeit I: Aufmerksamkeitsheuristik?
- Aufmerksamkeit II: Logosinduzierte Aufmerksamkeit, Relevanztheorie, tua res agitur bei Sperber/Wilson
- Aufmerksamkeit in der Kognitionspsychologie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufmerksamkeitsbegriff aus rhetoriktheoretischer Sicht und untersucht, wie Erkenntnisse der kognitiven Aufmerksamkeitsforschung für die Rhetorik nutzbar gemacht werden können. Sie analysiert die Bedeutung von Aufmerksamkeit für den Erfolg des Persuasionsaktes und differenziert zwischen zwei Arten von Aufmerksamkeit: einer unwillkürlichen, automatisch beeinflussbaren Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeit I) und einer willentlichen, kognitiv steuerbaren Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeit II). Die Arbeit erforscht, wie oratorische Techniken eingesetzt werden können, um die Aufmerksamkeit des Adressaten zu gewinnen und zu lenken. Sie untersucht insbesondere die Rolle von peripheral-route-Phänomenen, wie Gestik und Mimik, sowie die Anwendung der Relevanztheorie von Sperber/Wilson zur Erklärung von Aufmerksamkeit II.
- Definition und Differenzierung von Aufmerksamkeit I und II
- Bedeutung von Aufmerksamkeit für die rhetorische Praxis
- Einsatz von oratorischen Techniken zur Erzeugung von Aufmerksamkeit
- Anwendbarkeit der Relevanztheorie für die Erklärung von Aufmerksamkeit II
- Zusammenhang zwischen kognitiver Forschung und rhetorischer Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Begriffsbestimmung: Die Einleitung definiert den Aufmerksamkeitsbegriff und unterscheidet zwischen „strategischer“ und „transzendentaler“ Aufmerksamkeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die „strategische“ Aufmerksamkeit, die die Aufmerksamkeit des Adressaten als Ziel hat. Der Begriff „Aufmerksamkeit“ wird in diesem Zusammenhang als der selektive Mechanismus verstanden, der über Zuwendung oder Nicht-Zuwendung entscheidet. Die Arbeit skizziert die Bedeutung von Aufmerksamkeit für den Erfolg des Persuasionsaktes und stellt die Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit I und II vor.
- Analyse: Dieses Kapitel widmet sich der kognitionspsychologischen Forschung zum Thema Aufmerksamkeit. Es beschreibt das Filtermodell und das Kapazitätsmodell und beleuchtet deren Relevanz für die Rhetorik. Der Abschnitt „Stellenwert der kognitiven Aufmerksamkeitsforschung für die Rhetorik, Anschlussstellen“ analysiert die Begrenztheit der kognitiven Ansätze für die Erklärung von Aufmerksamkeit in komplexen, rhetorischen Situationen und stellt die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtungsweise heraus. Die Unterkapitel „Aufmerksamkeit I: Aufmerksamkeitsheuristik?“ und „Aufmerksamkeit II: Logosinduzierte Aufmerksamkeit, Relevanztheorie, tua res agitur bei Sperber/Wilson“ untersuchen die Möglichkeiten, Aufmerksamkeit I und II in der rhetorischen Praxis zu erzeugen und zu lenken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Aufmerksamkeitsforschung, Rhetorik, Persuasion, kognitionspsychologische Modelle, Filtermodell, Kapazitätsmodell, Relevanztheorie, Sperber/Wilson, tua res agitur, Aufmerksamkeit I, Aufmerksamkeit II, peripheral-route-Phänomene, central-route-Werkzeuge, oratorische Techniken, Adressatenkalkül.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit I und II?
Aufmerksamkeit I ist unwillkürlich und reagiert automatisch auf Reize, während Aufmerksamkeit II willentlich, kognitiv steuerbar und verbaltextuell orientiert ist.
Wie kann die Kognitionspsychologie der Rhetoriktheorie helfen?
Erkenntnisse aus Filter- und Kapazitätsmodellen helfen dabei, oratorische Techniken zu entwickeln, die gezielt die Aufmerksamkeit des Adressaten steuern.
Welche Rolle spielt die Relevanztheorie von Sperber/Wilson?
Sie dient als Basis, um einen kognitiv fundierten Zugang zur willentlichen Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeit II) zu finden, indem sie erklärt, wie Informationen als relevant eingestuft werden.
Was bedeutet 'Mea res agitur' in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf das Prinzip, dass der Adressat seine Aufmerksamkeit dann schenkt, wenn er das Gefühl hat, dass die dargebotene Information ihn persönlich betrifft.
Wie beeinflussen Gestik und Mimik die Aufmerksamkeit?
Diese Performanzphänomene werden der Aufmerksamkeit I zugeordnet, da sie oft unbewusst und automatisch nach dem Stimulus-Response-Prinzip wirken.
- Quote paper
- Andreas Glombitza (Author), 2006, Mea res agitur? Rhetoriktheoretische Rückschlüsse aus den Ergebnissen der kognitiven Aufmerksamkeitsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72423