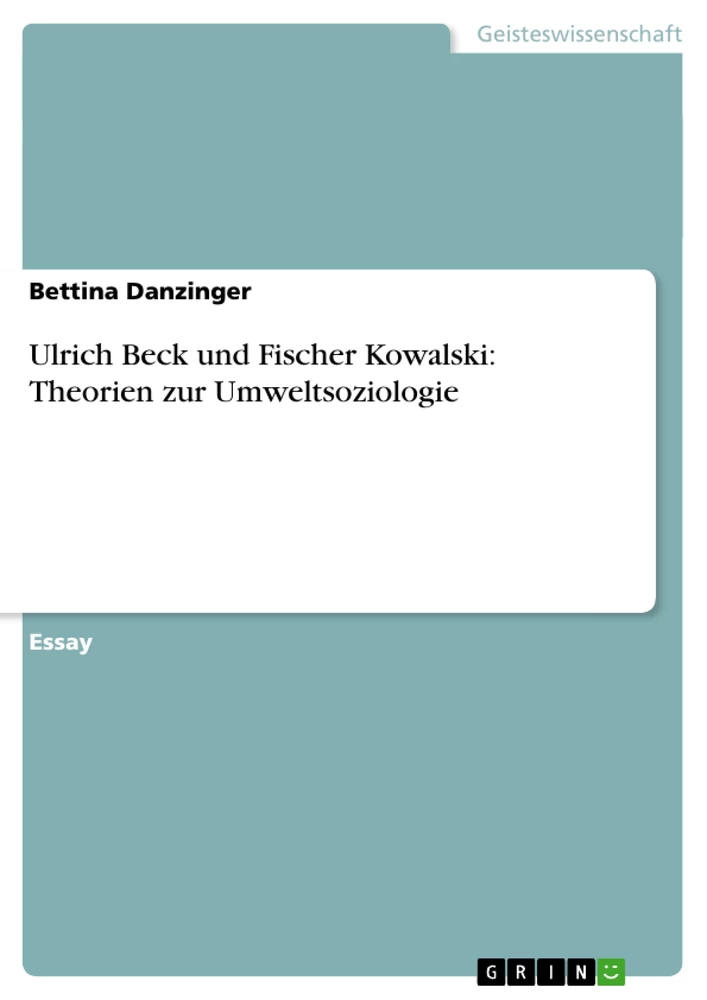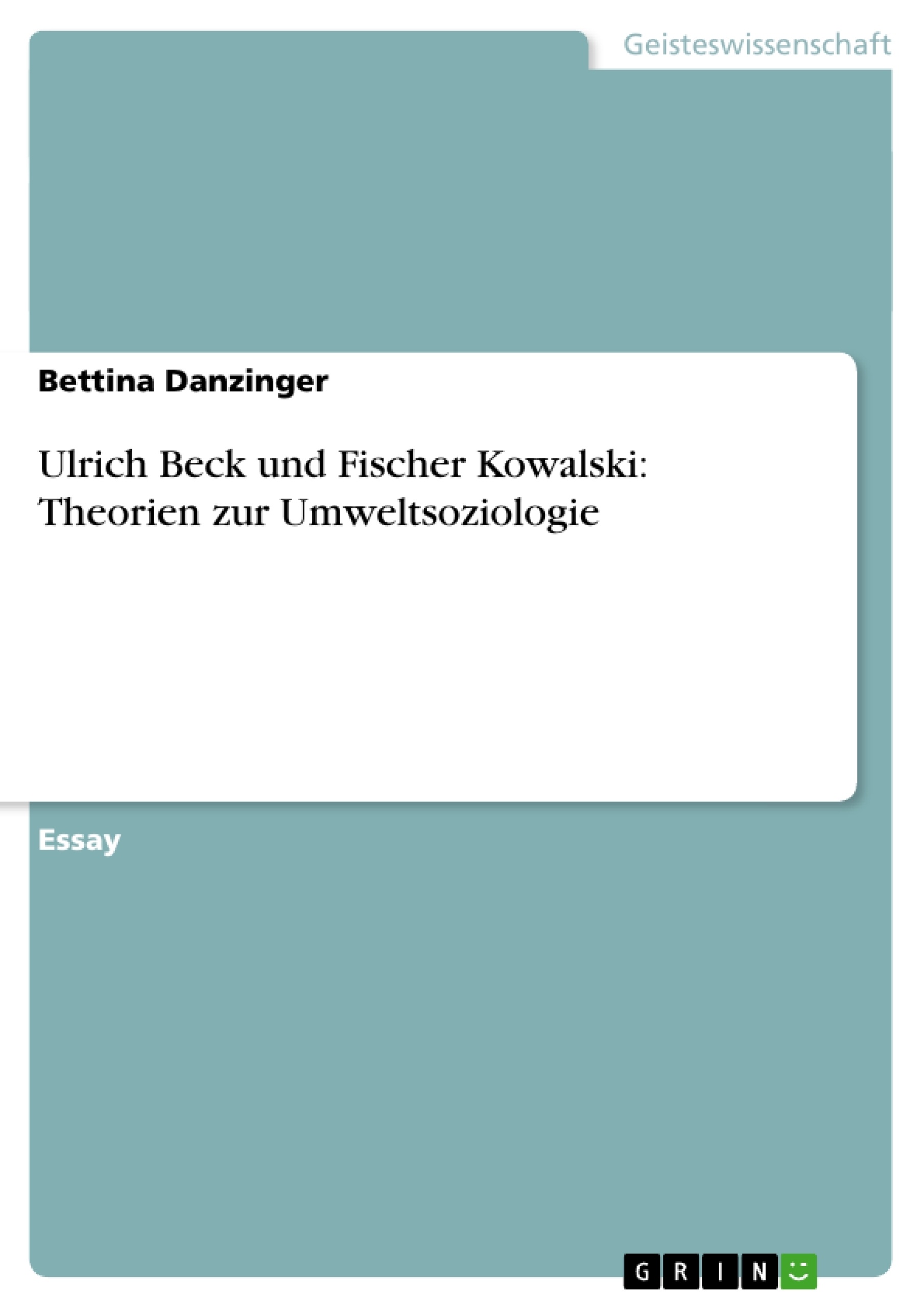Was sind eigentlich die Risiken, auf welche Ulrich Beck seine Gesellschaftstheorie in dem Buch: „Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine neue Moderne“, begründet? Welche Probleme verursachen sie? Woher kommen sie?
Was ein Risiko ist, kennen wir aus den Artikeln der Zeitungsseiten, die früher unter der Rubrik „Unfälle und Verbrechen“ standen. Ein Verbrechen ist ein Ereignis, das in einer schlecht verlaufenen Risikolage eintreffen kann. Ein Risiko kann so auch durch eine soziale Handlungslage ausgelöst werden, nicht ausschließlich durch technische Unvollkommenheit oder Naturkatastrophen.
Man hat an jeweils Beides zu denken. An Technik und Gesellschaft sowie an Natur und Gesellschaft, wenn von einer Häufung der Risiken in den letzten Jahrzehnten gesprochen wird.
„Systematisch argumentiert, beginnen sich gesellschaftsgeschichtlich früher oder später in der Kontinuität von Modernisierungsprozessen die sozialen Lagen und Konflikte einer ‘reichtumsverteilenden’ mit denen einer ‘risikoverteilenden’ Gesellschaft zu überschneiden. In der Bundesrepublik stehen wir – das ist meine These – spätestens seit den siebziger Jahren am Beginn dieses Übergangs. . Das heißt: hier überlagern sich beide Arten von Themen und Konflikten. Wir leben noch nicht in einer Risikogesellschaft, aber auch nicht mehr nur in Verteilungskonflikten der Mangelgesellschaften. In dem Masse, in dem dieser Übergang vollzogen wird, kommt es dann wirklich zu einem Gesellschaftswandel, der aus den bisherigen Kategorien und Bahnen des Denkens und Handelns herausführt.“ (Beck,1986, 27)
Inhaltsverzeichnis
- Das Risiko in der Modernen Gesellschaft oder die Risikogesellschaft
- Risikobewusstsein und Solidaritätsgefühl
- Das pyramidale und unbegrenzte Netz
- Becks Modernisierung
- Risiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den Theorien von Ulrich Beck zur Umweltsoziologie und analysiert, wie sich Risiken in der modernen Gesellschaft entwickeln und auswirken. Er untersucht die Auswirkungen der Risikogesellschaft auf das Bewusstsein und das Solidaritätsgefühl der Menschen.
- Das Risiko als zentrales Element der modernen Gesellschaft
- Die Auswirkungen von Risiken auf das Bewusstsein und das Verhalten der Menschen
- Die Rolle von Technik und Gesellschaft in der Entstehung und Verbreitung von Risiken
- Die Frage der Solidarität in der Risikogesellschaft
- Die Herausforderungen der Risikoverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Risiko in der Modernen Gesellschaft oder die Risikogesellschaft
Dieses Kapitel stellt die Risikogesellschaft als ein zentrales Konzept von Ulrich Beck vor und analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Risiken in der modernen Gesellschaft. Es wird untersucht, wie Risiken durch technische Unzulänglichkeiten und soziale Handlungen entstehen und sich auf die Gesellschaftsstruktur auswirken.
2. Risikobewusstsein und Solidaritätsgefühl
Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob das Risikobewusstsein in der Risikogesellschaft das Solidaritätsgefühl verstärkt oder schwächt. Es wird argumentiert, dass die allgegenwärtigen Risiken zu einer Verdrängung von Verantwortlichkeiten und einer stärkeren Orientierung auf das eigene Wohlergehen führen.
3. Das pyramidale und unbegrenzte Netz
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Vernetzung von Wissen und Risiken in der modernen Gesellschaft. Es wird die Bedeutung des Internets für die Verbreitung von Informationen und die Herausforderungen der Risikoverteilung in einem globalisierten Kontext diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Risikogesellschaft, Modernisierung, Risikobewusstsein, Solidaritätsgefühl, Vernetzung, Risikoverteilung, Umweltsoziologie.
- Citation du texte
- Bettina Danzinger (Auteur), 2005, Ulrich Beck und Fischer Kowalski: Theorien zur Umweltsoziologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72440