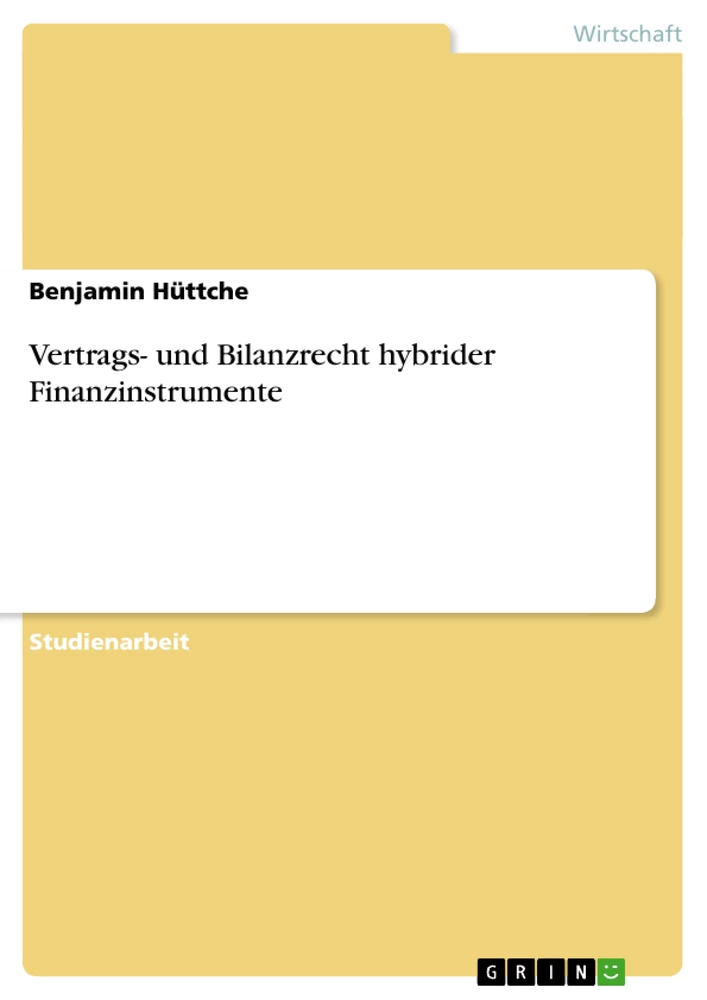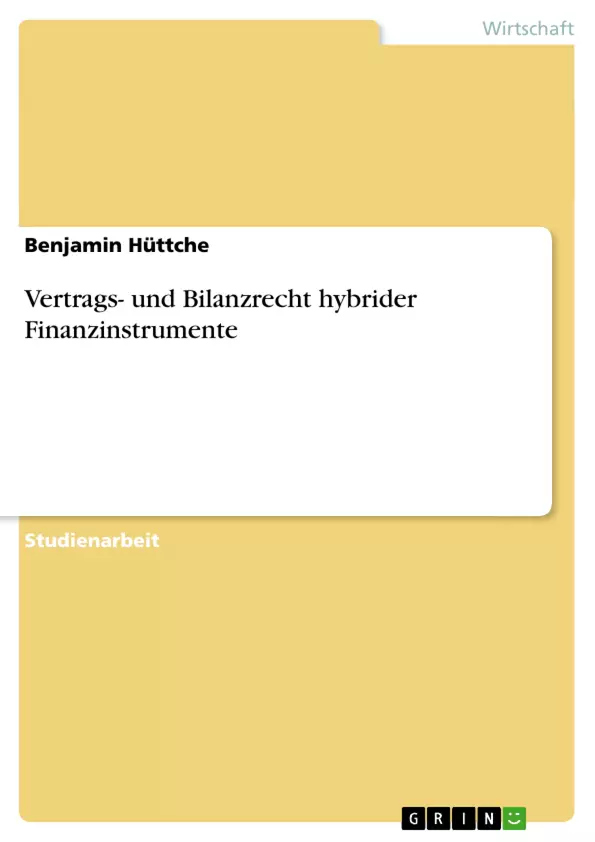In den vergangenen Jahren führten ein sich verschärfender Wettbewerb und eine fortschreitende Internationalisierung zu einem tief greifenden Wandel in der Finanzierungslandschaft der Unternehmen. Die Unternehmen mussten sich in jüngster Zeit immer neuen Herausforderungen seitens der Märkte als auch seitens der rechtlichen Rahmenbedingungen stellen.
Angetrieben wird die Verschärfung der Situation durch Basel II. Bereits Ende 2006 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den ersten Kreditinstituten Zulassungsbescheide für bankinterne Risikosteuerungssysteme erteilt. Hiermit durften diese bereits zum 01.01.2007 die Eigenkapitalunterlegung für die von ihnen eingegangenen Kreditrisiken selbst ermitteln. Die Höhe der Eigenkapitalunterlegung ist dabei abhängig von dem ermittelten Kreditrisiko. Dabei lässt sich eine einfache Formel für die Konditionengestaltung seitens der Kreditinstitute herleiten. Weist der Kreditnehmer eine gute Bonität auf, so besteht nur ein geringes Risiko, dass der Kredit ausfällt und der Kreditnehmer zahlt niedrigere Kreditzinsen. Ist die Bonität jedoch schlecht, so ist das Risiko größer und der Kreditnehmer zahlt höhere Kreditzinsen. Ein größeres Gewicht fällt dabei zukünftig auf Eigenkapitalausstattung der Kreditnehmer. Hier konstituiert sich das Dilemma der deutschen Unternehmen, denn diese haben traditionell einen hohen Fremdkapitalanteil. Dies ist das Resultat einer steuerlichen Bevorzugung von Fremdkapital in Deutschland. In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Finanzierungsformen entwickelt, wodurch die steuerliche Bevorzugung von Fremdkapital weiterhin sichergestellt-, die Eigenkapitalposition der Unternehmen aber dennoch verbessert wird: die so genannten hybriden Finanzinstrumente.
Das zweite Kapitel widmet sich der Einordnung der hybriden Finanzinstrumente, nachdem ein Einblick in die grundlegenden Finanzierungsmöglichkeiten einer Unternehmung gewährt wurde. Im dritten Kapitel wird das Vertrags- und Bilanzrecht von hybriden Finanzinstrumenten am Beispiel der Wandelanleihe besprochen und richtet den Fokus auf das Bilanzrecht nach HGB und IAS/IFRS. Das Bilanzrecht für Wandelanleihen nach US-GAAP soll am Ende des Kapitels besprochen werden.
Schließlich beschäftigt sich das vierte Kapital mit der Frage, ob eine Wandelanleihe das richtige Finanzinstrument ist, um die Eigenkapitalposition einer Unternehmung zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. EINORDNUNG DER HYBRIDEN FINANZINSTRUMENTE
- A. DIE INNEN- UND AUßENFINANZIERUNG
- B. ABGRENZUNG DES EIGENKAPITALS VOM FREMDKAPITAL
- C. MEZZANINE-KAPITAL
- D. HYBRIDE FINANZINSTRUMENTE
- E. ABGRENZUNG DER HYBRIDEN FINANZINSTRUMENTE VON DEM MEZZANINE-KAPITAL
- III. VERTRAGS- UND BILANZRECHT AM BEISPIEL VON WANDELANLEIHEN
- A. VERTRAGSRECHT AM BEISPIEL DER WANDELANLEIHE
- 1. Wandelanleihe
- 2. Wandelanleihebedingungen
- 3. Hauptversammlungsbeschluss
- 4. Reguläres, genehmigtes und bedingtes Kapital
- B. BILANZRECHT AM BEISPIEL DER WANDELANLEIHE
- 1. Bilanzrecht nach HGB
- 2. Bilanzrecht nach IAS/IFRS
- 3. Bilanzrecht nach US-GAAP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Vertrags- und Bilanzrechtlichen Aspekten von hybriden Finanzinstrumenten, insbesondere im Kontext der Wandelanleihe. Der Fokus liegt darauf, die Einordnung dieser Finanzinstrumente in die traditionelle Unterscheidung von Eigen- und Fremdkapital zu analysieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Emission und Bilanzierung zu beleuchten.
- Einordnung der hybriden Finanzinstrumente im Vergleich zu Eigen- und Fremdkapital
- Vertragsrechtliche Aspekte der Wandelanleihe
- Bilanzielle Behandlung von Wandelanleihen nach HGB, IAS/IFRS und US-GAAP
- Bewertung von Agios bei Wandelanleihen
- Die Bedeutung von hybriden Finanzinstrumenten für die Eigenkapitalposition von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der aktuelle Wandel in der Finanzierungslandschaft der Unternehmen im Kontext des verschärften Wettbewerbs und der Internationalisierung beschrieben. Die Bedeutung von hybriden Finanzinstrumenten für die Verbesserung der Eigenkapitalposition der Unternehmen wird hervorgehoben.
Das zweite Kapitel widmet sich der Einordnung der hybriden Finanzinstrumente. Es wird die traditionelle Unterscheidung von Innen- und Außenfinanzierung erläutert, sowie die Abgrenzung des Eigenkapitals vom Fremdkapital. Der Begriff des Mezzanine-Kapitals wird definiert und die Beziehung zu hybriden Finanzinstrumenten geklärt.
Kapitel drei behandelt das Vertrags- und Bilanzrecht von Wandelanleihen. Es werden die rechtlichen Grundlagen der Emission von Wandelanleihen nach AktG und BGB erläutert, sowie die unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden nach HGB, IAS/IFRS und US-GAAP im Vergleich vorgestellt. Es werden insbesondere die Aspekte der Agio-Bewertung und die bilanzielle Behandlung der Wandelanleihe im Fall einer Wandlung betrachtet.
Schlüsselwörter
Hybride Finanzinstrumente, Mezzanine-Kapital, Wandelanleihe, Vertragsrecht, Bilanzrecht, HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, Agio, Eigenkapital, Fremdkapital, Kapitalerhöhung, Finanzierungslandschaft, Unternehmen, Internationalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind hybride Finanzinstrumente?
Es sind Finanzierungsformen, die Merkmale von sowohl Eigen- als auch Fremdkapital vereinen, wie zum Beispiel Wandelanleihen.
Warum nutzen Unternehmen hybride Finanzinstrumente?
Sie dienen dazu, die Eigenkapitalbasis zu stärken, während gleichzeitig die steuerlichen Vorteile von Fremdkapital genutzt werden können.
Wie werden Wandelanleihen nach HGB bilanziert?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Regeln des Handelsgesetzbuches im Vergleich zu internationalen Standards.
Was ist der Unterschied zwischen IAS/IFRS und US-GAAP bei Wandelanleihen?
Die Arbeit analysiert die differenzierten Ansätze dieser Rechnungslegungssysteme hinsichtlich der Aufteilung in Eigen- und Fremdkapitalanteile.
Welchen Einfluss hat Basel II auf die Unternehmensfinanzierung?
Basel II verschärft die Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung, wodurch die Bonität und Eigenkapitalquote für die Zinskonditionen entscheidend werden.
Was ist Mezzanine-Kapital?
Mezzanine-Kapital ist eine Mischform der Finanzierung, die rechtlich oft Fremdkapital ist, wirtschaftlich aber Eigenkapitalcharakter hat.
- Quote paper
- Benjamin Hüttche (Author), 2007, Vertrags- und Bilanzrecht hybrider Finanzinstrumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72538