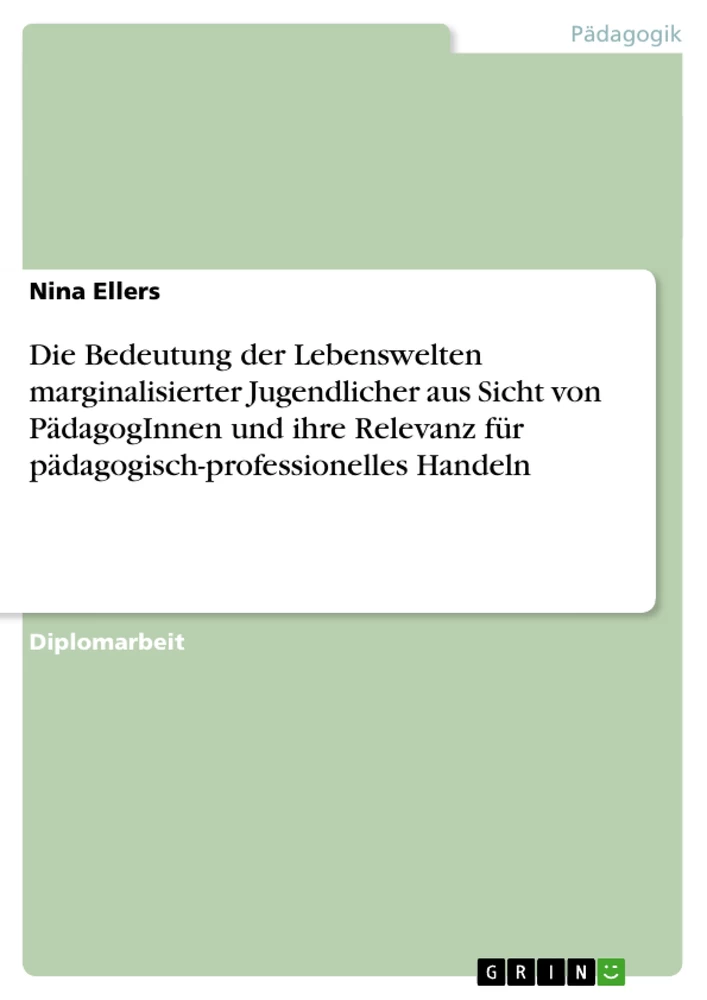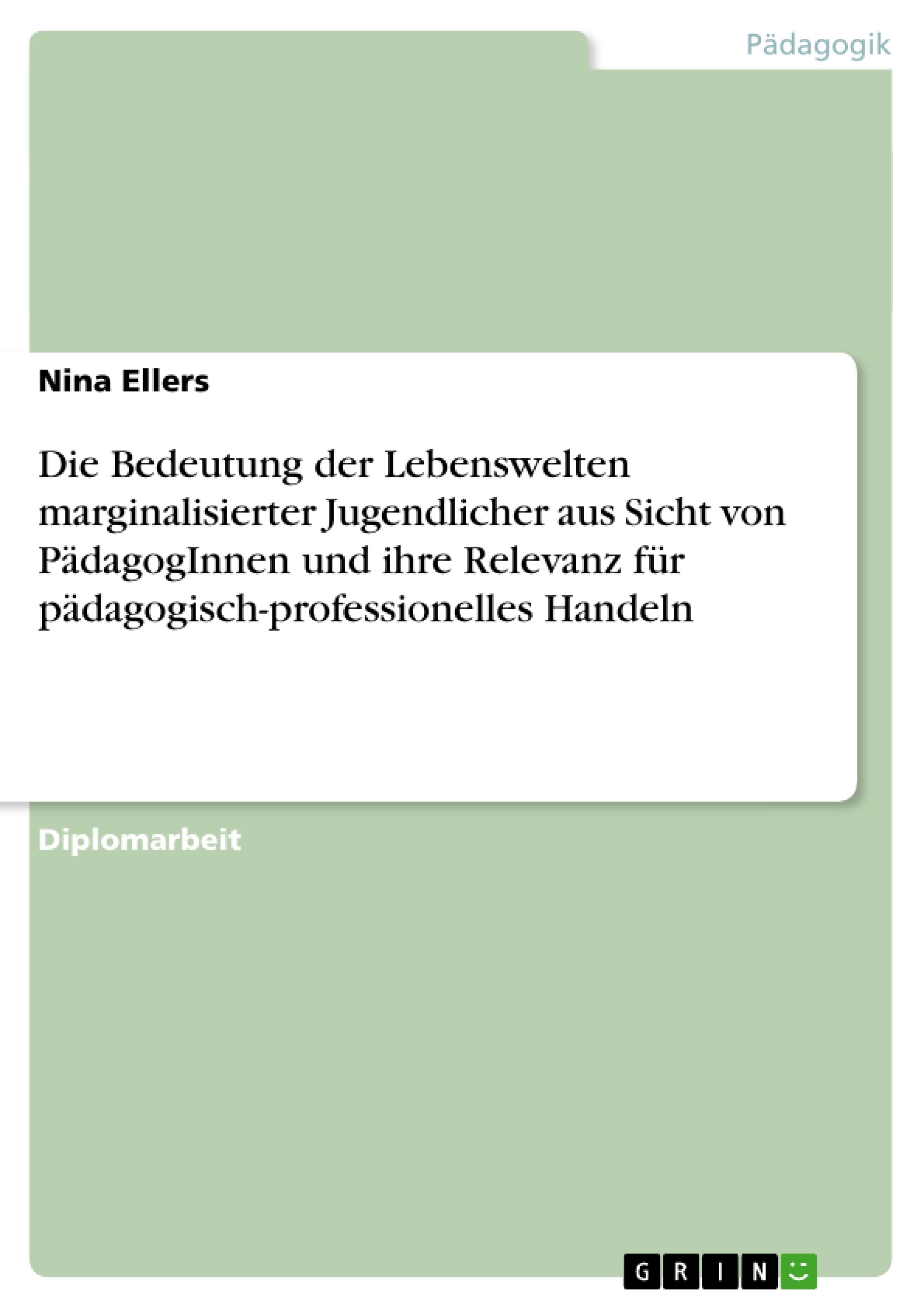Eine grundlegende Frage in der Erziehungswissenschaft – und
somit auch in der Sonderpädagogik – ist, was Inhalt und Aufgabe von
Erziehung ist, an welchen gesellschaftlichen Leitbildern sie sich
orientiert und aus welchen Gründen sich für die Vermittlung
bestimmter Werte entschieden wird.
Die Antwort lautet meist, dass man für das Leben erziehe, die Kinder
auf die Gesellschaft vorbereiten wolle bzw. müsse, so dass sie zu
einem verantwortungsbewussten und nützlichem Mitglied selbiger
würden und am gesellschaftlichen Leben mit so wenig
Einschränkungen wie möglich teilnehmen könnten.
Lebenswelten zeichnen sich dadurch aus, dass sie spezifische
Umgangs- und Gesprächsformen beinhalten, sind gekennzeichnet
durch spezifische Wege der Lebensgeschichte und Drehbücher –
schließlich resultieren aus ihnen signifikante Begründungs- bzw.
Rechtfertigungsmuster und Handlungsannahmen.
Wie sehen aber PädagogInnen selber die (ihnen meist fremden)
Lebenswelten ihrer Klientel welche Stellung nehmen sie in ihrer Arbeit ein, woher nehmen sie ihre Informationen und inwiefern ist dieseSichtweise von Bedeutung für ihre pädagogische Arbeit? Anliegen
dieser Arbeit ist es, diese Fragen, unter Zuhilfenahme der
Beschreibung persönlicher Erfahrungen von PädagogInnen, in Form
von leitfadengestützten Interviews, zu klären.
Grundlegend ist diesbezüglich, ob überhaupt oder wenn ja, welche
Unterschiede von PädagogInnen und Schülern wahrgenommen werden
und welche Probleme oder welche Möglichkeiten die eigene Sichtweise
auf divergente Lebenswelten bietet. Schwierigkeiten ergeben sich
dann, wenn gesellschaftliche Werte und Normen, Erwartungen und
Ziele nicht mehr eindeutig sind und Zweifel an der Sinnhaftigkeit der
Übertragung der Vorstellungen von PädagogInnen diesbezüglich auf
alle Individuen bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lebenswelten
- Theorien zur Lebenswelt
- Der Lebensweltbegriff in der Soziologie von Schütz und Habermas
- Organisation der Wahrnehmung durch Deutungsmuster
- Deutungsmusteranalyse – Erfassung des sozialen Sinns
- Der Habitusbegriff nach Bourdieu
- Die Theorie sozialer Ungleichheit nach Hradil
- Der Etikettierungsansatz - Labeling als eine Folge von Ungleichheiten in den Lebenswelten
- Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher
- Forschungsstand zu den Lebenslagen von Jugendlichen
- Strukturierung von Lebensläufen
- Auswirkungen der postindustriellen Sozialstruktur auf die Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher
- Armutslagen von Jugendlichen
- Lebenslagen von Migrantenjugendlichen
- Zur sozialen Identität türkischstämmiger Jugendlicher
- Migrationsfamilien und Einkommensarmut
- Die Negierung der Lebenswelt durch pädagogische Institutionen
- Vorstellungen Jugendlicher über deren Lebenswelt aus Sicht von PädagogInnen
- Empirischer Teil Lebenswelten Jugendlicher aus Sicht von PädagogInnen
- Erkenntnisinteresse
- Konzeption der Studie
- Datenerhebung
- Problemzentriertes Interview
- Zu den interviewten PädagogInnen
- Zur Aufbereitung der Daten
- Datenauswertung I
- Zirkuläres Dekonstruieren
- Auswertung der Einzelinterviews
- Datenauswertung II
- Der systematische Vergleich der Interviews
- Die komparative Paraphrasierung
- Interpretation der Ergebnisse
- Die Bedeutung der Sicht von PädagogInnen auf die Lebenswelten der Klientel für pädagogische Arbeit
- Grenzen und Möglichkeiten pädagogischer Einflussnahme im Hinblick auf divergente Lebenswelten
- Pädagogisch- professionelles Handeln in Form von Verstehen von Lebenswelt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher aus Sicht von PädagogInnen und deren Relevanz für pädagogisch-professionelles Handeln. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie PädagogInnen die Lebenswelten ihrer Schüler verstehen und welche Auswirkungen dies auf ihre pädagogische Arbeit hat.
- Die Analyse der Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher im Kontext von sozialer Ungleichheit und Armut
- Die Erforschung der Unterschiede zwischen der Lebenswelt von PädagogInnen und den Lebenswelten der Schüler
- Die Bedeutung des Verstehens der Lebenswelt für pädagogisch-professionelles Handeln
- Die Grenzen und Möglichkeiten pädagogischer Einflussnahme im Hinblick auf divergente Lebenswelten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Thematik der Lebenswelt und ihre Bedeutung für die pädagogische Arbeit beleuchtet. Im Anschluss werden verschiedene theoretische Ansätze zur Lebenswelt vorgestellt, insbesondere die Konzepte von Schütz und Habermas, Bourdieu sowie Hradil.
Kapitel 1 beleuchtet die Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher. Es werden verschiedene Aspekte der Lebenslagen von Jugendlichen, wie z.B. Armut, Migration und soziale Exklusion, thematisiert und die Auswirkungen der postindustriellen Sozialstruktur auf die Lebenswelten dieser Jugendlichen diskutiert.
Kapitel 2 beschreibt den empirischen Teil der Arbeit. Hierbei wird auf die Konzeption der Studie, die Datenerhebung mittels problemzentrierter Interviews sowie die Datenauswertung eingegangen. Die Interviews mit PädagogInnen werden anhand von zirkulärem Dekonstruieren und komparativer Paraphrasierung analysiert, um die Sichtweisen der PädagogInnen auf die Lebenswelten der Schüler zu erforschen.
Kapitel 3 interpretiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Bedeutung der Sicht von PädagogInnen auf die Lebenswelten ihrer Schüler sowie die Grenzen und Möglichkeiten pädagogischer Einflussnahme im Hinblick auf divergente Lebenswelten diskutiert.
Schließlich wird in Kapitel 4 das pädagogisch-professionelle Handeln im Kontext des Verstehens von Lebenswelten erörtert. Der Abschluss der Arbeit wird mit einem Fazit abgerundet.
Schlüsselwörter
Lebenswelt, marginalisierte Jugendliche, PädagogInnen, soziales Handeln, Ungleichheit, Armut, Migration, Bildung, Integration, interkulturelle Pädagogik, Pädagogik der Vielfalt, Verstehen.
- Citar trabajo
- Nina Ellers (Autor), 2007, Die Bedeutung der Lebenswelten marginalisierter Jugendlicher aus Sicht von PädagogInnen und ihre Relevanz für pädagogisch-professionelles Handeln, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72688