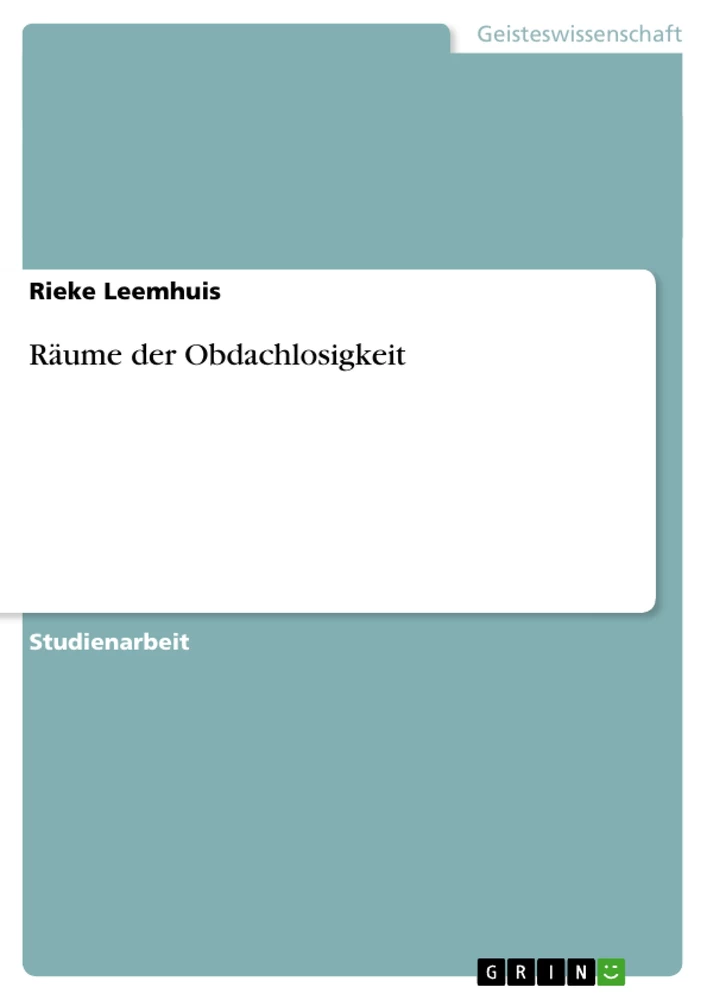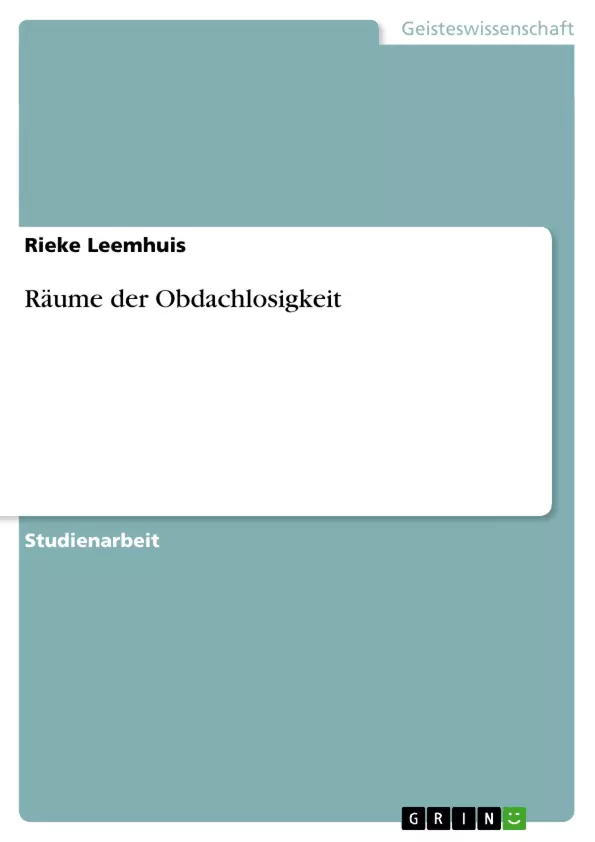1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit stellt die Ausarbeitung eines Referats zum Thema Kultur der Obdachlosigkeit dar, das ich im „Seminar Raumkonzepte ethnologischer Stadtforschung“ gehalten habe.
Die Studie „Kultur der Obdachlosigkeit in der Hamburger Innenstadt“ bildet die Grundlage dieser Arbeit. Diese Studie untersucht eine bestimmte Gruppe von Obdachlosen (die „Budengruppe“) in einem begrenzten Feld. Von dieser Arbeit ausgehend möchte ich darstellen wie und wo Raum innerhalb dieser Untersuchung eine Rolle spielt. Dann werde ich auf die Vertreibung Obdachloser aus dem öffentlichen Raum eingehen. Zunächst sollen theoretischen Grundlagen dieser Vertreibung und Ausgrenzung erläutert werden. Dann werde ich Umlenkungs- und Vertreibungsstrategien am Beispiel der untersuchten „Buden Gruppe“ darstellen. Abschließend möchte ich die Ergebnisse mit der Theorie Bourdieus zusammenführen und hier mein Augenmerk auf den sozialen Raum und den Zusammenhang zwischen Macht und Raum legen. Aufgezeigt werden soll, welche Räume Obdachlose besetzten, welche Funktionen Räume haben können, wie konkrete Orte aussehen, die im Leben Obdachloser eine Rolle spielen und wo, wie und aus welchen Gründen es zu Ausgrenzung aus Räumen oder im Zusammenhang mit Räumen kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ethnologische Felduntersuchung
- Raum
- Der Funktionswechsel von Raum
- Territorien und Abgrenzung
- Die Platten
- Die Buden
- Theoretische Grundlage (räumlicher) Ausgrenzung
- Umlenkung und Vertreibung der Budengruppe
- Zusammenführung der Ergebnisse mit der Theorie Bourdieus
- Schlusswort
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Kultur der Obdachlosigkeit anhand einer ethnologischen Feldstudie in der Hamburger Innenstadt. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Rolle des Raumes innerhalb dieser Kultur und den Auswirkungen der Vertreibung Obdachloser aus dem öffentlichen Raum. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Ausgrenzung, analysiert Umlenkung- und Vertreibungsstrategien sowie die Zusammenführung der Ergebnisse mit der Theorie Bourdieus.
- Rolle des Raumes in der Kultur der Obdachlosigkeit
- Ausgrenzung und Vertreibung Obdachloser aus dem öffentlichen Raum
- Theoretische Grundlagen der Ausgrenzung
- Umlenkung- und Vertreibungsstrategien
- Zusammenführung der Ergebnisse mit der Theorie Bourdieus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Hausarbeit vor und beschreibt die Grundlage der Studie „Kultur der Obdachlosigkeit in der Hamburger Innenstadt“. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Rolle des Raumes in der Kultur der Obdachlosigkeit und die damit verbundene Ausgrenzung konzentriert.
- Die ethnologische Felduntersuchung: Dieser Abschnitt beschreibt die Feldforschung, die der Studie „Kultur der Obdachlosigkeit in der Hamburger Innenstadt“ zugrunde liegt. Er erläutert die Methoden der Untersuchung, die Untersuchungseinheit – die „Budengruppe“ – und die Rolle der Jahrmarktbude als Anziehungspunkt für die Obdachlosen.
- Raum: In diesem Kapitel wird die Bedeutung des Raumes für die Obdachlosen näher betrachtet. Es wird untersucht, wie die Innenstadt als Wohnort und Schlafstätte genutzt wird, und die unterschiedlichen Funktionen des Raumes tagsüber und nachts werden hervorgehoben.
- Der Funktionswechsel von Raum: Dieser Abschnitt beschreibt den Wechsel der Funktion des städtischen Raumes von Konsumort tagsüber zu Schlafstätte für Obdachlose nachts. Er zeigt auf, wie die Obdachlosen sich in den öffentlichen Raum integrieren und gleichzeitig eine „Parallelwelt“ schaffen.
- Territorien und Abgrenzung: Dieser Teil betrachtet die Territorialität und die Abgrenzung zwischen verschiedenen Gruppen von Obdachlosen. Er beleuchtet die Ortsgebundenheit der Obdachlosen, die Unterscheidung zwischen „Alkis“ und „Junkies“ sowie die Diskriminierung osteuropäischer Obdachloser.
- Theoretische Grundlage (räumlicher) Ausgrenzung: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen der räumlichen Ausgrenzung dar. Er erläutert die Umlenkung- und Vertreibungsstrategien der Obdachlosen, die durch die soziale und räumliche Ausgrenzung durch die Gesellschaft entstehen.
- Zusammenführung der Ergebnisse mit der Theorie Bourdieus: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie mit der Theorie Bourdieus in Bezug auf den sozialen Raum und den Zusammenhang zwischen Macht und Raum zusammengeführt. Es wird untersucht, welche Räume die Obdachlosen besetzen und welche Funktionen diese Räume für sie haben.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen der ethnologischen Stadtforschung, der Kultur der Obdachlosigkeit, der räumlichen Ausgrenzung und der Theorie Bourdieus. Sie analysiert den Funktionswechsel von Raum, die Territorialität, die Abgrenzung zwischen Gruppen, die Umlenkung- und Vertreibungsstrategien sowie den sozialen Raum und die Machtstrukturen, die die Lebenswelt von Obdachlosen prägen.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie zur Kultur der Obdachlosigkeit?
Die Studie analysiert die „Budengruppe“ in der Hamburger Innenstadt und untersucht, wie Obdachlose den öffentlichen Raum nutzen und daraus vertrieben werden.
Wie verändert sich die Funktion des Raumes für Obdachlose?
Ein Raum, der tagsüber als Konsumort dient, wird nachts zur Schlafstätte („Platte“), was einen funktionalen Wechsel des städtischen Raumes darstellt.
Was bedeutet „Territorialität“ bei Obdachlosen?
Es beschreibt die Abgrenzung und Ortsgebundenheit verschiedener Gruppen, etwa die Unterscheidung zwischen Alkis, Junkies oder osteuropäischen Obdachlosen.
Welche Rolle spielt die Theorie von Pierre Bourdieu in dieser Arbeit?
Bourdieus Konzepte zum sozialen Raum werden genutzt, um den Zusammenhang zwischen Macht, Raum und der Ausgrenzung Obdachloser zu erklären.
Warum kommt es zur Vertreibung aus dem öffentlichen Raum?
Die Arbeit zeigt auf, dass Umlenkungs- und Vertreibungsstrategien oft dazu dienen, Obdachlose aus den Sichtbereichen der Konsumgesellschaft zu entfernen.
- Citation du texte
- Rieke Leemhuis (Auteur), 2006, Räume der Obdachlosigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72722