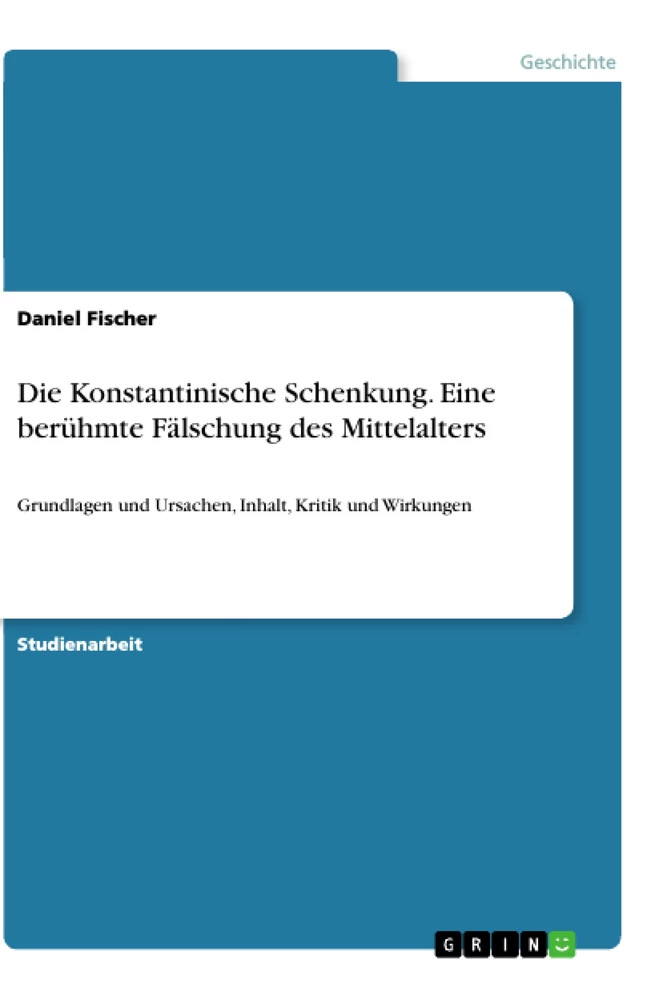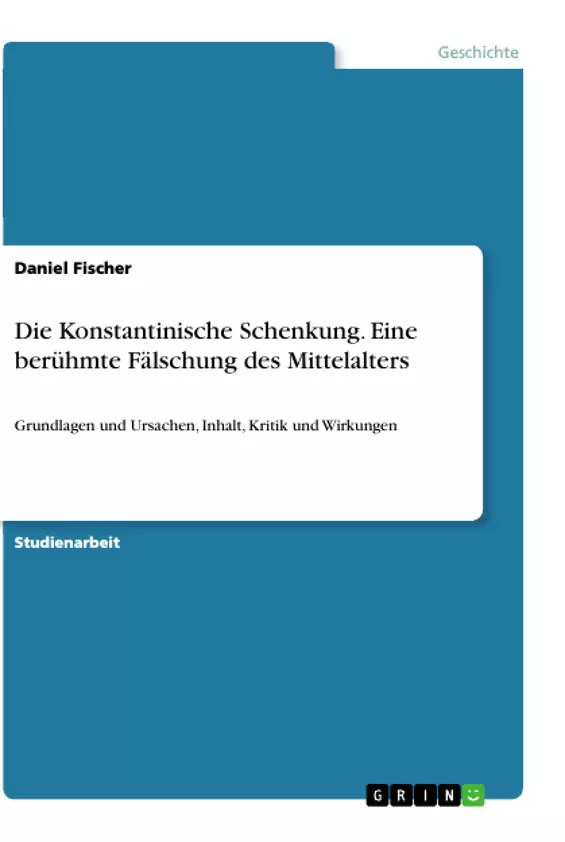Die Arbeit beschäftigt sich mit Kaiser Konstantin dem Großen, der dem Christentum zur Werdung als Staatsreligion im Römischen Reich verholfen hat. Die Konstantinische Schenkung, eine Fälschung des frühen Mittelalters, wurde von den Päpsten bis zum Ende des Mittelalters machtpolitisch eingesetzt, um den Primat des päpstlichen Stuhles gegenüber den weltlichen Herrschern zu verteidigen. In der Renaissance meldeten sich dann erste kritische Stimmen zu Wort, die das Dokument anzuzweifeln begannen. Der Durchbruch gelang dann schließlich im 19. Jahrhundert.
Die Arbeit beleuchtet somit den Zeitraum zwischen 300 n. Chr. und 1900.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Exkurs I: Die Frage nach geschichtlicher Objektivität
- "Der Historiker und seine Fakten"
- Überblick und Auswahl der Literatur
- Unsere Hauptquelle? Die Rolle des Eusebius
- Exkurs II: Konstantin der Große und die Entwicklung des Christentums
- Konstantin der Große und seine Zeit
- Döllinger und das Papsttum
- Ignaz von Döllinger
- Döllinger (I.): Das Papsttum
- Silvesterlegende und Konstantinische Schenkung
- Vorbemerkungen und Entstehungsgründe
- Schenkungen
- Die Silvesterlegende und die Kontroverse um die Taufe Konstantins
- Die Konstantinische Schenkung
- eine sichere Überlieferung?
- Inhalt: "Constitutum Constantini"
- Die Kritik an der Echtheit der Urkunde
- Vorbemerkungen
- Die Kritiker an der Urkunde
- Nikolaus von Kues (1401-1464)
- Reginald Pecock (1395-1459)
- Lorenzo Valla (1407-1457)
- Exkurs III: Niccolò Machiavelli (1469-1527)
- Ignaz von Döllinger (II.): Die Papstfabeln des Mittelalters
- Abschlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstantinische Schenkung, eine berühmte Fälschung des Mittelalters. Sie beleuchtet die Grundlagen und Ursachen ihrer Entstehung, ihren Inhalt, die Kritik an ihrer Echtheit und ihre Auswirkungen. Die Arbeit analysiert die historische Objektivität und die Rolle der Quellen, insbesondere die Bedeutung des Eusebius. Sie beleuchtet die Entwicklung des Christentums unter Konstantin dem Großen und die Rolle des Papsttums in diesem Prozess. Darüber hinaus geht die Arbeit auf die Silvesterlegende und die Kontroverse um die Taufe Konstantins ein. Der Fokus liegt auf der Kritik an der Konstantinischen Schenkung und den Argumenten wichtiger Kritiker wie Nikolaus von Kues, Reginald Pecock und Lorenzo Valla.
- Die Konstantinische Schenkung als Fälschung des Mittelalters
- Die Rolle der Quellen und die Frage der geschichtlichen Objektivität
- Die Entwicklung des Christentums unter Konstantin dem Großen
- Die Silvesterlegende und die Taufe Konstantins
- Die Kritik an der Echtheit der Konstantinischen Schenkung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Rahmen und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Es folgt ein Exkurs, der die Frage der geschichtlichen Objektivität behandelt, die Rolle der Quellen untersucht und einen Überblick über die relevanten Literatur gibt. Im zweiten Exkurs wird die Bedeutung Konstantins des Großen für die Entwicklung des Christentums beleuchtet. Hier werden die Zeit Konstantins, die Rolle des Papsttums und die Bedeutung von Ignaz von Döllinger behandelt. Das Kapitel über die Silvesterlegende und die Konstantinische Schenkung behandelt die Entstehung und den Inhalt der Fälschung sowie die Kontroverse um die Taufe Konstantins. Schließlich wird die Kritik an der Echtheit der Konstantinischen Schenkung analysiert, wobei die Argumente von Nikolaus von Kues, Reginald Pecock und Lorenzo Valla im Detail betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Konstantinische Schenkung, Fälschung, Mittelalter, Geschichte, Objektivität, Quellen, Eusebius, Konstantin der Große, Christentum, Papsttum, Silvesterlegende, Taufe, Kritik, Nikolaus von Kues, Reginald Pecock, Lorenzo Valla, Döllinger.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Konstantinische Schenkung?
Es handelt sich um eine mittelalterliche Urkunde, die vorgab, Kaiser Konstantin habe dem Papst die Herrschaft über Rom und das weströmische Reich übertragen.
Warum wurde das Dokument gefälscht?
Um den Primat des päpstlichen Stuhles gegenüber weltlichen Herrschern machtpolitisch zu legitimieren und zu verteidigen.
Wer bewies die Unechtheit der Urkunde?
Lorenzo Valla gelang im 15. Jahrhundert durch sprachliche Analyse der wissenschaftliche Nachweis der Fälschung.
Was besagt die Silvesterlegende?
Die Legende erzählt von der Heilung Konstantins vom Aussatz durch Papst Silvester I. und seiner anschließenden Taufe, was die Grundlage für die Schenkungs-Erzählung bildete.
Welche Rolle spielte Eusebius von Caesarea?
Eusebius war der Biograph Konstantins; seine Berichte sind eine Hauptquelle für die Zeit, werfen aber Fragen zur historischen Objektivität auf.
- Citar trabajo
- Daniel Fischer (Autor), 2005, Die Konstantinische Schenkung. Eine berühmte Fälschung des Mittelalters, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72741