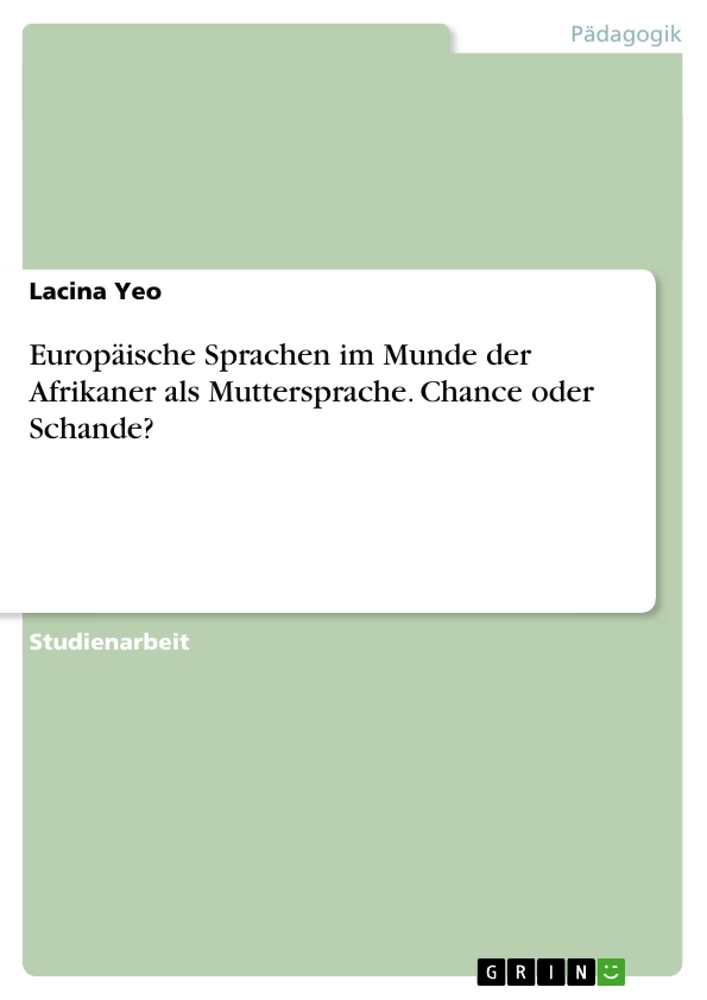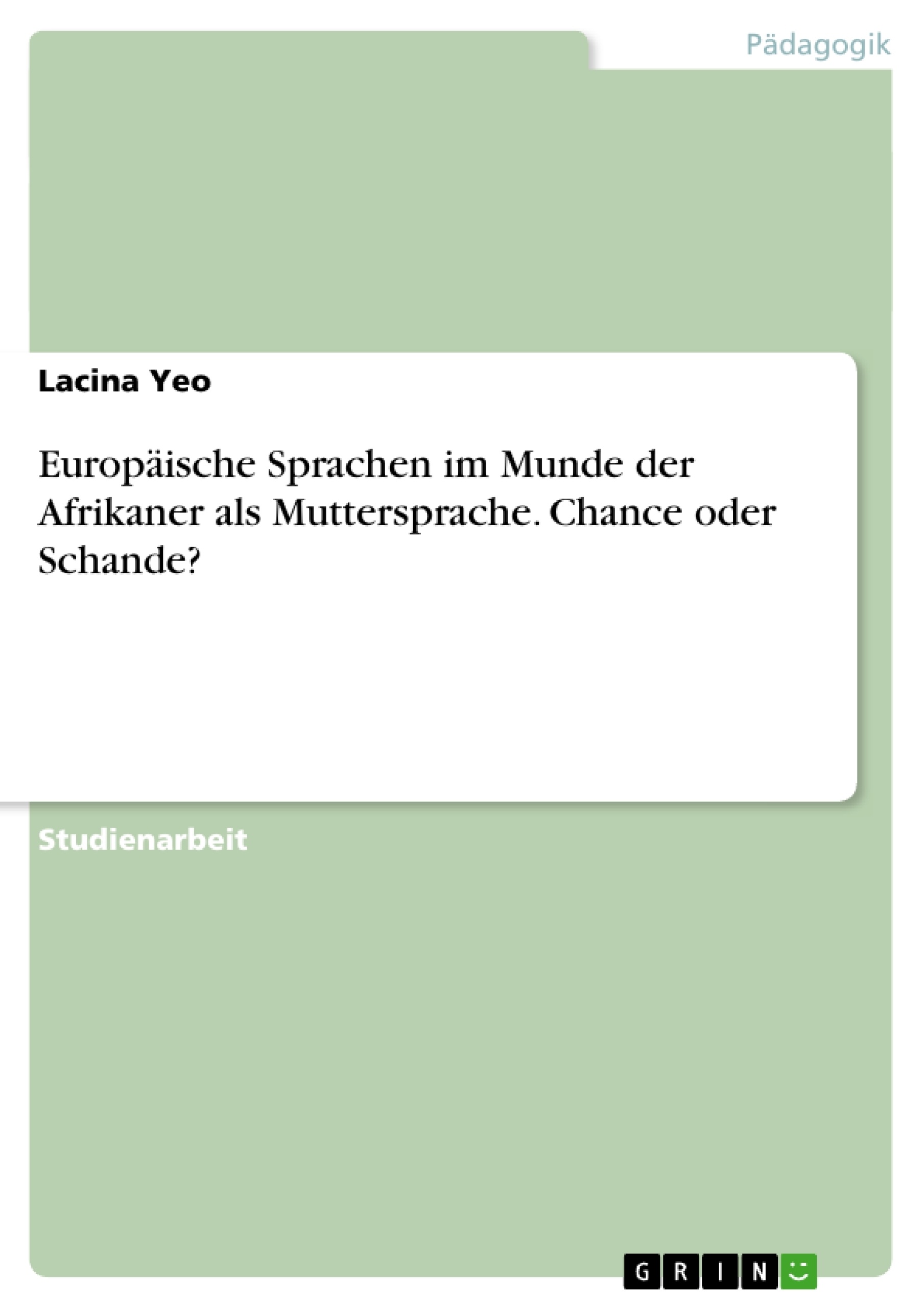Ich wollte typisch Neger sein, das war nicht mehr möglich. Ich wollte weiß sein - das war eher zum Lachen1
Die Sprache stellt eines der fundamentalsten identitätsstiftenden Merkmale des Menschen dar.
An ihr läßt sich die kulturelle Eigenständigkeit eines Volkes ablesen:
In jeder Sprache gibt es eine Anzahl Wörter, für welche andere Sprachen überhaupt nichts Entsprechendes haben
[...] Daher kann man auch nicht aus einer Sprache in die andere übersetzen, ohne dass ein unübersetzbarer Rest
bleibt [...]
Zwei verschiedene Sprachen sind zwei verschiedene Weltansichten2
Große Dichter und Philosophen wie Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), Johann
Gottfried von Herder (1744-1803), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Jean Paul
(1763-1825), Wilhelm von Humboldt (1767-1835) und Arthur Schopenhauer (1788-1860)
stellten in aller Deutlichkeit die These auf, dass Sprache und kulturelle Identität eng
aufeinander bezogen sind.
Dem Gebrauch europäischer Sprachen als Verkehrs-, Amts- und Unterrichtssprachen
in Afrika liegt zweifelsohne die wohl bekannte, viel diskutierte und immer wiederkehrende
Thematik der Kolonisierung dieses Kontinents durch europäische Mächte wie Frankreich,
England, Deutschland, Portugal etc. im 19. Jahrhundert3 zugrunde.
Die gezielte wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten Territorien, die durch eine unerbittliche
Waffengewalt von Kolonialtruppen gegen einheimische Widerstandskämpfer realisiert
werden konnte, ging mit einer ausgeprägten niederwerfenden Kulturpolitik einher, in der das
Erlernen der Sprache des Kolonialherren durch den Kolonisierten den Mittelpunkt einnahm,
denn:
Unter „zivilisierten“ Nationen, zwischen denen kein größeres Machtgefälle besteht, mag es für ein Zeichen der
Höfflichkeit und gegenseitigen Respekts gelten, die Sprache des anderen zu lernen [...], zwischen der Übermacht
des Kolonisators und der Ohmacht des Kolonisierten ist kein Platz für solche Höflichkeiten. Der Unterlegene muß
sich mit dem Sieger arrangieren. Will er sich Gehör verschaffen, muß er seine Sprache lernen, Zeit und Mühe investieren, um Zutritt in die Sphäre der Macht zu bekommen. Der Kolonisator, der oft nur für eine begrenzte
Dauer im Lande bleibt, hat nicht die Zeit, um die (von ihm meist verachteten) Sprachen der „Eingeborenen“ zu
lernen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einblick
- 2. Befürworter
- 3. Skeptiker
- 4. Abschlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Verwendung europäischer Sprachen als Verkehrs-, Amts- und Unterrichtssprachen in Afrika nach der Kolonialzeit. Die Autorin analysiert die dabei auftretenden Chancen und Herausforderungen für die afrikanischen Gesellschaften.
- Der Einfluss der Kolonialisierung auf die Sprachpolitik in Afrika
- Die Rolle der Sprache als Instrument der Assimilation und Unterwerfung
- Die Bedeutung von Sprachpolitik für die kulturelle Identität Afrikas
- Praktische und realpolitische Faktoren der Sprachpolitik
- Der Konflikt zwischen der Förderung afrikanischer Sprachen und der Dominanz europäischer Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einblick: Der einführende Abschnitt etabliert die zentrale These der Arbeit: Die Einführung europäischer Sprachen in Afrika als Folge der Kolonialisierung stellt ein komplexes und vielschichtiges Problem dar, das sowohl Chancen als auch Nachteile mit sich bringt. Es wird der fundamentale Zusammenhang zwischen Sprache und kultureller Identität betont, wobei Zitate von bedeutenden Denkern wie Leibniz und Herder die These unterstützen. Der Abschnitt skizziert den historischen Kontext der Kolonialisierung und die Rolle der Sprache als Instrument der Macht und Unterwerfung. Das Zitat von Frantz Fanon verdeutlicht die existenzielle Krise des Afrikaners angesichts der kolonialen Sprachherrschaft. Die gezielte Unterdrückung afrikanischer Sprachen und die Durchsetzung europäischer Sprachen als Mittel der Assimilation werden als zentrale Problematik eingeführt.
2. Befürworter: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext - Erstellung einer fiktiven Zusammenfassung): Dieses Kapitel hätte wahrscheinlich Argumente von Befürwortern der Verwendung europäischer Sprachen in Afrika beleuchtet. Möglicherweise wurden wirtschaftliche Vorteile, verbesserte Bildungsmöglichkeiten durch Zugang zu globalem Wissen und vereinfachte Kommunikation in der globalisierten Welt als positive Aspekte dargestellt. Es wäre wahrscheinlich auf den Nutzen für den Zugang zu internationalen Märkten und die Integration in die globale Wirtschaft eingegangen. Auch der Aspekt einer gemeinsamen Sprache zur nationalen Einheit, trotz der ethnischen Diversität, hätte möglicherweise eine Rolle gespielt. Die Position der Befürworter hätte wahrscheinlich die Notwendigkeit der Adaption an die globalisierten Bedingungen hervorgehoben, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
3. Skeptiker: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext - Erstellung einer fiktiven Zusammenfassung): Dieses Kapitel hätte vermutlich die Gegenargumente der Kritiker der durch die Kolonialisierung bedingten Sprachpolitik in Afrika dargestellt. Die negativen Folgen der kulturellen und sprachlichen Unterdrückung für die afrikanische Identität wären wahrscheinlich im Detail beleuchtet worden, mit Fokus auf den Verlust traditioneller Wissensformen und kultureller Werte. Der Verlust der Muttersprache und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der Kommunikation und dem Erhalt der kulturellen Identität wären wahrscheinlich als zentrale Argumente angeführt worden. Die Skeptiker hätten möglicherweise auf die Notwendigkeit der Revitalisierung afrikanischer Sprachen und die Bedeutung der sprachlichen und kulturellen Diversität hingewiesen.
Schlüsselwörter
Kolonialismus, Sprache, Afrika, Assimilation, Kultur, Identität, Sprachpolitik, UNESCO, Europäische Sprachen, Afrikanische Sprachen, Akkulturation, Macht, Unterwerfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen europäischer Sprachen in Afrika nach der Kolonialzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Verwendung europäischer Sprachen als Verkehrs-, Amts- und Unterrichtssprachen in Afrika nach der Kolonialzeit. Sie analysiert die Chancen und Herausforderungen für die afrikanischen Gesellschaften, die sich daraus ergeben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Kolonialisierung auf die Sprachpolitik in Afrika, der Rolle der Sprache als Instrument der Assimilation und Unterwerfung, der Bedeutung von Sprachpolitik für die kulturelle Identität Afrikas, praktischen und realpolitischen Faktoren der Sprachpolitik und dem Konflikt zwischen der Förderung afrikanischer Sprachen und der Dominanz europäischer Sprachen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einblick, 2. Befürworter, 3. Skeptiker und 4. Abschlussbemerkungen. Die Kapitel 2 und 3 enthalten fiktive Zusammenfassungen, da der Ausgangstext diese nicht beinhaltet.
Was wird im einführenden Kapitel (Einblick) behandelt?
Der einführende Abschnitt stellt die zentrale These auf: Die Einführung europäischer Sprachen nach der Kolonialisierung ist ein komplexes Problem mit Chancen und Nachteilen. Es wird der Zusammenhang zwischen Sprache und kultureller Identität betont und der historische Kontext der Kolonialisierung sowie die Rolle der Sprache als Machtinstrument beleuchtet. Die Unterdrückung afrikanischer Sprachen und die Durchsetzung europäischer Sprachen als Mittel der Assimilation werden als zentrale Problematik eingeführt.
Was wird (fiktiv) im Kapitel "Befürworter" behandelt?
Dieses Kapitel (fiktive Zusammenfassung) würde wahrscheinlich Argumente von Befürwortern der Verwendung europäischer Sprachen beleuchten, z.B. wirtschaftliche Vorteile, verbesserte Bildungsmöglichkeiten durch Zugang zu globalem Wissen, vereinfachte globale Kommunikation und den Nutzen für den Zugang zu internationalen Märkten. Auch der Aspekt einer gemeinsamen Sprache zur nationalen Einheit könnte eine Rolle spielen.
Was wird (fiktiv) im Kapitel "Skeptiker" behandelt?
Dieses Kapitel (fiktive Zusammenfassung) würde vermutlich die Gegenargumente der Kritiker darstellen. Die negativen Folgen der kulturellen und sprachlichen Unterdrückung für die afrikanische Identität, der Verlust traditioneller Wissensformen und kultureller Werte sowie der Verlust der Muttersprache und die damit verbundenen Schwierigkeiten würden wahrscheinlich als zentrale Argumente angeführt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kolonialismus, Sprache, Afrika, Assimilation, Kultur, Identität, Sprachpolitik, UNESCO, Europäische Sprachen, Afrikanische Sprachen, Akkulturation, Macht, Unterwerfung.
- Arbeit zitieren
- Lacina Yeo (Autor:in), 2002, Europäische Sprachen im Munde der Afrikaner als Muttersprache. Chance oder Schande?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7281