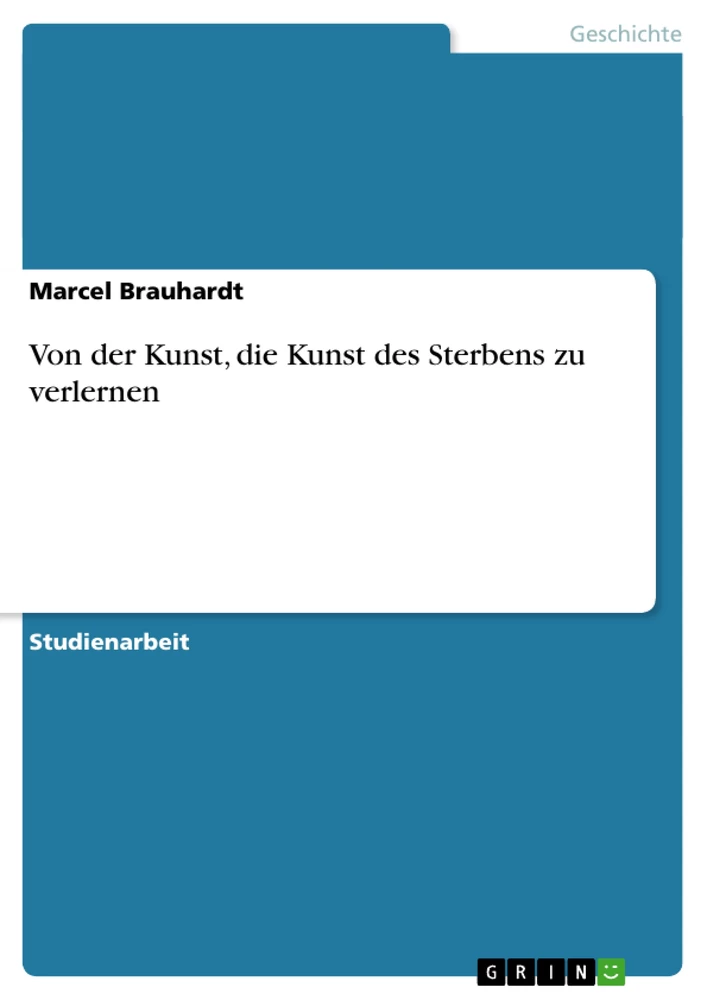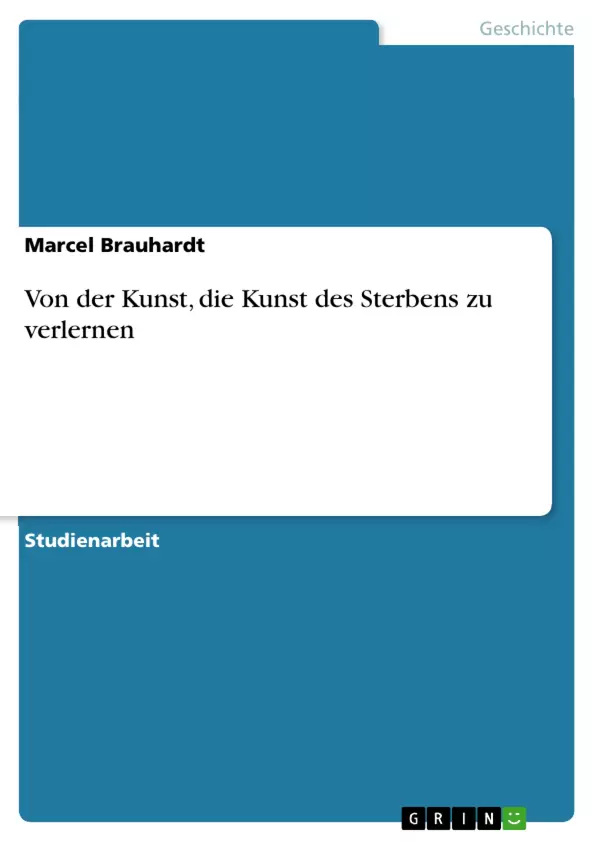Vieles von dem, was die Menschen im Mittelalter beschäftigte und unmittelbarer Bestandteil ihres Lebens war, erscheint heute oftmals unwichtig oder ist einfach in Vergessenheit geraten. Traditionen und Bräuche sind, wie so vieles andere, denselben konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt und werden nicht zuletzt lediglich aufgrund ihrer Nützlichkeit hin und wieder zum Gegenstand aktuellen Interesses. Der Tod aber ist bis heute ein allgegenwärtiger Begleiter einer jeden Zeit, einer jeden Kultur, ob nun bewusst oder unbewusst, ob willkommen oder gefürchtet. 1 Die Vergänglichkeit des irdischen Lebens wurde über Jahrtausende stets unterschiedlich bewertet. Dennoch gibt es eine klare Tendenz, die vor allem in der westlichen Welt sehr deutlich erkennbar ist. Bis in die Gegenwart hat sich eine Entwicklung vollzogen, deren wesentlicher Bestandteil das Ausblenden des Todes aus dem alltäglichen Leben ist und deren Resultat eine Tabuisierung von Sterben und Tod als unerwünschtes und doch wissentlich unvermeidliches Ende menschlicher Existenz zur Folge hatte. 2 Doch diese Art des Umgangs mit dem Tod ist in Europa nicht immer so gewesen. Vor allem die enge Bindung großer Teile der Bevölkerung an den christlichen Glauben half den mittelalterlichen Menschen, sich mit ihrer eigenen Vergänglichkeit bewusster auseinanderzusetzen. Warum aber fällt es der heutigen Gesellschaft vergleichsweise schwer, ähnlichen oder gar denselben Strategien zu vertrauen, wie dies frühere Generationen taten? Das Wissen um Sterben und Tod ist heute sehr viel umfangreicher als noch vor 500 Jahren und dennoch scheint es, als wenn all diese Erkenntnisse nicht dazu beitragen konnten, eine Haltung gegenüber dem Tod zu entwickeln, die vergleichbar wäre mit der »Ars Moriendi« 3, wie sie die mittelalterlichen Menschen kannten. Die vorliegende Arbeit soll neben einer Einführung in die ideelle Charakteristik der Kunst des Sterbens, vor allem Aufschluss geben über die Art und Weise , wie ihre Inhalte transportiert und den Menschen vermittelt wurden. Darüber hinaus soll anhand verschiedener Fragestellungen zumindest ansatzweise versucht werden, die Bedeutung der »Ars Moriendi« insgesamt zu kennzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorwort
- Definitionen und Fragestellungen
- Die »Ars Moriendi« in der Literatur
- Die ersten Trost spendenden Schriften
- Die Blockbücher und die Bilder - Ars......
- Inhaltliche Struktur der Erbauungsliteratur
- Verbreitung und Rezeption
- Hintergrund und Intention der Kunst des Sterbens
- These
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der »Ars Moriendi«, der Kunst des Sterbens, im Mittelalter und analysiert die Art und Weise, wie diese im Leben der Menschen präsent war. Die Arbeit soll Aufschluss geben über die Verbreitung und Rezeption der Kunst des Sterbens, sowie ihre Bedeutung in der mittelalterlichen Gesellschaft.
- Die Entwicklung des Todes als Tabuthema in der westlichen Welt
- Die Bedeutung des christlichen Glaubens im Umgang mit dem Tod
- Die Rolle der »Ars Moriendi« in der Vorbereitung auf den Tod
- Die verschiedenen Formen der Verbreitung und Rezeption der Kunst des Sterbens
- Die Intention und der ideelle Charakter der »Ars Moriendi«
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Relevanz der »Ars Moriendi« im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft heraus. Es beleuchtet die Unterschiede im Umgang mit dem Tod in verschiedenen Kulturen und die besondere Bedeutung des christlichen Glaubens im Mittelalter. Des Weiteren wird die Frage aufgeworfen, warum die heutige Gesellschaft Schwierigkeiten hat, sich mit der »Ars Moriendi« auseinanderzusetzen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der »Ars Moriendi« in der Literatur. Es analysiert die frühen Trost spendenden Schriften, die Entstehung der Blockbücher und die Bilder in der »Ars Moriendi«, sowie die inhaltliche Struktur der Erbauungsliteratur. Darüber hinaus werden Verbreitung und Rezeption der »Ars Moriendi« im Mittelalter diskutiert.
Das dritte Kapitel untersucht den Hintergrund und die Intention der Kunst des Sterbens. Es beleuchtet die These, dass die »Ars Moriendi« eine Art Handlungsanleitung für den Umgang mit dem Tod war, die den Menschen helfen sollte, ein gottwohlgefälliges Sterben zu erreichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ars Moriendi, Kunst des Sterbens, Tod, Mittelalter, Glaube, christlicher Glaube, Erbauungsliteratur, Blockbücher, Bilder, Verbreitung, Rezeption, Intention, These, Schlussbetrachtung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Ars Moriendi"?
"Ars Moriendi" ist lateinisch für "Die Kunst des Sterbens". Es handelt sich um eine mittelalterliche Tradition und Literaturform, die den Gläubigen half, sich auf ein gottwohlgefälliges Ende vorzubereiten.
Wie unterscheidet sich der Umgang mit dem Tod heute vom Mittelalter?
Während der Tod im Mittelalter allgegenwärtig und religiös eingebettet war, wird er in der modernen westlichen Welt oft tabuisiert und aus dem alltäglichen Leben ausgeblendet.
Was sind Blockbücher im Kontext der Ars Moriendi?
Blockbücher waren frühe illustrierte Druckwerke, die durch Bilder und kurze Texte auch der leseunkundigen Bevölkerung die Regeln des richtigen Sterbens vermittelten.
Welche Rolle spielte der christliche Glaube beim Sterben?
Der Glaube bot den Menschen Strategien zur Bewältigung der Todesangst und sah das Sterben als Übergang in ein jenseitiges Leben, auf das man sich moralisch vorbereiten musste.
Was war die Intention der Erbauungsliteratur?
Sie diente als Handlungsanleitung, um Versuchungen im Sterbebett (wie Verzweiflung oder Hochmut) zu widerstehen und die Seele zu retten.
- Citation du texte
- Marcel Brauhardt (Auteur), 2006, Von der Kunst, die Kunst des Sterbens zu verlernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72888