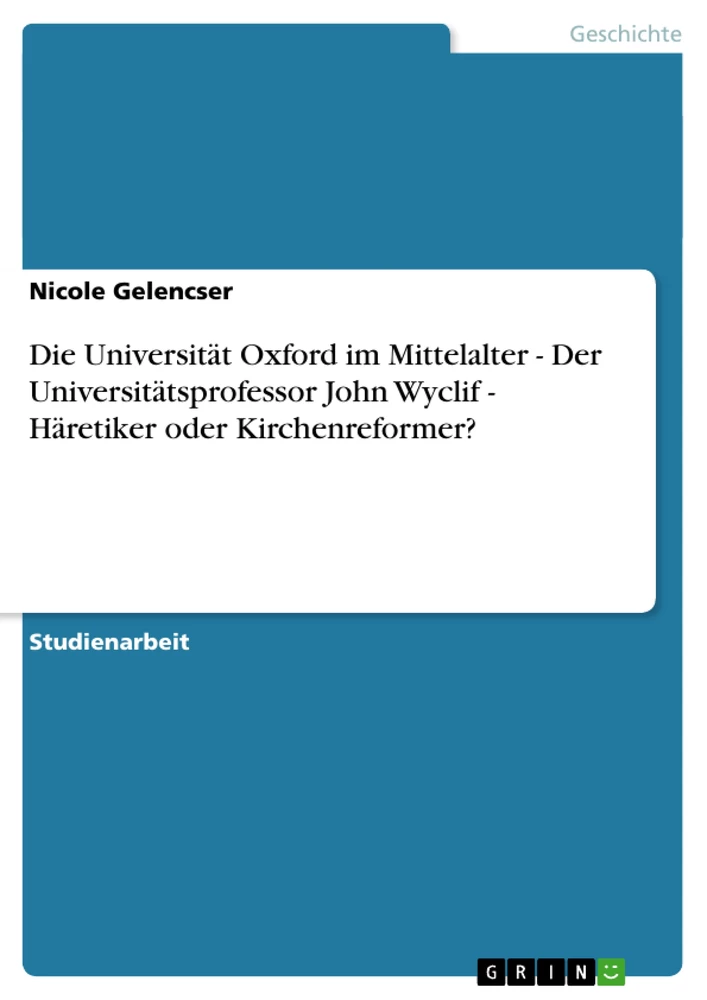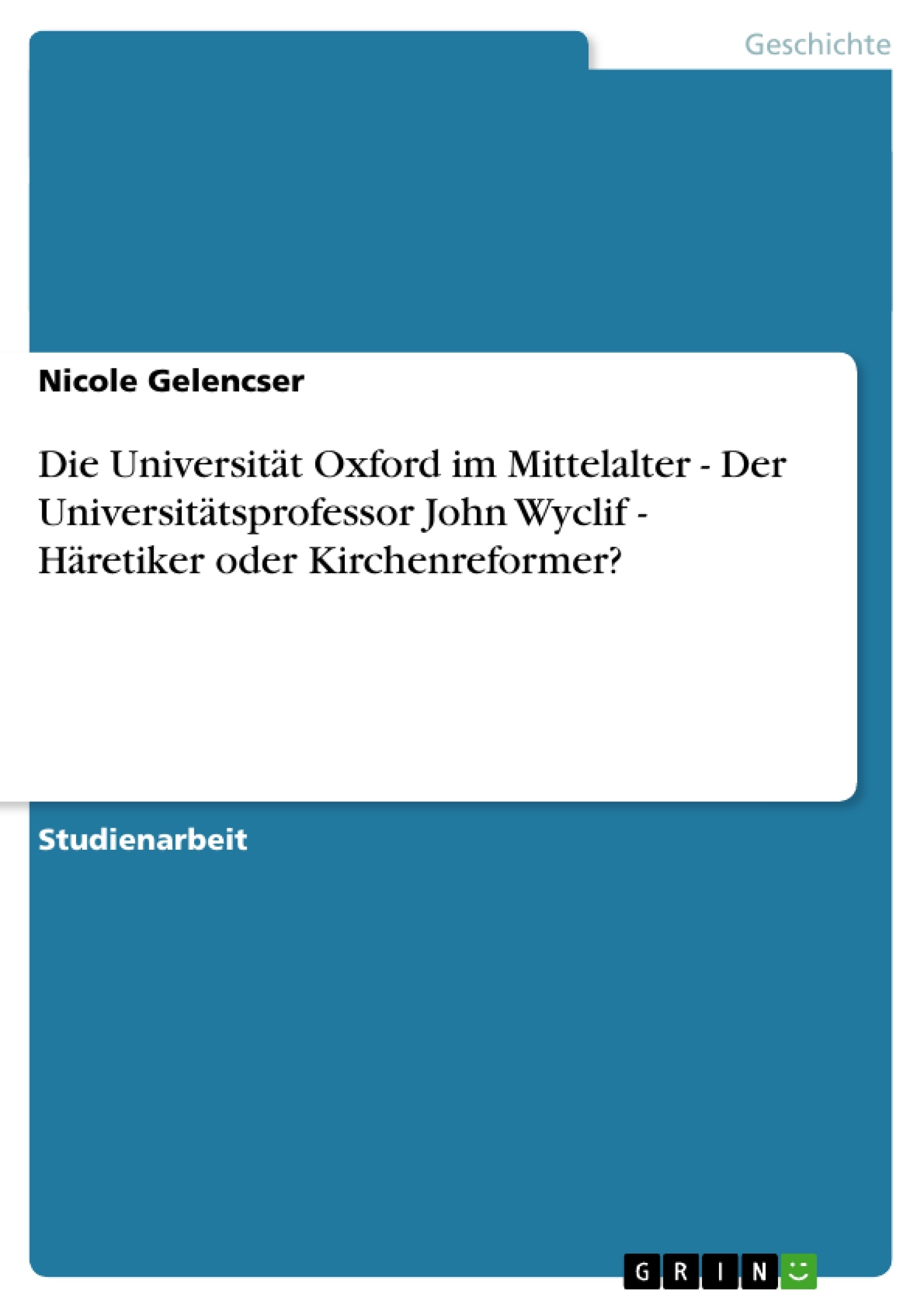Unendlich grüne Wiesen, die zum Kricketspielen einladen, weiße Kaninchen mit Taschenuhren und Teegesellschaften ohne Tee und Gesellschaft – und gibt es dennoch einmal Tee, dann nur solchen, der die magische Kraft besitzt den Teetrinker in einen Riesen oder einen Zwergen zu verwandeln. Ob Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland sich von der feucht-nebligen Landschaft der Oxford umgebenden Flussauen hat inspirieren lassen? Beim Streifzug in der nebelverhüllten Natur oder bei einem Bootsausflug auf der Themse können einem schon allerlei Gestalten begegnen. Scheinbar ist Oxford ein ganz besonderer Ort, der die Fantasie zu beflügeln vermag. Die Universität brachte zahllose exzellente Denker verschiedener Fachrichtungen hervor, wie z. B. die Schriftsteller J. R. R. Tolkien und Oscar Wilde, den Neurologen und Schriftsteller Oliver Sacks, den Informatiker und Begründer des World Wide Web Sir Timothy John Berners-Lee oder den Physiker Stephan Hawking. Vielleicht liegt es ja weniger an der inspirierenden Landschaft Oxfords, sondern an den hohen Aufnahme - Anforderungen der Universität, dass diese zu einer Brutstätte der Geisteskraft geworden ist: wer hier zum Studium zugelassen wird, ist von vornherein mit hohem Intellekt ausgestattet. Doch gibt es keine Rose ohne Dornen. Laut Colin Dexter kursiert in Oxford eine Krankheit, die „seine Opfer in der Illusion wiegt, sie seien in Wissens - und Meinungsfragen unfehlbar.“ Auch die Redewendung goes up to Oxford deutet auf ein gewisses Gefühl von Überlegenheit hin: Die Stadt liegt nämlich in einer Senke.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Abriss
- Die Universität Oxford als Institution
- John Wyclif - ein Dorn im Auge der Kirche.
- Gedanken über die Transsubstantiation
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Universität Oxford im Mittelalter und beleuchtet die Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung. Im Zentrum der Arbeit steht die Figur des Theologen und Kirchenreformers John Wyclif und seine zentrale Theorie, die das Dogma der Transsubstantiation in Frage stellte.
- Die Entstehung und Entwicklung der Universität Oxford
- Die Rolle der Universität Oxford im Mittelalter
- Das Leben und Werk des Theologen John Wyclif
- Die Kritik von Wyclif an der mittelalterlichen Kirche
- Wyclifs Theorie zur Transsubstantiation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung bietet einen Überblick über die Thematik der Seminararbeit und stellt die zentrale Figur John Wyclif vor. Sie beleuchtet die besondere Rolle der Universität Oxford als Brutstätte des Geistes und thematisiert die Bedeutung des mittelalterlichen Kontextes für Wyclifs Werk.
- Das Kapitel "Geschichtlicher Abriss" befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Universität Oxford. Es beleuchtet verschiedene Theorien zur Gründung und zeichnet einen Überblick über die frühen Jahre der Universität und ihre Bedeutung als Handels- und Wissenschaftszentrum.
- Das Kapitel "Die Universität Oxford als Institution" konzentriert sich auf die Etablierung der Universität Oxford als eigenständige Institution und beschreibt die Herausforderungen, die sie in den ersten 200 Jahren ihres Bestehens bewältigen musste. Es beleuchtet die Entwicklung von Fakultäten und die Bedeutung der Selbstverwaltung der Universität.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Universität Oxford im Mittelalter, den Theologen John Wyclif, die Transsubstantiation, die Kritik an der mittelalterlichen Kirche und die Bedeutung von Bildung und Wissenschaft in der mittelalterlichen Gesellschaft. Wichtige Aspekte sind die Entstehung der Universität, die Entwicklung ihrer Strukturen und die Rolle von Wyclif als Kirchenreformer und Kritiker des Dogmas der Transsubstantiation.
- Quote paper
- Nicole Gelencser (Author), 2007, Die Universität Oxford im Mittelalter - Der Universitätsprofessor John Wyclif - Häretiker oder Kirchenreformer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73205