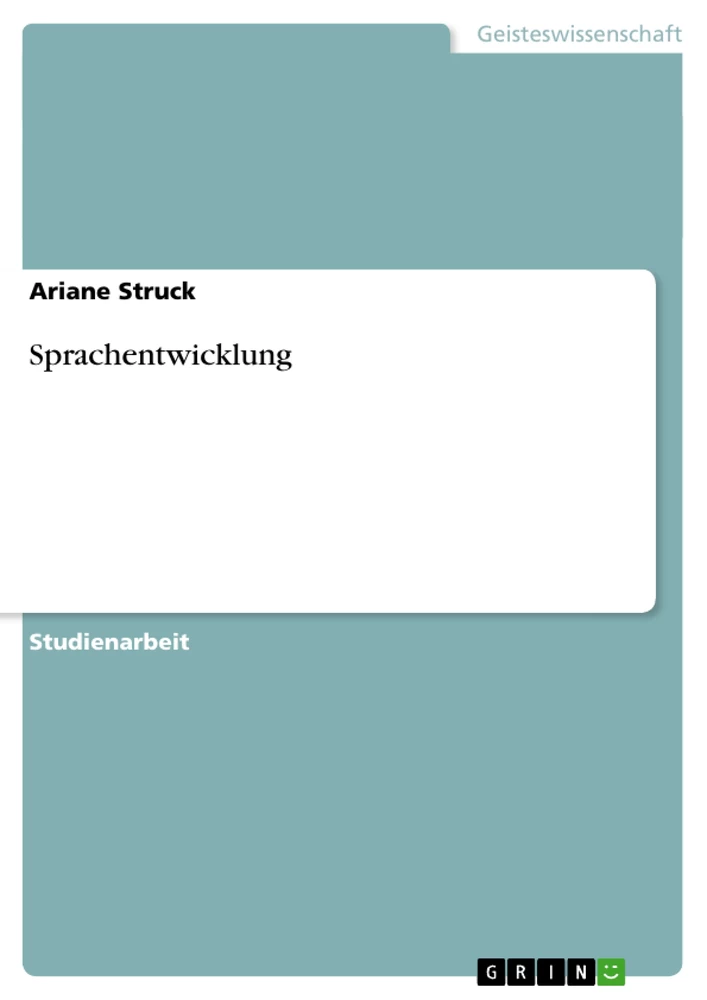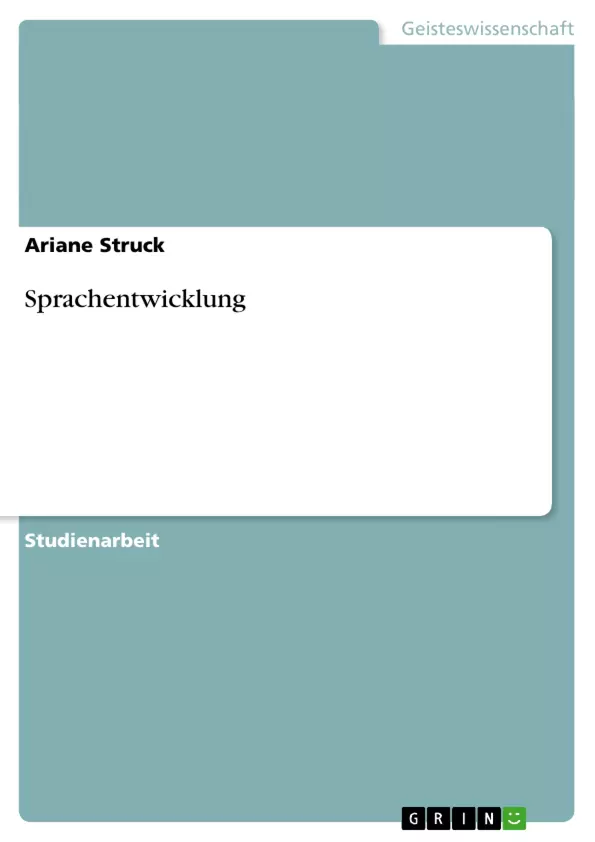"Der Besitz der Sprache unterscheidet den Menschen vom Tier" (HÖRMANN, 1967, S. 1).
Tiere können untereinander kommunizieren, aber auch mit dem Menschen. Sie tun dieses mit einer begrenzten Zahl isolierter Laute oder mimischer und gestischer Ausdrucksweisen. Den höchsten Tierarten fehlt es auch an den Voraussetzungen für die Ausbildung eines Verständigungssystems, daß mit der menschlichen Sprache vergleichbar wäre.
Der Mensch entwickelt im Laufe weniger Jahre aus einer geringen Anzahl für sich bedeutungsloser Laute Tausende von bedeutungshaltigen Lautmustern (Silben, Wörter). Diese werden nach den grammatischen Regeln der jeweils erlernten Sprache so kombiniert, daß aus ihnen eine unendliche Zahl von Aussagen gebildet werden kann. Von Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, können diese Aussagen dann problemlos verstanden werden.
Die Sprachentwicklungspsychologie untersucht, aufgrund welcher Voraussetzungen und in welcher Weise Menschen Sprache erwerben und wie sie ihre Sprache gebrauchen. Dabei kann sie von folgenden Beobachtungen ausgehen: Beginnend mit Schreien und Vokalisieren des Säuglings über das Lallen entstehen bald feste Beziehungen zwischen Lautkomplexen (Worten) und Gegenständen oder Handlungen, bis dann im Anschluß die sehr speziellen Regeln der jeweils erworbenen Sprache verwendet und angewandt werden.
Kinder unterscheiden sich zwar in der Geschwindigkeit mit der sie die Sprache erwerben, die Abfolge der Entwicklungsschritte ist aber weitgehend gleich (Trautner, 1991 u. 1997, S.233).
Inhaltsverzeichnis
1. Drei Aspekte der Sprache:
2. Die Entwicklung der Grammatik
2.1. Einwortäußerungen
2.2. Zweiwortäußerungen
2.2.1. semantische Funktionen von Zweiwortäußerungen
2.2.2. Pivot-Grammatik
2.3. Drei- und Mehrwortäußerungen
3. Erwerb von Wortbedeutung
4. Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten
5. Sprachentwicklungstheorien
6. Grundlagen des Spracherwerbs
6.1. Biologische Grundlagen des Spracherwerbs
6.2. Psychoanalytische Sichtweise des Spracherwerbs
6.3. Soziale Lerntheorie der Sprachentwicklung
6.4. Kognitive Theorien der Sprachentwicklung
7. Zusammenfassung
8. Literatur
Einleitung:
„Der Besitz der Sprache unterscheidet den Menschen vom Tier“ (HÖRMANN, 1967, S. 1).
Tiere können untereinander kommunizieren, aber auch mit dem Menschen. Sie tun dieses mit einer begrenzten Zahl isolierter Laute oder mimischer und gestischer Ausdrucksweisen. Den höchsten Tierarten fehlt es auch an den Voraussetzungen für die Ausbildung eines Verständigungssystems, daß mit der menschlichen Sprache vergleichbar wäre.
Der Mensch entwickelt im Laufe weniger Jahre aus einer geringen Anzahl für sich bedeutungsloser Laute Tausende von bedeutungshaltigen Lautmustern (Silben, Wörter). Diese werden nach den grammatischen Regeln der jeweils erlernten Sprache so kombiniert, daß aus ihnen eine unendliche Zahl von Aussagen gebildet werden kann. Von Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, können diese Aussagen dann problemlos verstanden werden.
Die Sprachentwicklungspsychologie untersucht, aufgrund welcher Voraussetzungen und in welcher Weise Menschen Sprache erwerben und wie sie ihre Sprache gebrauchen. Dabei kann sie von folgenden Beobachtungen ausgehen: Beginnend mit Schreien und Vokalisieren des Säuglings über das Lallen entstehen bald feste Beziehungen zwischen Lautkomplexen (Worten) und Gegenständen oder Handlungen, bis dann im Anschluß die sehr speziellen Regeln der jeweils erworbenen Sprache verwendet und angewandt werden.
Kinder unterscheiden sich zwar in der Geschwindigkeit mit der sie die Sprache erwerben, die Abfolge der Entwicklungsschritte ist aber weitgehend gleich (Trautner, 1991 u. 1997, S.233).
1. Drei Aspekte der Sprache:
Sprachliche Äußerungen lassen sich unter den 3 Aspekten Form, Inhalt und Mitteilungsfunktion betrachten.
Mit der Form ist die grammatisch Struktur einer Sprachäußerung gemeint, während der Inhalt durch die Bedeutung des Gesagten definiert wird. Die Mitteilungsfunktion ist ein kommunikativer Akt, welcher sich darauf bezieht, daß Sprache von einem Sprecher für einen Hörer produziert wird.
Diese 3 Aspekte fallen ungefähr mit den 3 Dimensionen, die in der Zeichentheorie der Sprache (Semiotik) unterschieden werden, zusammen :
a.) Syntax = Beziehung sprachlicher Zeichen untereinander
b.) Semantik = Verhältnis der Zeichen zur nichtsprachlichen Realität (Bezeichnetes)
c.) Pragmatik = Verhältnis der Zeichen zu ihren Benutzern
Als weitere Untersuchungsgegenstände der Spracherwerbsforschung gibt es neben Syntax, Semantik und Pragmatik auch noch Lautverständnis und Lautproduktion (Phonologie) und Wortschatz (Lexikon).
2. Die Entwicklung der Grammatik:
Es reicht nicht aus die Wörter einer Sprache und deren Bedeutung zu kennen, um eine Sprache sprechen und verstehen zu können. Erforderlich ist zusätzlich das Kennen der formalen Regeln der Sprache und deren Anwendung.
Der Satz: Zu spät gestern wir haben kommen ein halbes Stund enthält nach den Regeln der deutschen Sprache zahlreiche Fehler z.B. hinsichtlich der Wortstellung.
Richtig würde der Satz folgendermaßen lauten: Gestern sind wir eine halbe Stunde zu spät gekommen oder: Wir sind gestern eine halbe Stunde zu spät gekommen.
Das System von Regeln, daß es uns möglich macht, aus dem Wortmaterial einer Sprache korrekte, logische und verständliche Sätze zu bilden, bezeichnet man als Grammatik.
Im Kindesalter ist der Erwerb der sprachspezifischen formalen Regeln (Grammatik) ein sehr wichtiger Aspekt beim Erlernen der Muttersprache.
Zu Beginn der neueren Sprachentwicklungspsychologie stand genau dieser Aspekt im Vordergrund des Interesses. Dabei hat sich folgendes gezeigt:
1.) Kindersprache läßt eigenständige Regelbildungen erkennen, welche von den Regeln der Erwachsenensprache in vielen Fällen (noch) abweichen
2.) Grammatikerwerb von verschiedenen Kindern, auch in den verschiedenen Sprachen, verläuft über weite Strecken sehr ähnlich
Die Phasen des Grammatikerwerbs lassen sich im Kindesalter am besten nach der typischen Anzahl von Wörtern in einer Satzeinheit abgrenzen. Zumeist wird dabei zwischen Einwort-, Zweiwort- sowie Dreiwort- und Mehrwortäußerungen unterschieden (Trautner 1991 u. 1997, S. 237f.).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die menschliche Sprache von der Tierkommunikation?
Tiere nutzen begrenzte isolierte Laute oder Mimik, während Menschen aus bedeutungslosen Lauten unendliche Kombinationen nach grammatischen Regeln bilden können.
Was sind die drei Aspekte der Sprache?
Sprachliche Äußerungen werden unter den Aspekten Form (Syntax), Inhalt (Semantik) und Mitteilungsfunktion (Pragmatik) betrachtet.
Wie verläuft die Entwicklung der Grammatik bei Kindern?
Die Entwicklung verläuft meist in festen Phasen: von Einwortäußerungen über Zweiwortäußerungen bis hin zu komplexen Mehrwortsätzen.
Was ist die „Pivot-Grammatik“?
Ein frühes Stadium der kindlichen Grammatik, in dem bestimmte „Ankerwörter“ (Pivots) mit einer Vielzahl anderer Wörter kombiniert werden.
Welche Theorien erklären den Spracherwerb?
Es gibt verschiedene Ansätze, darunter biologische Grundlagen, die soziale Lerntheorie, kognitive Theorien und psychoanalytische Sichtweisen.
- Citation du texte
- Ariane Struck (Auteur), 1999, Sprachentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7326