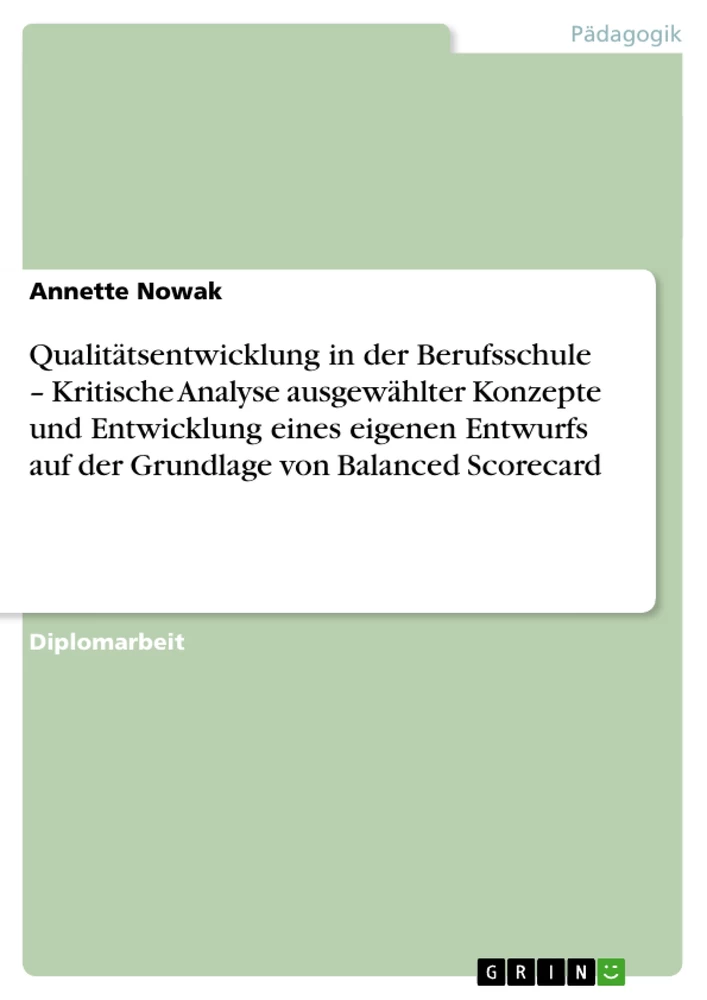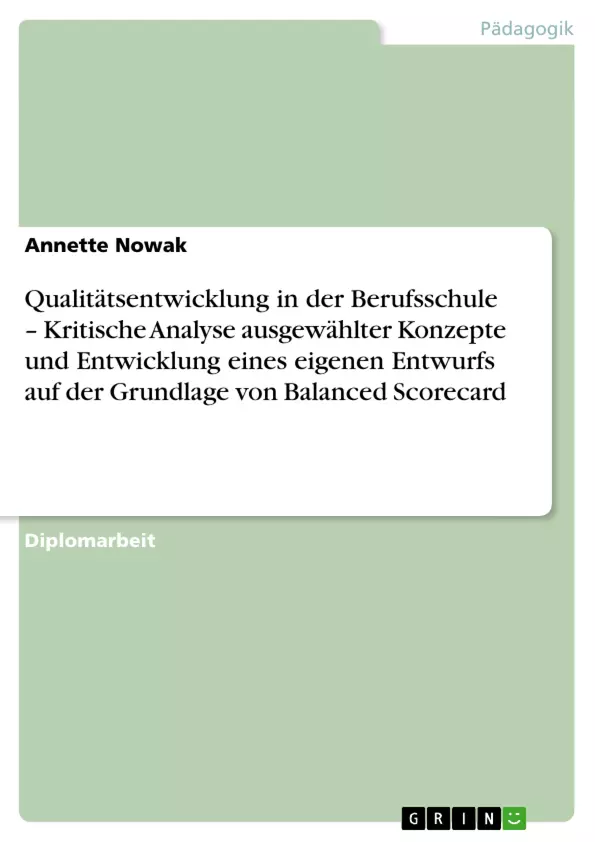„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass dieser Ausspruch sehr zutreffend ist. Alles ändert sich von Zeit zu Zeit, die Frage ist nur, wie schnell oder langsam dieser Wandel erfolgt. In Wirtschaft und Politik sind Veränderungen an der Tagesordnung und Flexibilität wird heutzutage von jedem modernen Menschen erwartet. Daher ist es verwunderlich, dass eine zügige Anpassung an die Bedingungen ausgerechnet im Bildungsbereich nicht stattgefunden hat. Natürlich sind auch Schulen nicht auf dem Stand von vor ein paar Jahrzehnten stehen geblieben, sondern es haben neue Lehrmethoden und -medien Einzug gehalten. Schüler und Betriebe haben ein größeres Mitspracherecht bekommen und Kollegien arbeiten im Team. Dennoch ist der Unterricht noch immer Individualangelegenheit der Lehrkräfte. Er wird von ihnen eigenständig ausgearbeitet, durchgeführt und ggf. reflektiert. Die Lehrkräfte kennen die Bildungsinhalte, die sie vermitteln sollen und entscheiden allein darüber, welche in ihrem Unterricht vorkommen und auf welche Weise diese gelehrt werden. Das hat seit langem so funktioniert, birgt aber neuerdings ein großes Problem: der Unterricht und alles, was mit ihm zu tun hat entziehen sich einer Qualitätskontrolle, welche im Zeitalter von Bildungstests wie PISA unerlässlich geworden ist. Forschungen haben ergeben, dass Lernerfolge und -fortschritte der Schüler in erheblichem Maß von den Rahmenbedingungen des Lernorts Schule abhängen. Dazu zählen nicht nur die Bildungsinhalte, sondern beispielsweise auch die Qualität der Lehrkräfte und der Ausstattung sowie Schulklima und Beziehungen. Die Qualität von Bildungseinrichtungen muss also überprüfbar gestaltet und regelmäßig kontrolliert werden, damit das Bildungssystem zukunftsfähig wird und mit nationalen und internationalen Standards mithalten kann. Welche Möglichkeiten hierzu existieren, erörtern Pädagogen und Politiker erst seit kurzem.
Dieser Frage soll in im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden, indem die drei Modelle vorgestellt und ausführlich analysiert werden. Die Analyse wird ergeben, dass die Balanced Scorecard den anderen Systemen in vielen Aspekten überlegen und sehr wohl geeignet ist in Berufsschulen eingesetzt zu werden. Deshalb wird mit dem Entwurf eines eigenen Konzepts der Versuch unternommen die
Balanced Scorecard erstmalig an einer Berufsschule zu implementieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Warum Qualitätsentwicklung?
- 2.1 Begriffsbestimmung „Qualitätsentwicklung“, „Qualitätsmanagement“ und „Qualitätssicherung“
- 2.2 Definitionen von „Qualität“
- 2.2.1 Allgemeine Definitionen und Definitionen aus der Wirtschaft
- 2.2.2 Definitionen im Kontext (Berufs-) Schule
- 2.3 Anlässe von Qualitätsentwicklung
- 3 Vorstellung ausgewählter Konzepte
- 3.1 DIN ISO 9000ff. (technikorientierter Ansatz)
- 3.1.1 Inhalte und Ziele
- 3.1.2 Zentrale Verfahren
- 3.1.3 Neuerungen ab 2000
- 3.1.4 Neue Hauptnormen
- 3.2 Total Quality Management
- 3.3 EFQM-Modell für Business Excellence (Modell zur Vergabe von Qualitätspreisen)
- 3.3.1 Inhalte und Ziele
- 3.3.2 Grundsätze des EFQM-Modells
- 3.3.3 Selbstevaluation
- 3.4 Die Balanced Scorecard (ökonomisch orientierter Ansatz)
- 3.4.1 Inhalte und Ziele
- 3.4.2 Perspektiven
- 3.4.3 Umsetzung der BSC
- 4 Analyse der ausgewählten Konzepte
- 4.1 Beschreibung der Analysekriterien
- 4.1.1 Rahmenbedingungen (Zielsetzung, Qualitätsverständnis, Ganzheitlichkeit, Zielgruppe, Nutzen)
- 4.1.2 Berücksichtigung der Betroffenen (Einbezug und Verantwortung)
- 4.1.3 Transparenz
- 4.1.4 Handhabbarkeit
- 4.1.5 Abhängigkeit
- 4.1.6 Nachhaltigkeit
- 4.1.7 Methoden der Erfolgsprüfung
- 4.1.8 Anwenderkreis
- 4.1.9 Außenwirkung (Image und Vergleichbarkeit)
- 4.1.10 Anwendbarkeit auf schulische Rahmenbedingungen
- 4.2 Analyse der Normenreihe DIN (EN) ISO 9000ff
- 4.2.1 Rahmenbedingungen
- 4.2.2 Berücksichtigung der Betroffenen (Einbezug und Verantwortung)
- 4.2.3 Transparenz
- 4.2.4 Handhabbarkeit
- 4.2.5 Abhängigkeit
- 4.2.6 Nachhaltigkeit
- 4.2.7 Methoden der Erfolgsprüfung
- 4.2.8 Anwenderkreis
- 4.2.9 Außenwirkung (Image und Vergleichbarkeit)
- 4.2.10 Anwendbarkeit auf schulische Rahmenbedingungen
- 4.3 Analyse des EFQM-Modells
- 4.3.1 Rahmenbedingungen
- 4.3.2 Berücksichtigung der Betroffenen (Einbezug und Verantwortung)
- 4.3.3 Transparenz
- 4.3.4 Handhabbarkeit
- 4.3.5 Abhängigkeit
- 4.3.6 Nachhaltigkeit
- 4.3.7 Methoden der Erfolgsprüfung
- 4.3.8 Anwenderkreis
- 4.3.9 Außenwirkung (Image und Vergleichbarkeit)
- 4.3.10 Anwendbarkeit auf schulische Rahmenbedingungen
- 4.4 Analyse des Balanced Scorecard-Modells
- 4.4.1 Rahmenbedingungen
- 4.4.2 Berücksichtigung der Betroffenen (Einbezug und Verantwortung)
- 4.4.3 Transparenz
- 4.4.4 Handhabbarkeit
- 4.4.5 Abhängigkeit
- 4.4.6 Nachhaltigkeit
- 4.4.7 Methoden der Erfolgsprüfung
- 4.4.8 Anwenderkreis
- 4.4.9 Außenwirkung (Image und Vergleichbarkeit)
- 4.4.10 Anwendbarkeit auf schulische Rahmenbedingungen
- 4.5 Entscheidungsbegründung für die Balanced Scorecard als Rahmenkonzept zur Entwicklung eines eigenen Entwurfs
- 5 Vorstellung eines eigenen Entwurfs auf der Grundlage der Balanced Scorecard
- 5.1 Voraussetzungen
- 5.2 Mission, Vision, Strategie
- 5.3 Entwicklung einer Balanced Scorecard für eine Berufsschule
- 5.3.1 Perspektiven
- 5.3.2 Strategische Ziele
- 5.3.3 Ursache-Wirkungs-Ketten
- 5.3.4 Messgrößen
- 5.3.5 Zielwerte und strategische Aktionen
- 5.4 Sicherstellung des kontinuierlichen Balanced Scorecard-Einsatzes
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Konzepte der Qualitätsentwicklung im Kontext der Berufsschule und entwickelt auf Basis der Balanced Scorecard einen eigenen Entwurf für ein Qualitätsmanagementsystem.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung von Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
- Analyse ausgewählter Konzepte zur Qualitätsentwicklung (DIN ISO 9000ff., Total Quality Management, EFQM-Modell, Balanced Scorecard)
- Entwicklung eines eigenen Entwurfs für ein Qualitätsmanagementsystem in der Berufsschule auf Basis der Balanced Scorecard
- Bewertung der Anwendbarkeit der Konzepte auf die besonderen Rahmenbedingungen der Berufsschule
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen der Qualitätsentwicklung in der Berufsschule
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Arbeit stellt die Fragestellung und die Vorgehensweise vor.
- Kapitel 2: Warum Qualitätsentwicklung? - Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Qualitätsentwicklung“, „Qualitätsmanagement“ und „Qualitätssicherung“. Zudem werden verschiedene Definitionen von „Qualität“ im Allgemeinen und im Kontext der Schule beleuchtet.
- Kapitel 3: Vorstellung ausgewählter Konzepte - Dieses Kapitel präsentiert vier Konzepte der Qualitätsentwicklung: DIN ISO 9000ff., Total Quality Management, EFQM-Modell und Balanced Scorecard. Jedes Konzept wird hinsichtlich seiner Inhalte, Ziele und zentralen Verfahren vorgestellt.
- Kapitel 4: Analyse der ausgewählten Konzepte - Die vier Konzepte werden anhand verschiedener Kriterien analysiert, darunter Rahmenbedingungen, Berücksichtigung der Betroffenen, Transparenz, Handhabbarkeit, Abhängigkeit, Nachhaltigkeit, Methoden der Erfolgsprüfung, Anwenderkreis, Außenwirkung und Anwendbarkeit auf schulische Rahmenbedingungen.
- Kapitel 5: Vorstellung eines eigenen Entwurfs auf der Grundlage der Balanced Scorecard - In diesem Kapitel wird ein eigener Entwurf für ein Qualitätsmanagementsystem in der Berufsschule auf Basis der Balanced Scorecard entwickelt.
Schlüsselwörter
Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Berufsschule, Balanced Scorecard, DIN ISO 9000ff., Total Quality Management, EFQM-Modell, Rahmenbedingungen, Anwendbarkeit, Schulische Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Qualitätsentwicklung an Berufsschulen notwendig?
Um die Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems zu sichern und Lernerfolge messbar zu machen, ist eine systematische Kontrolle der Rahmenbedingungen und der Unterrichtsqualität unerlässlich.
Was ist die Balanced Scorecard (BSC)?
Die BSC ist ein ökonomisch orientierter Management-Ansatz, der verschiedene Perspektiven (z.B. Finanzen, Kunden, Prozesse, Lernen) verknüpft, um Strategien in messbare Ziele umzusetzen.
Welche Vorteile bietet die BSC gegenüber dem EFQM-Modell?
Die BSC zeichnet sich durch eine bessere Handhabbarkeit und die Möglichkeit aus, Ursache-Wirkungs-Ketten direkt auf die spezifischen Ziele einer Berufsschule anzuwenden.
Wie werden strategische Ziele für eine Schule definiert?
Ziele werden aus der Mission und Vision der Schule abgeleitet und in Perspektiven wie „Bildungsprozesse“ oder „Schulklima“ unterteilt und mit Messgrößen hinterlegt.
Was bedeutet „Qualität“ im Kontext Schule?
Schulqualität umfasst nicht nur Bildungsinhalte, sondern auch die Kompetenz der Lehrkräfte, die Ausstattung, das Schulklima und die Zufriedenheit der Betriebe und Schüler.
- Arbeit zitieren
- Diplomhandelslehrerin Annette Nowak (Autor:in), 2006, Qualitätsentwicklung in der Berufsschule – Kritische Analyse ausgewählter Konzepte und Entwicklung eines eigenen Entwurfs auf der Grundlage von Balanced Scorecard, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73266