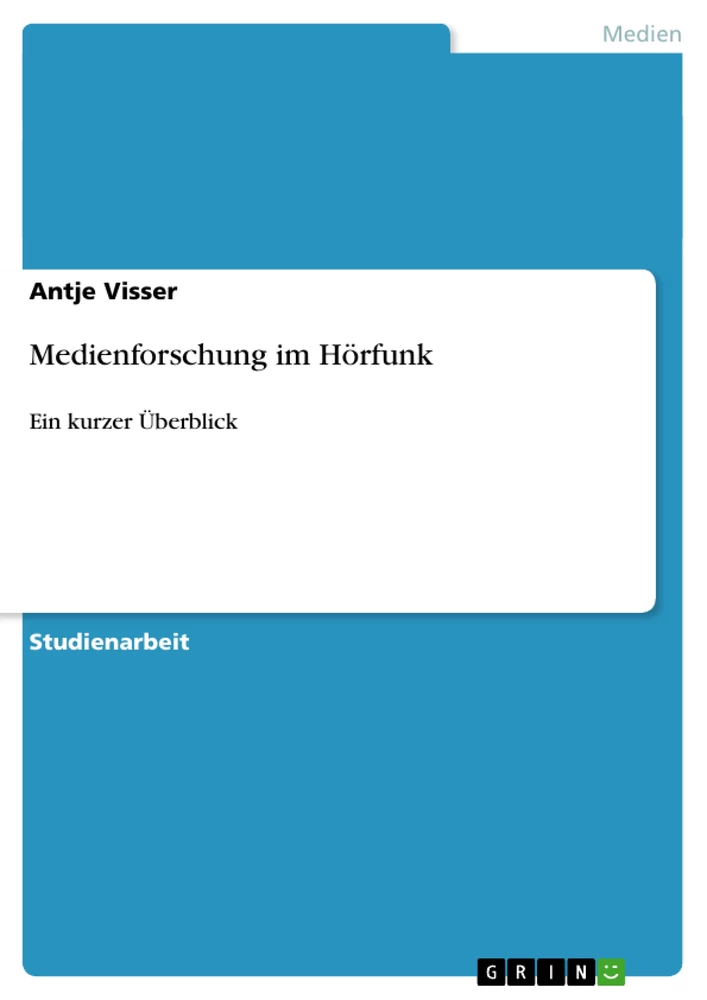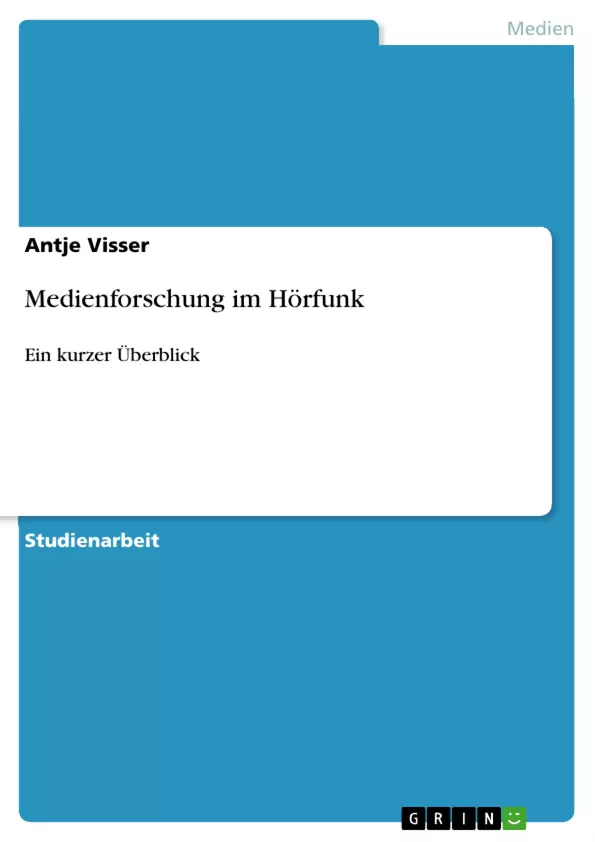Die Medienwirkungsforschung entwickelte sich mit der Verbreitung des Fernsehens und obwohl der Hörfunk schon deutlich länger bestand, gab es in der Hörfunkforschung nur wenige marginale Ansätze . Ende der 80ger Jahre änderte sich die Situation, da mit Etablierung der privat-rechtlichen Wellen ein immer stärker werdender Konkurrenzdruck deutlich wurde. Dies wirkte sich zum einen direkt auf die Anzahl der Hörer und zum anderen auch auf die Werbekunden aus, welche die jeweiligen Sender durch das Schalten von Werbung finanzieren. Damit waren auch die Sender gezwungen, Forschungsarbeit bezüglich des eigenen Publikums zu leisten. Denn nur so konnte man die eigene Position auf dem Markt feststellen und den Werbekunden konkrete Zahlen und Daten vorlegen.
Diese Radionutzungsdaten sind sowohl für Werbungtreibende, Mediaplaner und Agenturen eine unentbehrliche Grundlage. Aber auch die Programmverantwortlichen selbst benötigen sie als Basis für Entscheidungen, die das Programm betreffen oder die Vergabe von Werbebudgets. Auch für die Akzeptanz von Radiosendern und Radioprogrammen sind diese Daten ein wichtiger Indikator. Ziel der Publikumsforschung ist die Analyse der Zuschauer und deren Verhalten, um danach das Programm zu planen, die Gestaltung zu optimieren und nicht zuletzt gezielte Public-Relation-Maßnahmen durchzuführen .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erhebungsmethoden in der Medienwirkungsforschung
- Besonderheiten der Hörfunkforschung
- Neuere Ansätze in der Hörfunkforschung
- Vor- und Nachteile der neuen Ansätze
- Medienwirkungsforschung im Vergleich
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Medienwirkungsforschung im Hörfunk und untersucht die Entwicklung und Besonderheiten der Hörfunkforschung sowie die Herausforderungen durch den wachsenden Konkurrenzdruck. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Erhebungsmethoden und analysiert neue Ansätze in der Hörfunkforschung, ihre Vor- und Nachteile sowie die Vergleichbarkeit mit anderen Medienforschungen.
- Entwicklung der Medienwirkungsforschung im Hörfunk
- Einfluss des Konkurrenzdrucks auf die Hörfunkforschung
- Erhebungsmethoden in der Medienwirkungsforschung
- Neue Ansätze in der Hörfunkforschung
- Vergleichbarkeit der Medienwirkungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert die Entwicklung der Medienwirkungsforschung im Hörfunk und zeigt die Bedeutung der Hörfunkforschung im Kontext des wachsenden Konkurrenzdrucks durch die Etablierung privater Radiosender.
- Erhebungsmethoden in der Medienwirkungsforschung: Dieses Kapitel beleuchtet klassische Erhebungsmethoden wie die Befragung und stellt die verschiedenen Formen der Befragung (face-to-face, telefonische Befragung, Diary-Technik) sowie deren Vor- und Nachteile dar. Weiterhin werden apparative Verfahren zur Messung von Gefühlswirkungen vorgestellt.
- Besonderheiten der Hörfunkforschung: Das Kapitel behandelt die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der Hörfunkforschung im Vergleich zu anderen Medienbereichen.
- Neuere Ansätze in der Hörfunkforschung: Dieses Kapitel analysiert neue Ansätze in der Hörfunkforschung und beleuchtet deren Potenziale und Grenzen.
- Vor- und Nachteile der neuen Ansätze: Dieses Kapitel diskutiert die Vor- und Nachteile der neuen Ansätze in der Hörfunkforschung.
- Medienwirkungsforschung im Vergleich: Dieses Kapitel setzt die Hörfunkforschung in den Kontext anderer Medienforschungsbereiche und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.
Schlüsselwörter
Medienwirkungsforschung, Hörfunkforschung, Erhebungsmethoden, Befragung, Diary-Technik, apparative Verfahren, neue Ansätze, Konkurrenzdruck, Radioprogramm, Werbekunden, Publikumsforschung.
- Quote paper
- Antje Visser (Author), 2000, Medienforschung im Hörfunk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7341