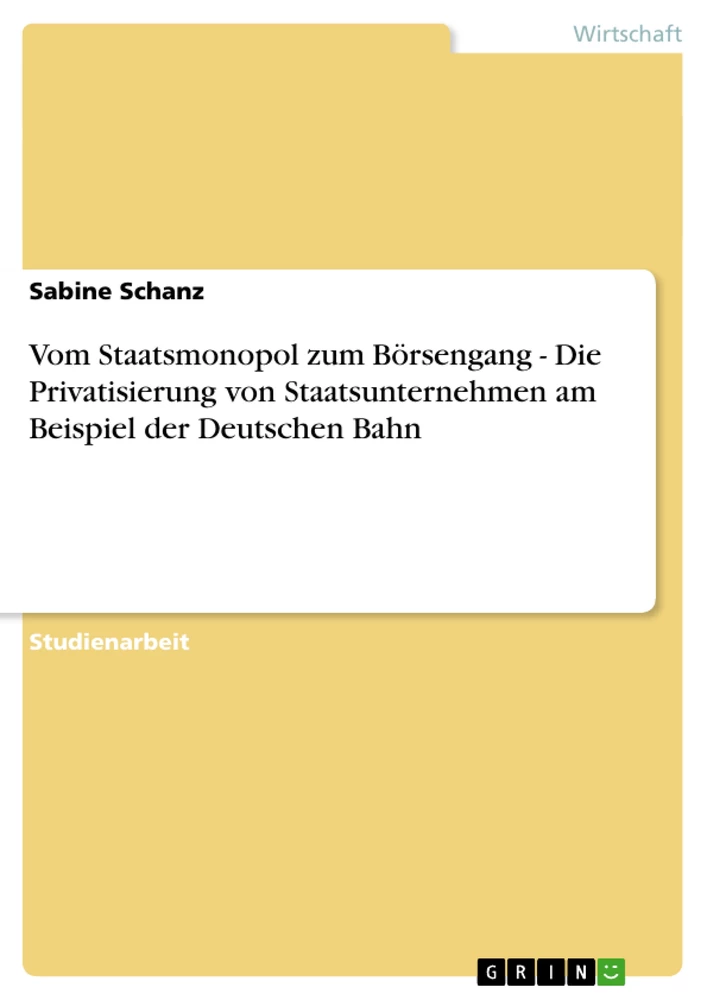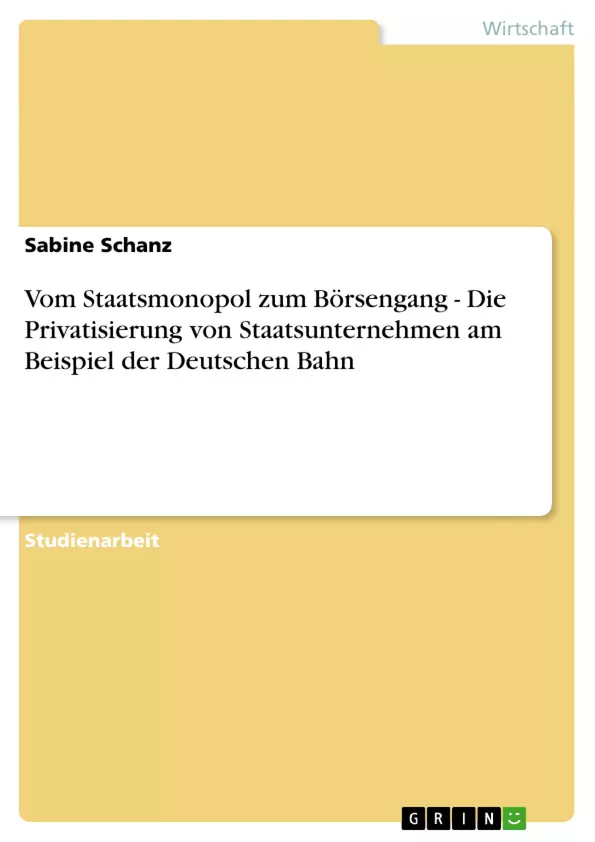Seit der Eröffnung der ersten Bahnstrecke von Nürnberg nach Fürth im Jahre 1835 hat das Eisenbahnwesen in Deutschland eine turbulente Entwicklung seitens Art und Weise der Unternehmungsführung, des Images und der Konkurrenzsituation auf den Verkehrsmärkten durchlebt. Ursprünglich durch private Aktiengesellschaften finanziert, anschließend verstaatlicht, wird 1920 die Deutsche Reichsbahn gegründet. Zu diesem Zeitpunkt besaß die Bahn einen Anteil von 70 % des Gesamtverkehrsaufkommens. In den 30er Jahren sowie nach dem zweiten Weltkrieg verlor die Bahn zunehmend an Marktanteilen, vor allem an den durch Flexibilität und höhere Kundenorientierung gekennzeichneten Kraftverkehr. In Westdeutschland wird die Bundesbahn nach dem Krieg in Behördenform im Staatseigentum weitergeführt und wirkt gegen die Konkurrenz auf der Straße eher schwerfällig und komplex. In Ostdeutschland behält die Bahn ihre Bezeichnung Reichsbahn und wird nach der Teilung Deutschlands in der sozia-listischen Planwirtschaft zentralistisch geleitet. Die Reichsbahn behielt bis zur Wende das Verkehrsmonopol. Im Westen hat der Behördenapparat dem Konkurrenzdruck nichts entgegenzusetzen. Das Schienennetz war seit dem Krieg stark beschädigt und vernachlässigt, die Maschinen veraltert und die Reparationszahlungen an die Siegermächte zu hoch. Das einst so profitable und imageträchtige Verkehrsunternehmen, vor allem im Hinblick auf die großen Leistungen im Wiederaufbau, entwickelte sich mehr und mehr zum Verlustgeschäft. Nach der Wiedervereinigung, Anfang der 90er Jahre, hatte die Bundesbahn/Reichsbahn bereits nur noch einen Marktanteil im Güterverkehr von unter 20 %. Gleichzeitig stieg der Schuldenberg drastisch an: in der Summe beliefen sich die Schulden 1994 auf ca. 34 Milliarden Euro. Eine Prognose des Verkehrsministeriums rechnete die Schulden für das Jahr 2003 auf rund 200 Milliarden Euro hoch [vgl. BMVBS, 2006]. Es lag also nah, dass etwas passieren musste. Die Bahn sollte wieder zu einem ökologisch und ökonomisch sinnvollen Verkehrsmittel werden. Nach fünfjähriger Reformdiskussion, die bereits Ende der 80er Jahre begann, wird 1994, initiiert durch die Regierungskommission um Privatisierung und Zusammenführung von Bundesbahn und Reichsbahn, die Deutsche Bahn AG gegründet. Durch die Bahnstrukturreform werden Jahre des Umbruchs in Form von neuen unternehmerischen Handeln bei gleichzeitiger Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben eingeläutet. Die Bahnstrukturreform ist Grundlage dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Begriffsdefinitionen des Eisenbahnmarktes
- 2.1 Staatsmonopole
- 2.2 Spannungsfeld Wettbewerb - Regulierung
- 2.3 Privatisierung
- 3. Die Situation vor der Bahnstrukturreform
- 3.1 Marktstrukturen im Eisenbahnmarkt
- 3.2 Gründe und Ziele der Bahnstrukturreform
- 4. Die Bahnstrukturreform
- 4.1 Bestandteile und Zeitrahmen der Bahnstrukturreform
- 4.2 Inhalte der Bahnstrukturreform als Grundlagen für Wettbewerbsorientierung
- 4.3 Beurteilung der Auswirkungen der Bahnstrukturreform
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Privatisierung der Deutschen Bahn AG im Kontext der Bahnstrukturreform. Ziel ist es, den Wandel vom Staatsmonopol zum börsennotierten Unternehmen zu analysieren und die ökonomischen und politischen Hintergründe zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei die Entwicklung des Eisenbahnmarktes in Deutschland, die Herausforderungen der Reform und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb.
- Entwicklung des deutschen Eisenbahnmarktes vom Staatsmonopol zur Privatisierung
- Ökonomische Aspekte von Staatsmonopolen und natürlichen Monopolen
- Die Bahnstrukturreform: Ziele, Maßnahmen und Zeitrahmen
- Auswirkungen der Bahnstrukturreform auf den Wettbewerb und die Marktstrukturen
- Ökologische und ökonomische Herausforderungen im Eisenbahnsektor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die turbulente Geschichte des deutschen Eisenbahnwesens von der Privatisierung über die Verstaatlichung bis hin zur Gründung der Deutschen Reichsbahn und der Bundesbahn. Sie hebt den dramatischen Rückgang des Marktanteils der Bahn im Vergleich zum Kraftverkehr hervor und verdeutlicht die wachsende Verschuldung, die letztendlich zur Bahnstrukturreform führte. Die Einleitung stellt die Notwendigkeit der Reform dar und umreißt den Aufbau der Arbeit.
2. Allgemeine Begriffsdefinitionen des Eisenbahnmarktes: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff des Staatsmonopols, insbesondere im Kontext der Eisenbahninfrastruktur. Es diskutiert die ökonomischen Eigenschaften natürlicher Monopole und deren Kennzeichen wie Subadditivität der Kostenfunktion und die Schwierigkeit, wettbewerbsfähige Marktsituationen zu etablieren. Der Begriff der Privatisierung wird ebenfalls definiert und in den Kontext des Wandels im Eisenbahnbereich eingeordnet.
3. Die Situation vor der Bahnstrukturreform: Dieses Kapitel beschreibt die Marktstrukturen des Eisenbahnmarktes vor der Reform, mit besonderem Fokus auf die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn. Es analysiert die Gründe und Ziele der Bahnstrukturreform, die durch die zunehmende Verschuldung, den Verlust an Marktanteilen und die Notwendigkeit der Anpassung an den europäischen Binnenmarkt motiviert war. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten der Bundesbahn im Wettbewerb mit dem Kraftverkehr und die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Organisation in Ost- und Westdeutschland ergaben.
4. Die Bahnstrukturreform: Dieses Kapitel widmet sich im Detail den Bestandteilen und dem Zeitrahmen der Bahnstrukturreform. Es untersucht die Inhalte der Reform, welche die Grundlage für eine wettbewerbsorientiertere Gestaltung des Eisenbahnmarktes bilden sollten. Es werden die verschiedenen Maßnahmen und deren Zielsetzungen erläutert und kritisch bewertet. Der Fokus liegt dabei auf der Umstrukturierung des Unternehmens und der Schaffung von Wettbewerbsbedingungen.
Schlüsselwörter
Deutsche Bahn, Bahnstrukturreform, Privatisierung, Staatsmonopol, natürliches Monopol, Wettbewerb, Regulierung, Marktstrukturen, Verkehrssektor, Ökonomische Effizienz, Europäischer Binnenmarkt.
FAQ: Seminararbeit zur Privatisierung der Deutschen Bahn AG
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Privatisierung der Deutschen Bahn AG im Kontext der Bahnstrukturreform. Sie untersucht den Wandel vom Staatsmonopol zum börsennotierten Unternehmen und beleuchtet die ökonomischen und politischen Hintergründe.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des deutschen Eisenbahnmarktes, die Herausforderungen der Bahnstrukturreform und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb. Konkrete Themen sind: Entwicklung vom Staatsmonopol zur Privatisierung, ökonomische Aspekte von Staats- und natürlichen Monopolen, Ziele und Maßnahmen der Bahnstrukturreform, Auswirkungen auf Marktstrukturen und Wettbewerb sowie ökologische und ökonomische Herausforderungen im Eisenbahnsektor.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Allgemeine Begriffsdefinitionen des Eisenbahnmarktes, Die Situation vor der Bahnstrukturreform, Die Bahnstrukturreform und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Privatisierung und der Bahnstrukturreform.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung skizziert die Geschichte des deutschen Eisenbahnwesens, den Rückgang des Marktanteils der Bahn, die wachsende Verschuldung und die Notwendigkeit der Bahnstrukturreform. Sie gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Was sind die wichtigsten Begriffsdefinitionen?
Kapitel 2 definiert Staatsmonopol, natürliche Monopole (mit Fokus auf Subadditivität der Kostenfunktion und Schwierigkeiten wettbewerbsfähiger Märkte) und Privatisierung im Kontext des Eisenbahnmarktes.
Wie wird die Situation vor der Bahnstrukturreform dargestellt?
Kapitel 3 beschreibt die Marktstrukturen vor der Reform (Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn), analysiert die Gründe (Verschuldung, Marktanteilsverlust, Anpassung an den europäischen Binnenmarkt) und Ziele der Reform und beleuchtet die Herausforderungen des Wettbewerbs mit dem Kraftverkehr und die Unterschiede zwischen Ost und West.
Was sind die Kernelemente der Bahnstrukturreform?
Kapitel 4 beschreibt detailliert die Bestandteile und den Zeitrahmen der Bahnstrukturreform. Es untersucht die Maßnahmen zur Schaffung wettbewerbsorientierterer Marktbedingungen und bewertet deren Zielsetzungen kritisch.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Bahn, Bahnstrukturreform, Privatisierung, Staatsmonopol, natürliches Monopol, Wettbewerb, Regulierung, Marktstrukturen, Verkehrssektor, Ökonomische Effizienz, Europäischer Binnenmarkt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den Wandel der Deutschen Bahn vom Staatsmonopol zum börsennotierten Unternehmen zu analysieren und die ökonomischen und politischen Hintergründe zu beleuchten.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Dipl. oek. Sabine Schanz (Author), 2006, Vom Staatsmonopol zum Börsengang - Die Privatisierung von Staatsunternehmen am Beispiel der Deutschen Bahn , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73429