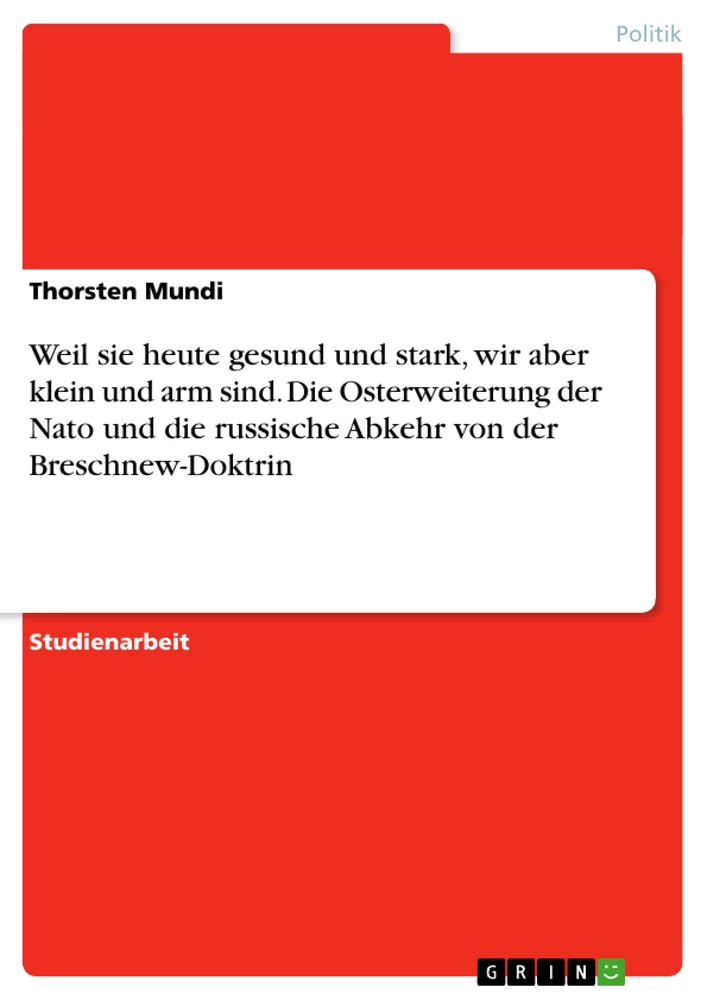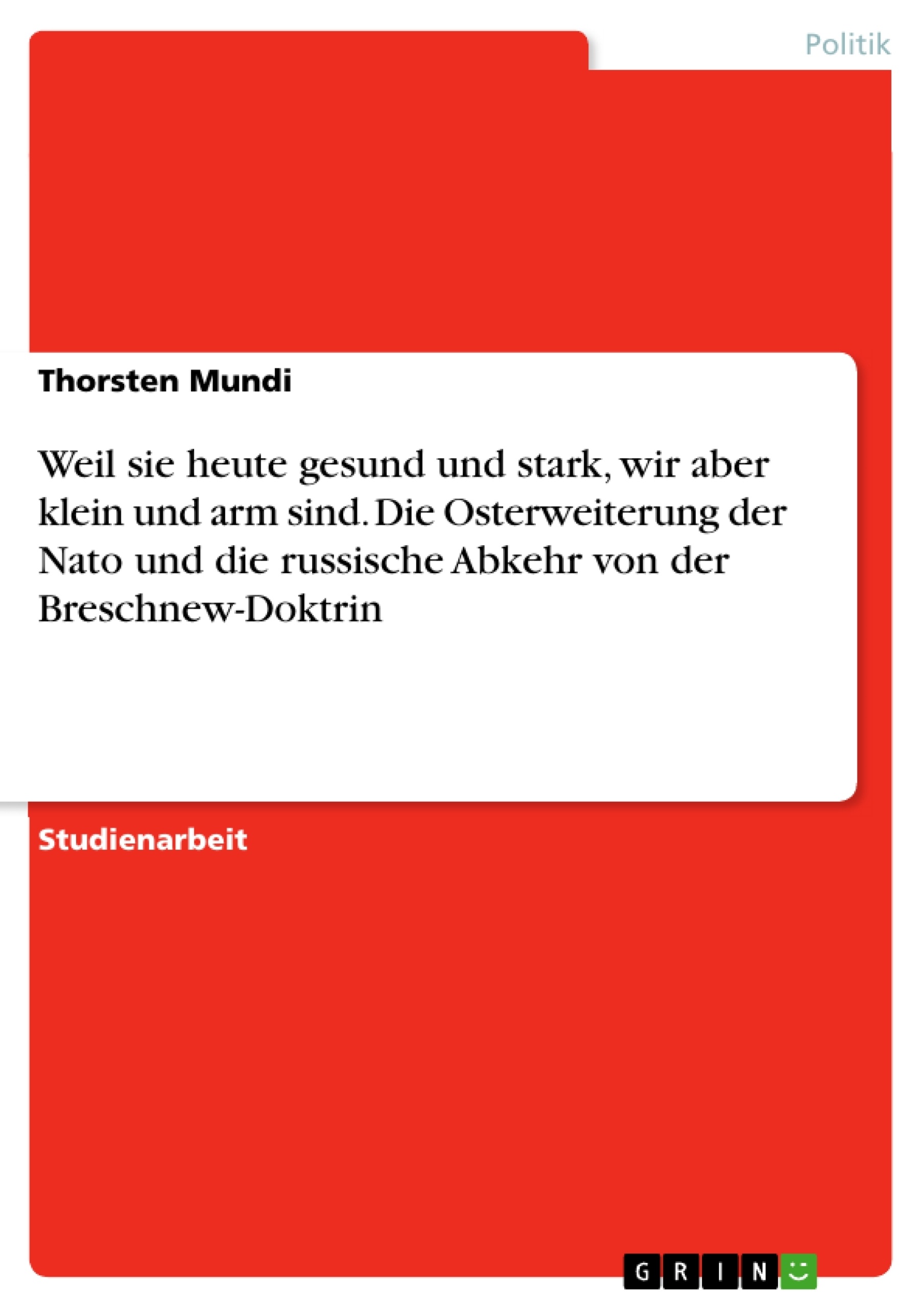Mit den Worten: "Wenn man gehen muß, muß man gehen. So ist das." verkündete Michail Gorbatschow am 25.12.1991 seinen Rücktritt und besiegelte das Ende der Sowjetunion."
Die damit angestoßene Entwicklung führte zu strukturellen Veränderungen der Beziehungen Russlands zu den einstmals der sowjetischen Hegemonialssphäre zugehörigen Staaten Mittelosteuropas (MOE) und des gesamten sozialistischen Systems; die endgültige Auflösung des Warschauer Paktes am 01. Juli 1991 war eine natürliche Folge der neuen geopolitischen Bedingungen.
Auf dem Territorium der "engeren sozialistischen Gemeinschaft" entstand ein Macht- und Sicherheitsvakuum, das die MOE Staaten - zunächst namentlich Polen, Tschechien und Ungarn - aus unterschiedlichen Beweggründen durch ihre Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis zu füllen trachteten. Die damit entstandene strategische Situation wäre wenige Jahre zuvor noch völlig undenkbar erschienen: Würden die beitrittswilligen Kandidaten in die NATO integriert, hätten die einstmalige kommunistische Führungsmacht und das atlantische Bündnis gemeinsame Grenzen.
Die Position Russlands schwankte über Jahre hinweg zwischen schroffer Ablehnung der Erweiterungspläne und vorsichtiger Annäherung an das westliche Bündnis. Das Ergebnis ist Geschichte: Am 16. Dezember 1997 wurden Polen, Tschechien und Ungarn formal in die Strukturen der NATO integriert.
Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Kontinuität und Wandel
- Kooperation oder „kalter Frieden“?
- Die „Breschnew-Doktrin“
- Ideologische Grundlagen
- Klassengegensatz und Weltrevolution
- Die historische Sendung der Sowjetunion
- Entwicklung
- Legitimation der Anwendung
- Der beschwerliche Weg nach Westen
- Klassenkampf mit anderen Mitteln oder Demokratie nach westlichem Muster?
- Das Prinzip der freien Wahl
- Der verlorene Traum
- Zwischen patriotischem Konsens und politischer Umsetzbarkeit
- Der Primat des Möglichen
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die russische Reaktion auf die Osterweiterung der NATO und die Abkehr von der Breschnew-Doktrin, die die sowjetische Politik gegenüber den „sozialistischen Bruderländern“ prägte. Der Fokus liegt auf der Analyse der ideologischen und strategischen Hintergründe der russischen Haltung sowie der Veränderungen in den Beziehungen zwischen Russland und den Ländern Mittelosteuropas im Kontext der Auflösung des Warschauer Paktes.
- Die Breschnew-Doktrin und ihre ideologischen Grundlagen
- Die russische Reaktion auf die Osterweiterung der NATO
- Der Wandel des russischen Selbstverständnisses im Kontext der Auflösung des Warschauer Paktes
- Das Spannungsfeld zwischen „proletarisch-sozialistischer“ und „freiheitlich-kapitalistischer“ Logik in der russischen Außenpolitik
- Die Entwicklung eines „neuen politischen Denkens“ unter Gorbatschow
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Osterweiterung der NATO und die politischen und ideellen Veränderungen in Russland nach dem Fall des Kommunismus. Das zweite Kapitel analysiert die Breschnew-Doktrin, ihre ideologische Grundlage und die Entwicklung ihrer Anwendung in der sowjetischen Außenpolitik. Das dritte Kapitel beleuchtet die Reaktionen Russlands auf die Bestrebungen der Länder Mittelosteuropas, der NATO beizutreten. Das vierte Kapitel untersucht den „verlorenen Traum“ der sowjetischen Hegemonialsphäre und die Herausforderungen des neuen politischen Denkens unter Gorbatschow.
Schlüsselwörter
Osterweiterung der NATO, Breschnew-Doktrin, Russland, Sowjetunion, Warschauer Pakt, Mittelosteuropa, „neues politisches Denken“, Gorbatschow, Jelzin, Klassenkampf, Demokratie, Internationale Beziehungen, Ideologie, Hegemonie.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Breschnew-Doktrin?
Die Doktrin besagte, dass die Sowjetunion das Recht habe, militärisch in sozialistischen Ländern einzugreifen, wenn der Sozialismus dort gefährdet sei.
Warum wollten MOE-Staaten wie Polen in die NATO?
Nach der Auflösung des Warschauer Paktes entstand ein Sicherheitsvakuum, das diese Staaten durch den Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis füllen wollten.
Wie reagierte Russland auf die NATO-Osterweiterung?
Die russische Position schwankte über Jahre hinweg zwischen schroffer Ablehnung der Pläne und einer vorsichtigen Annäherung an das Bündnis.
Was bedeutete Gorbatschows „neues politisches Denken“?
Es markierte die Abkehr von der Breschnew-Doktrin und räumte den Staaten des Ostblocks das Prinzip der freien Wahl ihres politischen Systems ein.
Wann wurden Polen, Tschechien und Ungarn NATO-Mitglieder?
Die formale Integration dieser Länder in die NATO-Strukturen erfolgte am 16. Dezember 1997.
- Citation du texte
- Thorsten Mundi (Auteur), 2001, Weil sie heute gesund und stark, wir aber klein und arm sind. Die Osterweiterung der Nato und die russische Abkehr von der Breschnew-Doktrin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7346