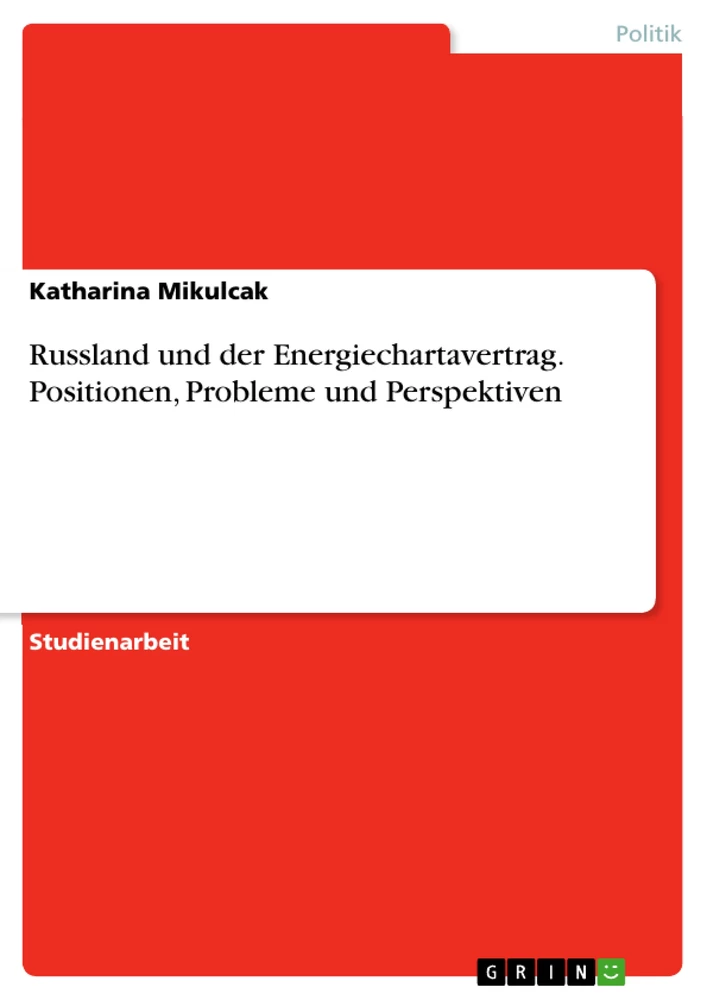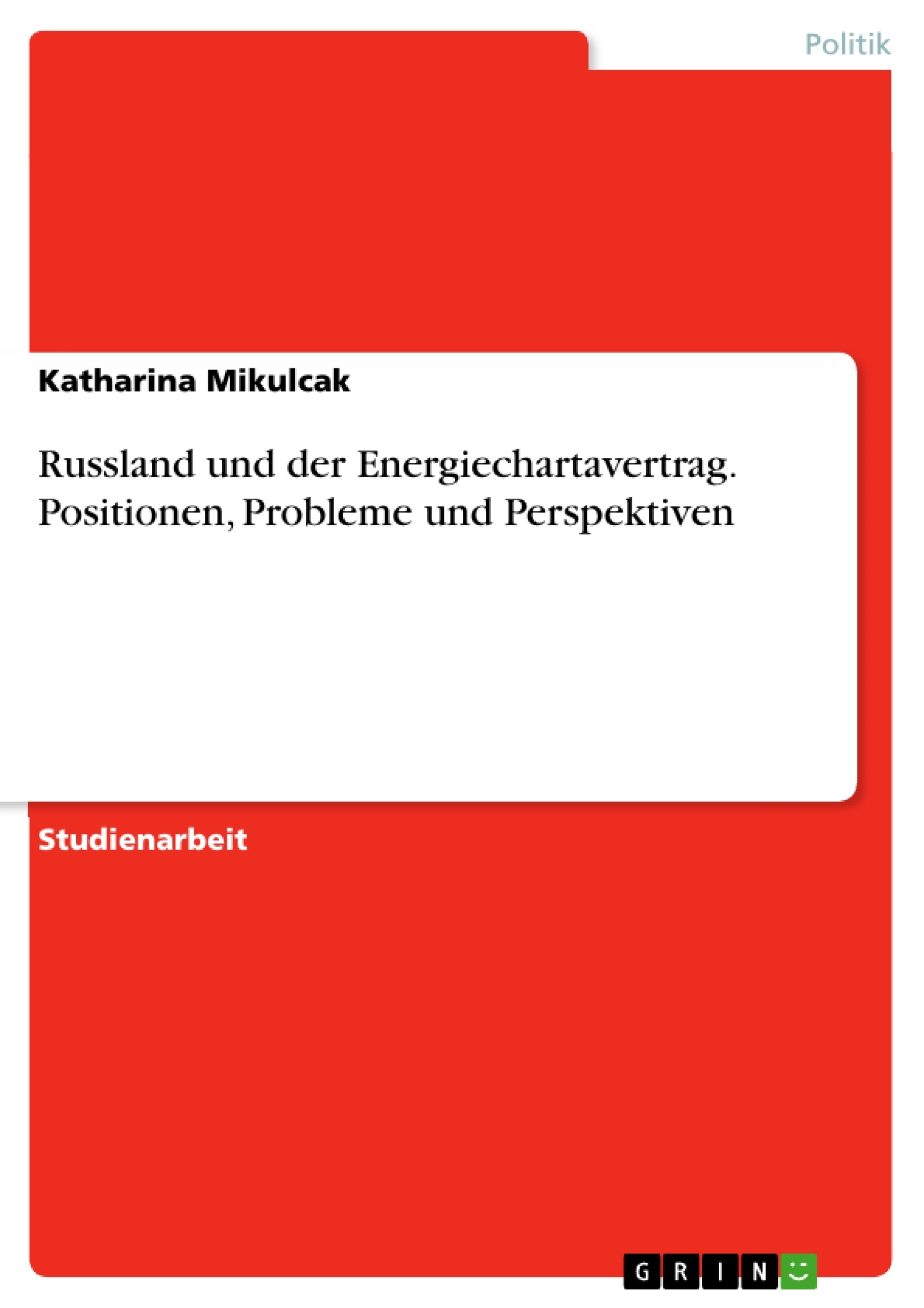Dass die Energiereserven weltweit abnehmen ist durchaus kein neues Phänomen. Der Gedanke, der Ressourcenknappheit mit internationalen Regelwerken entgegenzuwirken und dadurch eine kalkulierbare Verteilung zu ermöglichen, manifestierte sich jedoch erst in den 1990er Jahren.
Das ist vor allem dadurch begründet, dass es erst mit dem Zusammenbruch des Ostblockes möglich wurde, weltweit verbindliche Regelwerke zu forcieren. Besonders die Öffnung Russlands spielte für den Energieweltmarkt eine herausragende Rolle, da dort die größten Erdgasreserven der Erde lagern. Der Zerfall der Sowjetunion war jedoch auch eine Phase unkalkulierbarer wirtschaftlicher und politischer Instabilitäten. Deshalb war es gerade für die Europäische Gemeinschaft von besonderem Interesse, die Länder aus dem Einflussbereich der UDSSR zu unterstützen und in ihre Regelwerke einzubinden.
Ein solches Vertragswerk ist der 1994 unterzeichnete Energiechartavertrag, das erste internationale und völkerrechtlich verbindliche Vertragswerk für den Energiesektor. Zunächst wurde es als großer Erfolg gefeiert, da erstmals die Sowjetunion beziehungsweise Russland tatsächlich in ein derartiges Vertragswerk eingebunden war. Auf die Euphorie folgte jedoch bald Ernüchterung: Russland hat den Energiechartavertrag zwar unterzeichnet, jedoch bis heute nicht ratifiziert. Im Jahre 2003 hat Russland obendrein die Verhandlungen zur Ratifizierung abgebrochen. Unüberbrückbare Differenzen bezüglich der Vertragsinhalte, wie zum Beispiel der geplante Abschluss eines Transitprotokolls, das das Monopol der Russen über die Leitungsnetze einschränken könnte und die mit dem Vertrag verbundene Übernahme der WTO-Standards für den Handel mit Energieerzeugnissen, werden von russischer Seite als Gründe dafür angeführt. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Rolle Russland beim Energiechartavertrag tatsächlich einnimmt beziehungsweise welchen Stellenwert der Vertrag für Russland hat. Russlands Position gegenüber dem Vertrag möchte werden abschließend aus neorealistischer Perspektive politikwissenschaftlich bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Energiechartavertrag
- Entstehungsprozess
- Ziele und ausgewählte Vertragsinhalte
- Akteurskonstellationen im Energiechartavertrag
- Die Ausgangssituation und Interessen der Europäischen Union
- Die energiepolitische Bedeutung der Russischen Föderation
- Russische Positionen im Ratifizierungsverfahren
- Streitpunkt: Transitprotokoll
- Fehlende Anreizstruktur nach Kyoto und die Debatte um Russlands WTO-Beitritt
- Aktuelle Situation und Perspektiven
- Politikwissenschaftliche Einordnung und Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle Russlands im Energiechartavertrag und analysiert den Stellenwert des Vertrags für die Russische Föderation. Dabei wird die russische Position gegenüber dem Vertrag unter neorealistischer Perspektive politikwissenschaftlich bewertet.
- Die Analyse fokussiert auf die Abhängigkeit der EU von russischen Energieimporten.
- Die Arbeit beleuchtet die russische Energiepolitik und die Rolle von bilateralen Verhandlungen.
- Die Untersuchung analysiert die Problemstrukturen im Energiechartavertrag und die Bedeutung der WTO-Beitrittsverhandlungen.
- Die Arbeit betrachtet Russland als rationalen Nutzenmaximierer in der Staatengemeinschaft und untersucht die Anreizstruktur des Vertrags.
- Die Untersuchung untersucht die Auswirkungen der Ratifizierungsverhandlungen auf die WTO-Beitrittsverhandlungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Hintergrund der Arbeit dar.
- Kapitel 1 beschreibt den Entstehungsprozess des Energiechartavertrags und erläutert seine Ziele sowie ausgewählte Vertragsinhalte.
- Kapitel 2 untersucht die Akteurskonstellationen im Energiechartavertrag, insbesondere die Interessen der Europäischen Union und die energiepolitische Bedeutung der Russischen Föderation.
- Kapitel 3 analysiert die russischen Positionen im Ratifizierungsverfahren, insbesondere den Streitpunkt Transitprotokoll und die fehlende Anreizstruktur nach dem Kyoto-Protokoll im Zusammenhang mit Russlands WTO-Beitritt.
- Kapitel 4 beleuchtet die aktuelle Situation und Perspektiven bezüglich des Energiechartavertrags und der russischen Position.
- Kapitel 5 bietet eine politikwissenschaftliche Einordnung und Bewertung der Rolle Russlands im Energiechartavertrag unter neorealistischer Perspektive.
Schlüsselwörter
Energiechartavertrag, Russland, Europäische Union, WTO, Energiepolitik, neorealistische Perspektive, Anreizstruktur, Transitprotokoll, Abhängigkeit, bilaterale Verhandlungen, Kyoto-Protokoll.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Energiechartavertrag (ECT)?
Der 1994 unterzeichnete Energiechartavertrag ist das erste internationale und völkerrechtlich verbindliche Vertragswerk für den Energiesektor, das Investitionsschutz und Transitregeln festlegt.
Warum hat Russland den Energiechartavertrag nicht ratifiziert?
Russland hat Bedenken bezüglich des Transitprotokolls, das sein Monopol über die Leitungsnetze einschränken könnte, und sieht in dem Vertrag eine zu starke Übernahme von WTO-Standards.
Welche Rolle spielt das Transitprotokoll in dem Streit?
Das Transitprotokoll ist ein zentraler Streitpunkt, da es den diskriminierungsfreien Zugang zu russischen Pipelines fordern würde, was den russischen Interessen an Kontrolle über den Energieexport widerspricht.
Wie hängen der ECT und Russlands WTO-Beitritt zusammen?
Die Verhandlungen über die Ratifizierung des ECT waren eng mit den WTO-Beitrittsverhandlungen verknüpft, da die EU den Vertrag als Maßstab für marktwirtschaftliche Standards im Energiesektor sieht.
Was bedeutet die neorealistische Perspektive in dieser Analyse?
Aus neorealistischer Sicht wird Russland als rationaler Akteur betrachtet, der seinen Nutzen in der Staatengemeinschaft maximiert und Verträge nur dann ratifiziert, wenn sie seine nationale Macht und Sicherheit nicht gefährden.
Wie abhängig ist die EU von russischen Energieimporten?
Die EU hat ein großes Interesse am ECT, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, da sie stark von russischen Erdgasreserven abhängig ist.
- Citar trabajo
- Katharina Mikulcak (Autor), 2006, Russland und der Energiechartavertrag. Positionen, Probleme und Perspektiven, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73471