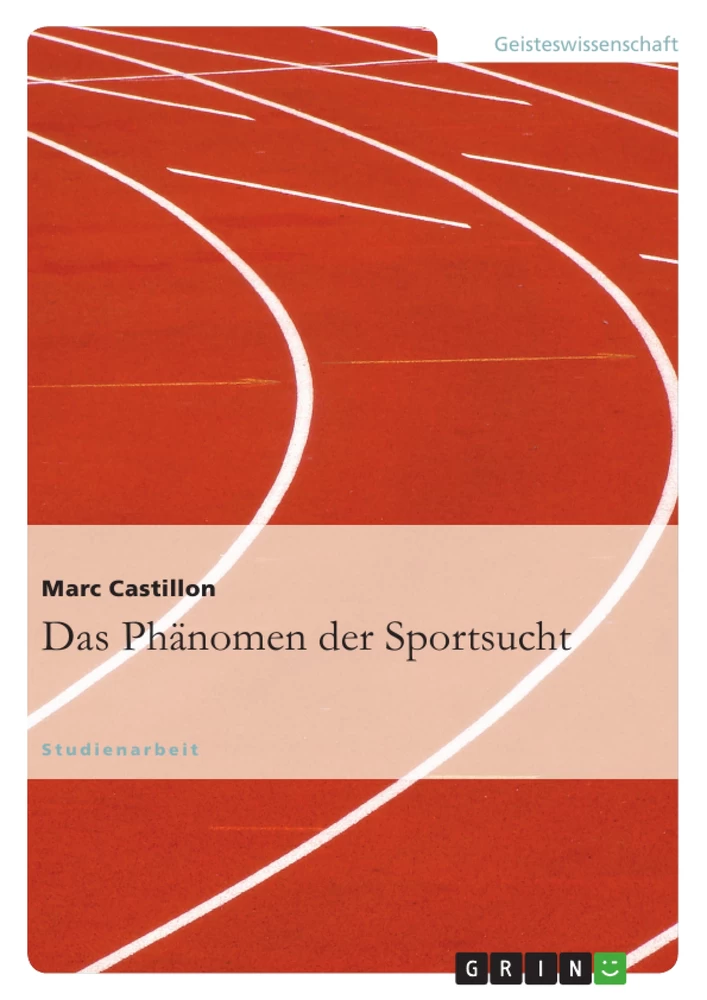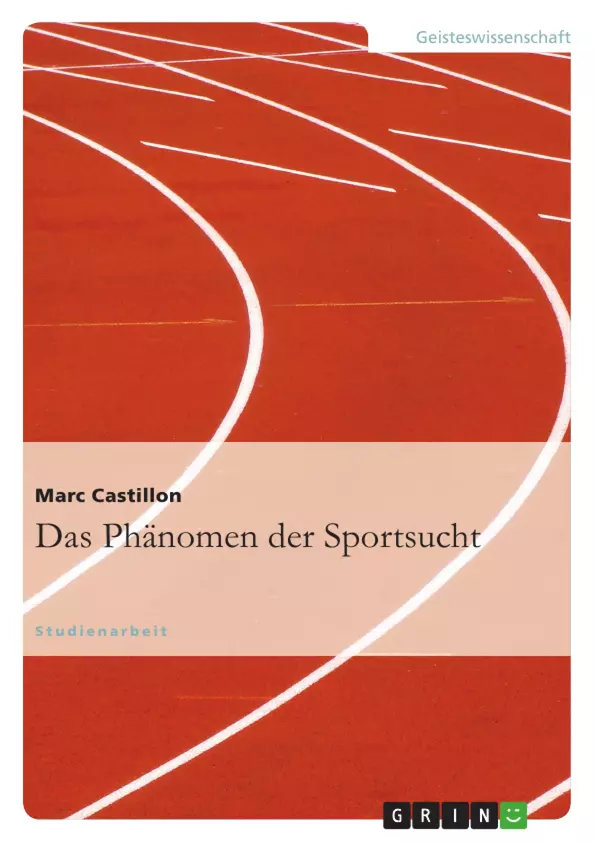Der Begriff Sport, von seiner Bedeutungszuweisung soviel wie Zerstreuung, Vergnügen bedeutend, ist in den westlichen Gesellschaften, in denen immer weniger körperliche Arbeit anfällt, fast zum Synonym für körperliche Anstrengung geworden. Das Phänomen Sport spiegelt das Leistungs-, Konkurrenz- und Gleichheitsprinzip unserer Industriegesellschaft wider.
Und in der Tat ist unbestritten, dass eine regelmäßige Bewegung einen positiven Effekt auf Körper und Geist hat. Zwei- bis dreimal pro Woche für 30 bis 60 Minuten Ausdauersport ist sportmedizinisch empfehlenswert. Doch was wenn das Gesunde dem Pathologischen weicht? Bei den Olympischen Spielen in Athen 1896 wurde zum Gedenken an den Lauf des Boten Pheidippides der Marathonlauf (42,195 km) als längste Laufdisziplin ausgetragen. Inzwischen wird das Vielfache dieser Strecke ohne Unterbrechung zurückgelegt, bis hin zum ca. 4700 km langen Ultra-Langstreckenlauf quer durch Nordamerika.
Obwohl das Phänomen der Sportsucht bereits 1970 durch Baekelund entdeckt wurde, rückte der pozentielle Suchtcharakter von Sport erst in den letzten zwanzig Jahren verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit und Wissenschaft – u. a. bedingt durch die Entwicklung der Laufbewegung Ende der 1970er Jahre und durch die im Zuge der sich entwickelnden Fitnesswelle fast schon inflationär zu nennende Anzahl an Fitnessstudioeröffnungen in den USA und wenig später in Europa.
Die Sportsucht ist eine Verhaltenssucht nichtstoffgebundener Art und kann in ihrer Form in sämtlichen Sportarten auftreten. Das Wesen der Sportsucht ist sowohl aus der Bodybuilderszene bekannt – dann sprechen wir von einer Bodybuilding- bzw. Muskelsucht (Muskeldysmorphie) – als auch aus dem Ausdauerbereich (Lauf- oder Ausdauersucht). Auch Risikosportarten rücken hier suchtspezifisch verstärkt in den Fokus.
In diesem kleinen Büchlein werden die Erkenntnisse über den noch relativ jungen Untersuchungsgegenstand Ausdauersucht zusammenfassend dargestellt. Zunächst ist es unabdingbar, den Begriff Verhaltenssucht zu definieren. Dann wird die Phänomenologie der Laufsucht umfassend dargestellt, und zwar durch eine Definitionsherleitung einhergehend mit einer Herausarbeitung diagnostischer Kriterien. Thematisiert werden auch die die Sportsucht fördernden Umstände und die Ursachen von Sportsucht. Zu fragen ist darüber hinaus, welche suchtspezifischen Entzugssymptome beim Unterlassen des Sports auftreten. Anschließend werden Therapieransätze und -möglichkeiten vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Störungsbild der Verhaltenssucht – ein Definitionsversuch
- III. Ausdauersucht
- 1. Beispiel
- 2. Definition und Phänomenologie
- 2.1. Kategorie I
- 2.2. Kategorie II
- 2.3. Kategorie III
- 2.4. Gesundes vs. pathologisches Sporttreiben
- 3. Diagnostik
- 4. Ausdauersucht fördernde Umstände
- 5. Ursachen
- 5.1. Physiologische Erklärungsansätze
- 5.2 Psychologische Erklärungsansätze
- 6. Entzugssymptome
- 7. Therapie
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, das Verständnis der Ausdauersucht als Teilbereich der Sportsucht zu vertiefen. Aufgrund des begrenzten Umfangs werden Risikosportarten und Bodybuilding-Sucht nicht behandelt. Die Arbeit fokussiert auf die Definition von Verhaltenssucht, die Phänomenologie der Ausdauersucht inklusive diagnostischer Kriterien, fördernde Umstände, Ursachen (physiologische und psychologische Aspekte) und Therapieansätze.
- Definition und Abgrenzung von Verhaltenssucht im Kontext von Sportsucht
- Phänomenologie und diagnostische Kriterien der Ausdauersucht
- Ursachen der Ausdauersucht: physiologische und psychologische Erklärungsansätze
- Entzugssymptome bei Ausdauersucht
- Therapieansätze und -möglichkeiten bei Ausdauersucht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ausdauersucht ein und stellt den Wandel des Begriffs "Sport" in westlichen Gesellschaften dar. Sie verortet die Ausdauersucht im Kontext der zunehmenden Verbreitung von Fitness und Extremsport und erwähnt die zufällige Entdeckung des Phänomens durch Baekelund. Die Arbeit wird strukturiert und die Grenzen des Umfangs hinsichtlich der behandelten Themen (Ausklammerung von Risikosport und Bodybuilding) werden definiert.
II. Das Störungsbild der Verhaltenssucht – ein Definitionsversuch: Dieses Kapitel unternimmt einen Definitionsversuch des Begriffs "Verhaltenssucht". Es beschreibt das Wesen der Sucht als eine Spirale des "Mehr" und "Nochmals", verbunden mit einem Kontrollverlust und der Erzeugung von Lustzuständen oder Verminderung von Unlustzuständen. Der fehlende explizite Eintrag von Verhaltenssucht in Klassifikationssystemen wie ICD-10 und DSM-IV-TR wird diskutiert, wobei das "Pathologische Glücksspiel" als Ausnahme erwähnt wird. Diagnostische Kriterien werden anhand von Grüsser-Sinopoli und Grüsser/Thalemann vorgestellt und mit den Kriterien der Substanzabhängigkeit verglichen.
III. Ausdauersucht: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Ausdauersucht. Es beginnt mit einem persönlichen Beispiel eines Sportjournalisten, um das Phänomen zu veranschaulichen und die diagnostischen Kriterien zu illustrieren. Drei Kategorien von Definitionsversuchen der Ausdauersucht werden präsentiert, beginnend mit positiven/negativen Unterscheidungen, weitergehend zu zeitlichen und mengenbezogenen Komponenten, und schließlich zur Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Ausdauersucht im Zusammenhang mit Essstörungen. Der Unterschied zwischen gesundem und pathologischem Sporttreiben wird anhand von verschiedenen Sportprofilen erläutert. Die Diagnostik wird durch die Zusammenfassung von Items verschiedener Fragebögen dargestellt. Es werden fördernde Umstände (individuelle, soziale und gesellschaftliche Faktoren) und Ursachen (physiologische und psychologische Erklärungsansätze) analysiert, wobei die Endorphin-, Katecholamin- und Dopaminhypothese beleuchtet und kritisch bewertet werden. Das Kapitel beschreibt die Entzugssymptome bei Ausdauersucht, die in verschiedenen Studien untersucht wurden. Schließlich werden Therapieansätze beleuchtet, die sich auf kognitive Prozesse und Verhaltensmanagement konzentrieren.
Schlüsselwörter
Ausdauersucht, Sportsucht, Verhaltenssucht, Diagnostik, Therapie, Physiologische Erklärungsansätze, Psychologische Erklärungsansätze, Entzugssymptome, Endorphine, Dopamin, Katecholamine, Flow-Erlebnis, Selbstwertgefühl, Körperkult.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Ausdauersucht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Ausdauersucht als Teilbereich der Sportsucht. Sie untersucht die Definition von Verhaltenssucht, die Phänomenologie der Ausdauersucht, diagnostische Kriterien, fördernde Umstände, Ursachen (physiologische und psychologische Aspekte) und Therapieansätze. Risikosportarten und Bodybuilding-Sucht werden aufgrund des begrenzten Umfangs nicht behandelt.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Definition von Verhaltenssucht, Ausdauersucht (mit Unterkapiteln zu Definition, Diagnostik, Ursachen, Entzugssymptomen und Therapie) und Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Wie wird Verhaltenssucht definiert?
Die Hausarbeit unternimmt einen Definitionsversuch von Verhaltenssucht, indem sie Sucht als eine Spirale des "Mehr" und "Nochmals" beschreibt, verbunden mit Kontrollverlust und der Erzeugung von Lustzuständen oder Verminderung von Unlustzuständen. Der fehlende explizite Eintrag von Verhaltenssucht in Klassifikationssystemen wie ICD-10 und DSM-IV-TR wird diskutiert, wobei das "Pathologische Glücksspiel" als Ausnahme erwähnt wird. Diagnostische Kriterien werden anhand von Grüsser-Sinopoli und Grüsser/Thalemann vorgestellt und mit den Kriterien der Substanzabhängigkeit verglichen.
Wie wird Ausdauersucht definiert und kategorisiert?
Die Arbeit präsentiert drei Kategorien von Definitionsversuchen der Ausdauersucht: positive/negative Unterscheidungen, zeitliche und mengenbezogene Komponenten, und die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Ausdauersucht im Zusammenhang mit Essstörungen. Die Definition wird anhand von Beispielen und Fallstudien illustriert.
Welche diagnostischen Kriterien werden für Ausdauersucht verwendet?
Die Diagnostik wird durch die Zusammenfassung von Items verschiedener Fragebögen dargestellt. Die Arbeit beschreibt detailliert die Kriterien zur Unterscheidung zwischen gesundem und pathologischem Sporttreiben.
Welche Ursachen für Ausdauersucht werden behandelt?
Die Hausarbeit analysiert sowohl physiologische als auch psychologische Erklärungsansätze. Physiologische Ansätze konzentrieren sich auf die Rolle von Endorphinen, Katecholaminen und Dopamin. Psychologische Aspekte, wie z.B. der Einfluss von Selbstwertgefühl und dem Flow-Erlebnis, werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Entzugssymptome treten bei Ausdauersucht auf?
Die Arbeit beschreibt die Entzugssymptome bei Ausdauersucht, die in verschiedenen Studien untersucht wurden.
Welche Therapieansätze werden bei Ausdauersucht vorgeschlagen?
Die Hausarbeit beleuchtet Therapieansätze, die sich auf kognitive Prozesse und Verhaltensmanagement konzentrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Ausdauersucht, Sportsucht, Verhaltenssucht, Diagnostik, Therapie, Physiologische Erklärungsansätze, Psychologische Erklärungsansätze, Entzugssymptome, Endorphine, Dopamin, Katecholamine, Flow-Erlebnis, Selbstwertgefühl, Körperkult.
- Citation du texte
- Marc Castillon (Auteur), 2007, Das Phänomen der Sportsucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73576