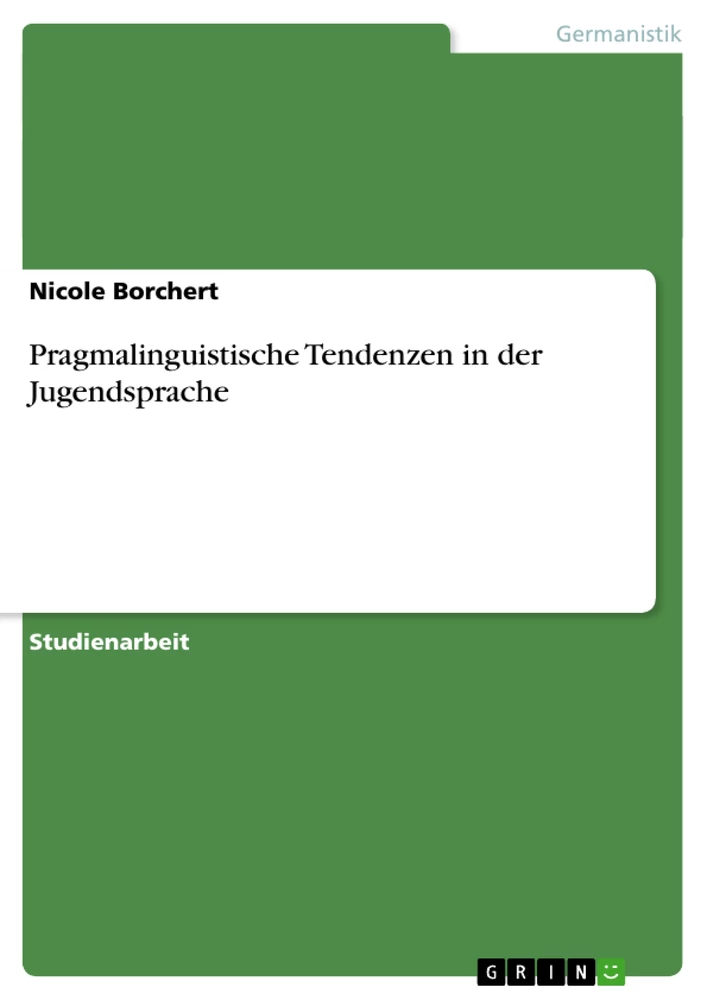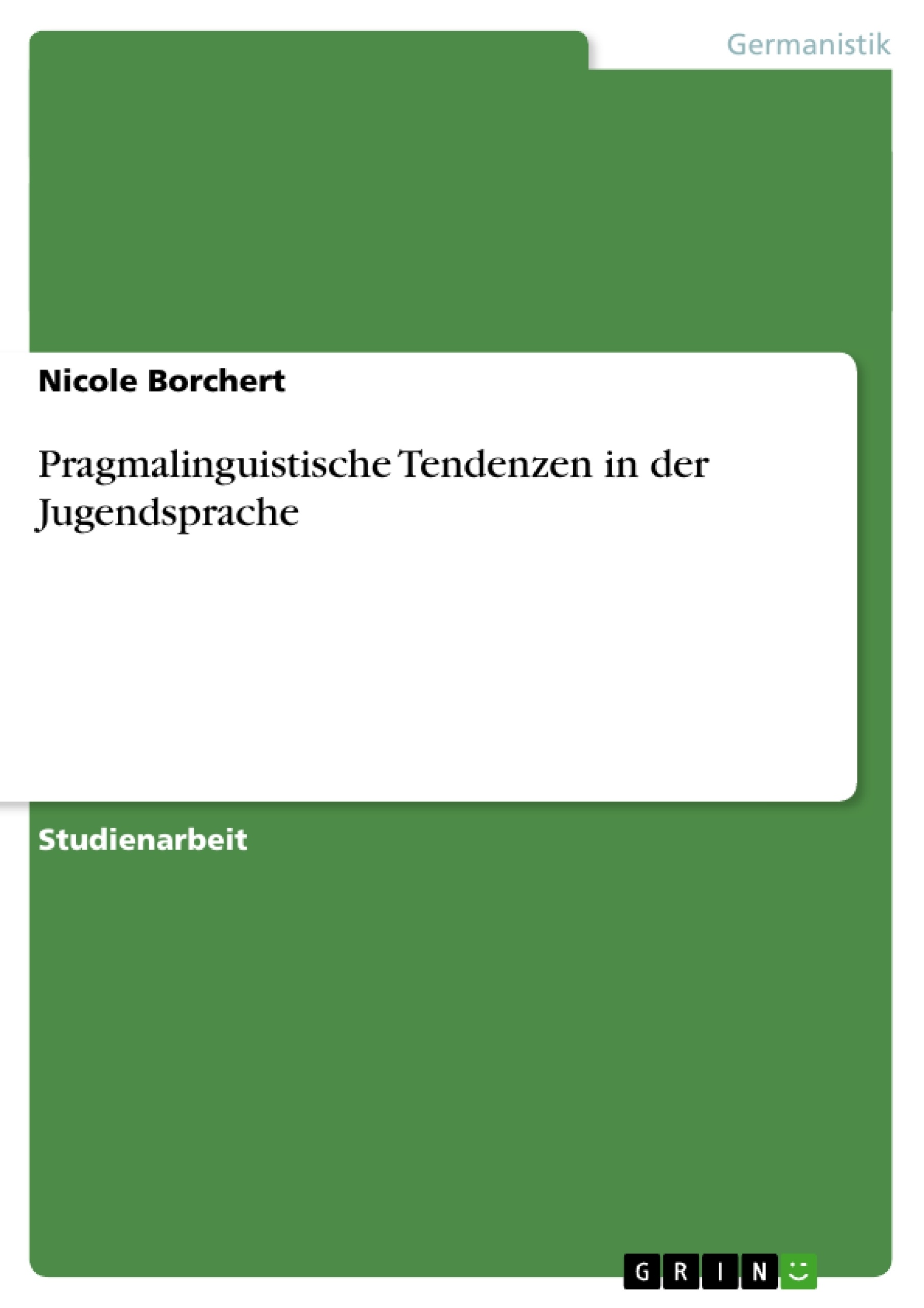Die Entdeckung der sprachlichen, generationstypischen Eigenarten einer bestimmten sozialen Gruppe begann im 18. Jahrhundert, als Sprache und Sprachverhalten der akademischen Jugend erstmals aufgezeichnet wurden. Seit jeher galt die Sprache der Jugend als besondere Sprachform, die oftmals als Normabweichung und -verletzung wahrgenommen wurde. Man begann Jugendsprache systematisch und wissenschaftlich zu untersuchen, indem man zunächst den abweichenden Wortschatz gesondert analysierte.
Ende der achtziger Jahre fand innerhalb der Jugendsprachforschung ein Paradigmenwechsel statt; Gegenstand der Untersuchungen ist seitdem weniger die Lexikographie, sondern vielmehr die „Ethnographie des Sprechens“ (vgl. Schlobinski 2002: 17).
Durch diesen Perspektivenwechsel entstand eine Neuorientierung der Forschung auf sozio- und pragmalinguistische Aspekte. Es wurden nicht mehr Datenerhebungen mit Wortlisten ausgewertet, sondern konkrete Sprechereignisse in Gebrauchskontexten analysiert.
Der Fokus wird seit jeher weniger auf die kontextunabhängige Wortwahl der Jugendlichen gelegt, vielmehr geht es in neuen Ansätzen der Jugendsprachforschung um praktizierte Sprachmuster und erkennbare Tendenzen in den Jugendsprachen. Zu diesem Zweck werden spezifische Sprachvarianten als Bausteine eines Sprachstils betrachtet.
Jugendsprachen werden nach diesem Ansatz nicht primär auf den spezifischen Wortschatz untersucht, sondern als Sprechstile aufgefasst, die gruppen- und situationsabhängig variieren (vgl. Chovan 2003. 348).
Durch den starken Einfluss der Medien sowie der Fremd- und Sondersprachen unterliegt die Jugendsprache einem schnellen Wandel, der unter anderem durch Zugehörigkeitsbestätigung in der Gruppe, sowie Abgrenzung gegenüber externer Gruppen beschleunigt wird. Phänomene in der Jugendsprache unterliegen rasanten Veränderungen; Jugendsprachliches veraltet schneller als andere sprachliche Formen und wird schneller von anderen Elementen ersetzt. Die schnellen Entwicklungstendenzen können dementsprechend als Anzeichen eines allgemein beschleunigten Sprachwandels gelten. Da viele jugendspezifische Sprechweisen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen, werden die Jugendsprachen allgemein als Entwicklungstendenzen der Gegenwartssprache betrachtet (vgl. Volmert 2004: 141).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wortbildung und Wortschatz
- 2.1 Sprachliche Attribuierungen und Kompositionen
- 2.2 Verkürzungen und „Comic-Sprache“
- 2.3 Prä- und Suffixe
- 2.4 Anglizismen
- 2.5 Vulgarismen
- 3. Stilistische Tendenzen
- 3.1 Neologismen und Umdeutungen
- 3.2 Sprachspiele: Das Verfahren der „Bricolage“
- 3.3 Kommunikative Praktiken
- 4. Sprachwandel innerhalb der Jugendsprache
- 5. Resümee und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht pragmalinguistische Tendenzen in der Jugendsprache. Ziel ist es, sprachliche Auffälligkeiten im Wortschatz und der Wortbildung sowie stilistische Tendenzen im Sprachgebrauch Jugendlicher aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet auch die kommunikativen Praktiken von Peer-Groups und die Einflüsse, die den schnellen Sprachwandel in der Jugendsprache bewirken.
- Wortbildung und Wortschatz in der Jugendsprache
- Stilistische Tendenzen und Sprachspiele
- Kommunikative Praktiken jugendlicher Peer-Groups
- Sprachwandel und dessen Geschwindigkeit in der Jugendsprache
- Einflüsse auf die Entwicklung der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Geschichte der Jugendsprachforschung, beginnend mit frühen Aufzeichnungen der akademischen Jugendsprache im 18. Jahrhundert. Sie beschreibt den Paradigmenwechsel in den 1980er Jahren, der den Fokus von der Lexikographie auf die sozio- und pragmalinguistischen Aspekte verlagerte. Die Arbeit betont den schnellen Wandel der Jugendsprache, beeinflusst durch Medien, Fremdsprachen und den Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung. Jugendsprache wird als Vorbote des Sprachwandels gesehen, da neue Elemente zuerst in der Jugendsprache auftauchen und später in die Allgemeinsprache übergehen. Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung pragmalinguistischer Tendenzen in der Jugendsprache anhand von Beispielen.
2. Wortbildung und Wortschatz: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Wortbildung und des Wortschatzes in der Jugendsprache. Es beschreibt die Verwendung von Hyperbeln, die durch adjektivische Attribuierungen und adverbiale Verstärkungen ausgedrückt werden (z.B., „riesig“, „kosmisch“). Die Verwendung von Präfixoiden wie „super-“, „hyper-“, „mega-“ und „ultra-“ zur Steigerung wird ebenfalls diskutiert. Weiterhin wird die ambivalente Verwendung von Wörtern wie „krass“, „tierisch“ und „cool“ erläutert, die je nach Kontext positiv oder negativ konnotiert sein können. Schließlich wird die Bildung von Komposita mit dem Wort „geil“ und die Variante „geilo“ als Beispiel für Abgrenzung gegenüber der Allgemeinsprache untersucht.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Pragmalinguistische Tendenzen in der Jugendsprache
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht pragmalinguistische Tendenzen in der Jugendsprache. Sie analysiert sprachliche Auffälligkeiten im Wortschatz und der Wortbildung sowie stilistische Tendenzen im Sprachgebrauch Jugendlicher. Ein weiterer Fokus liegt auf den kommunikativen Praktiken von Peer-Groups und den Einflüssen, die den schnellen Sprachwandel in der Jugendsprache bewirken.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themen: Wortbildung und Wortschatz in der Jugendsprache, stilistische Tendenzen und Sprachspiele, kommunikative Praktiken jugendlicher Peer-Groups, Sprachwandel und dessen Geschwindigkeit, sowie Einflüsse auf die Entwicklung der Jugendsprache.
Welche Aspekte der Wortbildung und des Wortschatzes werden analysiert?
Das Kapitel zur Wortbildung und zum Wortschatz analysiert die Verwendung von Hyperbeln durch adjektivische Attribuierungen und adverbiale Verstärkungen (z.B. „riesig“, „kosmisch“), die Verwendung von Präfixoiden wie „super-“, „hyper-“, „mega-“ und „ultra-“, die ambivalente Verwendung von Wörtern wie „krass“, „tierisch“ und „cool“, und die Bildung von Komposita mit dem Wort „geil“ und der Variante „geilo“.
Welche stilistischen Tendenzen werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Neologismen und Umdeutungen, Sprachspiele (insbesondere das Verfahren der „Bricolage“) und kommunikative Praktiken. Die Analyse beinhaltet die Untersuchung von sprachlichen Attribuierungen und Kompositionen, Verkürzungen und „Comic-Sprache“, Prä- und Suffixe, Anglizismen und Vulgarismen.
Wie wird der Sprachwandel in der Jugendsprache dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den schnellen Wandel der Jugendsprache, beeinflusst durch Medien, Fremdsprachen und den Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung. Jugendsprache wird als Vorbote des Sprachwandels gesehen, da neue Elemente zuerst in der Jugendsprache auftauchen und später in die Allgemeinsprache übergehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Wortbildung und Wortschatz, Stilistische Tendenzen, Sprachwandel innerhalb der Jugendsprache und Resümee und Stellungnahme. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der pragmalinguistischen Tendenzen in der Jugendsprache.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beleuchtet die Geschichte der Jugendsprachforschung, beginnend mit frühen Aufzeichnungen der akademischen Jugendsprache im 18. Jahrhundert. Sie beschreibt den Paradigmenwechsel in den 1980er Jahren und betont den schnellen Wandel der Jugendsprache, beeinflusst durch Medien, Fremdsprachen und den Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit und Abgrenzung. Das Ziel der Arbeit wird als Darstellung pragmalinguistischer Tendenzen in der Jugendsprache anhand von Beispielen definiert.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Resümee und die Stellungnahme werden im Kapitel 5 detailliert behandelt und sind in der gegebenen Textvorlage nicht vollständig wiedergegeben.)
- Quote paper
- Nicole Borchert (Author), 2006, Pragmalinguistische Tendenzen in der Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73626