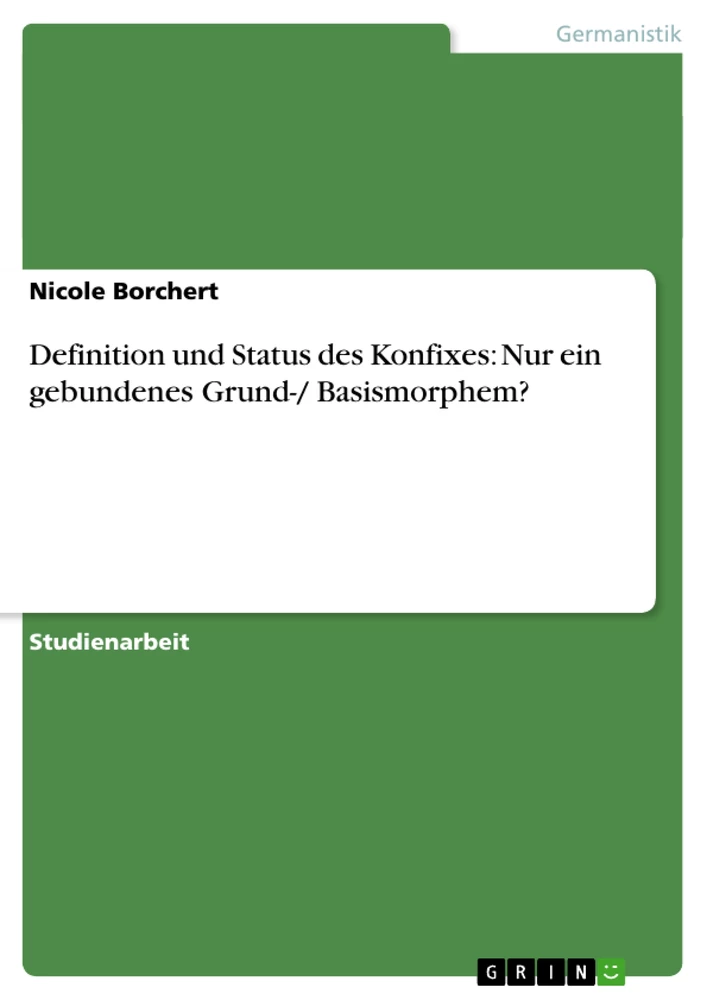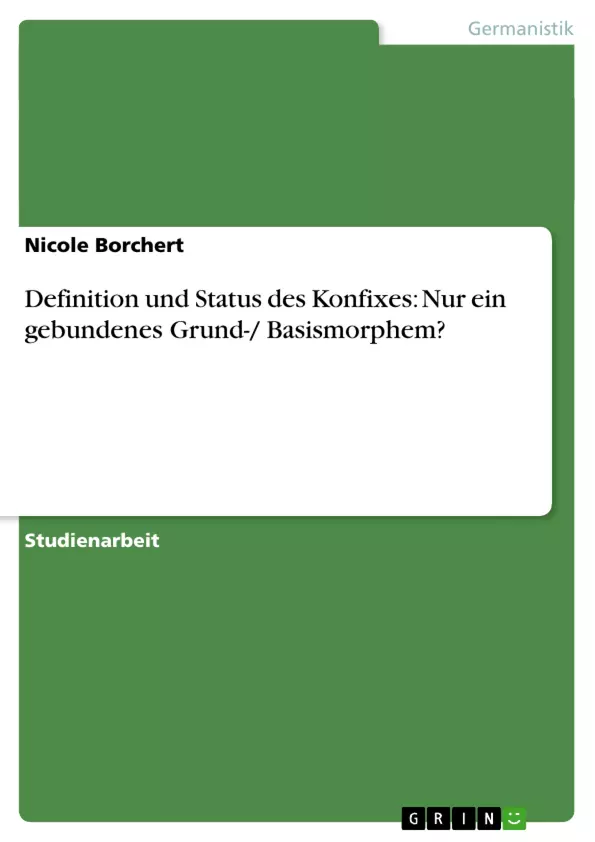Im Deutschen zählen freie lexikalische Morpheme, Affixe und Konfixe zu den produktiven Mitteln der Wortbildung. Ersteres meint die frei vorkommenden Einheiten, sprich Wörter, zweiteres bezeichnet die verschiedenen Prä- und Suffixe der Wortbildung, wie zum Beispiel un-; -heit: -keit. Über Definition und Status des Konfixes in der deutschen Wortbildungslehre herrscht hingegen kein wissenschaftlicher Konsens.
Ein Grund hierfür könnte sein, dass das Konfix sprachhistorisch noch nicht sehr lange zu den drei zentralen Einheiten der deutschen Wortbildung gehört, und dementsprechend ein relativ neuer Forschungsgegenstand derselbigen darstellt (vgl. Donalies 2000: 144). Das Konfix taucht erst seit den achtziger Jahren maßgeblich in der Forschungsliteratur auf, wird jedoch seitdem immer mehr als Gegenstand der deutschen Wortbildung thematisiert.
Meist wird darin das Konfix durch eine Abgrenzungsdefinition bestimmt, indem vorrangig Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Wortbildungseinheiten herausgestellt werden.
So gilt die Gebundenheit als Hauptmerkmal zur Abgrenzung der Konfixe von Wörtern beziehungsweise freien lexikalischen Einheiten, die Derivationsbasisfähigkeit hingegen zur Abgrenzung von den Wortbildungsaffixen (vgl. Donalies 2000: 144).
Auch wenn sich die Kategorie Konfix mittlerweile als Wortbildungseinheit und wissenschaftlicher Terminus neben Lexemen und Affixen in der Forschungsliteratur und in den Einführungen zur Wortbildung etabliert hat, wird der Begriff bisweilen sehr strittig und widersprüchlich verwendet.
Da dem Konfix meist eine Zwischenstellung zwischen frei vorkommenden Grundmorphemen und Affixen zugesprochen wird (vgl. Lohde 2006: 78), werden unter dem Begriff Konfix häufig solche morphologischen Einheiten zusammengefasst, die gebunden und trotzdem basisfähig sind. Aufgrund dieser weitgefassten Zwischenstellung bezeichnen einige Autoren die Kategorie der Konfixe als „gebundene Grundmorpheme“ (Fleischer/ Barz 1995: 25).
Als weiteres Abgrenzungsproblem stellt sich, dass sich einige Konfixe wie mini- im allgemeinen Sprachgebrauch als eigenständige Wörter etablieren, wodurch der Status des Konfixes zunehmend problematisch zu werden beginnt (vgl. Fleischer/ Barz 1995: 120).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Stellung des Konfixes in der Wortbildung
- 2.1 Definitionsansätze
- 2.2 Abgrenzungsprobleme
- 3. Resümee und Stellungnahme
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und dem Status des Konfixes in der deutschen Wortbildung. Es wird untersucht, ob das Konfix ausschließlich als gebundenes Grund- oder Basismorphem zu verstehen ist. Der Fokus liegt auf der Analyse der Abgrenzungsprobleme und der verschiedenen in der Forschungsliteratur vertretenen Positionen.
- Definition des Konfixes und seine Stellung in der deutschen Wortbildung
- Abgrenzungsprobleme zwischen Konfixen, Wörtern und Affixen
- Analyse von Definitionsansätzen aus der Forschungsliteratur
- Diskussion des Status des Konfixes als gebundenes Grund-/ Basismorphem
- Bedeutung der Basisfähigkeit und Kompositionsgliedfähigkeit von Konfixen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt das Konfix als produktives Mittel der deutschen Wortbildung vor und erläutert die wissenschaftliche Diskussionslage hinsichtlich dessen Status und Definition.
- Kapitel 2: Zur Stellung des Konfixes in der Wortbildung - Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionsansätze für das Konfix und untersucht die Abgrenzungsprobleme zu Wörtern und Affixen. Dabei werden die Gebundenheit, die Basisfähigkeit und die Kompositionsgliedfähigkeit des Konfixes als wichtige Unterscheidungskriterien diskutiert.
Schlüsselwörter
Konfix, Wortbildung, deutsche Sprache, Morphologie, Grundmorphem, Basismorphem, Abgrenzung, Gebundenheit, Basisfähigkeit, Kompositionsgliedfähigkeit, Forschungsliteratur, Definitionsansätze, wissenschaftliche Diskussionslage.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Konfix" in der Sprachwissenschaft?
Ein Konfix ist eine Wortbildungseinheit, die wie ein Wort eine lexikalische Bedeutung hat, aber nicht allein vorkommen kann (gebunden ist), wie z. B. "biblio-" in Bibliothek oder "therm-" in Thermometer.
Wie unterscheidet sich ein Konfix von einem Affix?
Während Affixe (wie -heit oder un-) rein grammatische Funktionen haben, sind Konfixe "basisfähig", das heißt, sie können den Kern eines neuen Wortes bilden und tragen eine stärkere inhaltliche Bedeutung.
Warum ist der Status des Konfixes in der Wortbildungslehre umstritten?
Da Konfixe eine Zwischenstellung zwischen freien Wörtern und gebundenen Affixen einnehmen, herrscht kein Konsens, ob sie als "gebundene Grundmorpheme" oder als eigene Kategorie eingestuft werden sollen.
Was bedeutet "Gebundenheit" bei einem Morphem?
Gebundenheit bedeutet, dass die Einheit niemals isoliert als eigenständiges Wort in einem Satz auftreten kann, sondern immer mit anderen Morphemen kombiniert werden muss.
Welche Rolle spielen Konfixe für die moderne deutsche Sprache?
Konfixe sind hochgradig produktiv, besonders in der Fachsprache und bei der Integration von Fremdwörtern, und ermöglichen die Bildung zahlreicher neuer Begriffe.
- Citar trabajo
- Nicole Borchert (Autor), 2007, Definition und Status des Konfixes: Nur ein gebundenes Grund-/ Basismorphem?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73629