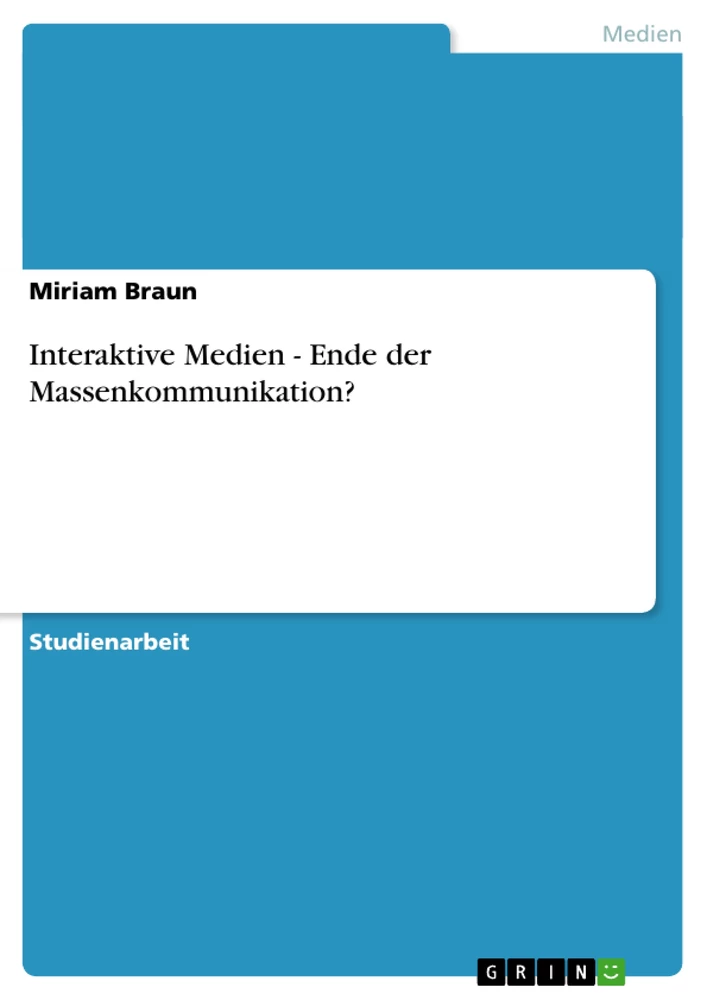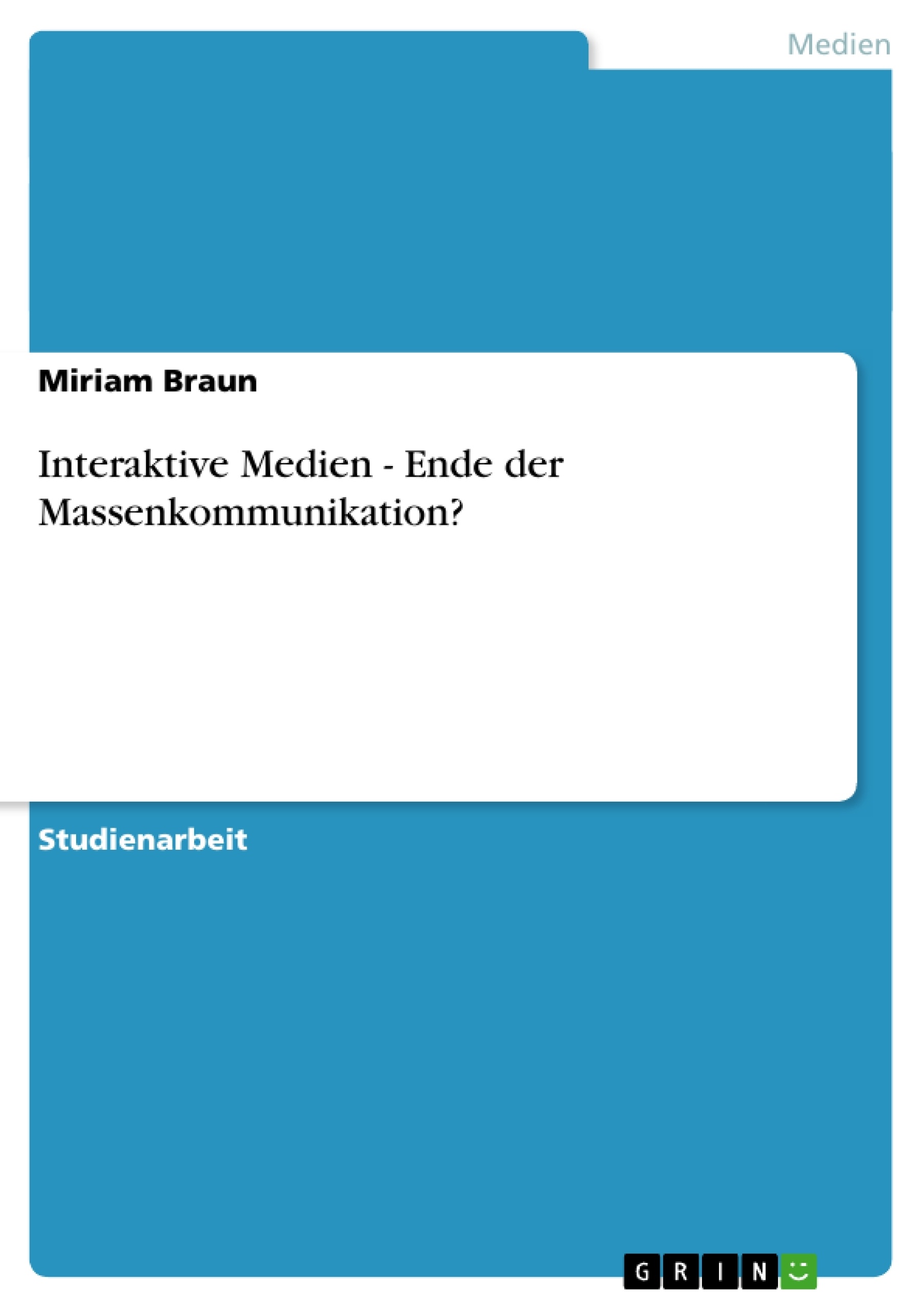„I want to focus on another dinosaur, one that may be on the road to extinction. I am referring to the American media. And I use the term extinction literally. To my mind, it is likely that what we now understand as the mass media will be gone within ten years. Vanished, without a trace”. So beginnt Michael Crichton (1993) Anfang der Neunziger Jahre einen vernichtenden Artikel über das Ende der Massenmedien. Die damals junge Kultzeitschrift „Wired“ – in der Crichtons Artikel erschien – befasste sich mit dem neuen Trend hin zu interaktiven Medien weg von herkömmlichen Medien.
Die enorme „Faszination der Menschen an ein interaktives System angeschlossen zu sein, denn ‚being wired’ [war] die große Attraktion“ (Rötzer, 1996: 120), wuchs enorm und brachte im selben Atemzug eine Abwehrhaltung gegenüber den herkömmlichen Massenmedien mit sich. Einige Medienkritiker vertreten auch heute noch diese These und prophezeien weiterhin das Ende der Massenkommunikation.
„Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich durch technische Verbreitungsmittel indirekt und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt werden“ (Maletzke, 1963: 32 ff.). Und genau diese Einseitigkeit der alten Medien – welche bereits die klassischen Medienkritiker anprangerten – scheint durch die technologischen ‚neuen Medien’ auflösbar zu werden.
Die Euphorie, die den neuen Medien auch heute noch entgegen gebracht wird, geht – wie das Eingangszitat verdeutlicht – sogar soweit, dass die zukünftige Existenz der Massenmedien vollständig in Frage gestellt wird. Sind die neuen Medien die besseren Medien? Lösen die neuen Medien die Massenmedien ab oder wird es zu einer Verquickung beider, zu einer Auflösung der Grenzen kommen? Damit beschäftigt sich diese Arbeit, die sich hauptsächlich an dem Text von Josef Wehner aus dem Jahre 1996 orientiert, und anhand seiner Gedanken Positionen und Gegenpositionen der Medienwissenschaften aufgreift.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Thema der Lehrveranstaltung
- 2.1 Publikums- und Rezeptionsforschung bei Neumann-Braun
- 3 Interaktive Medien – Ende der Massenkommunikation?
- 3.1 Begriffsabgrenzung Interaktion und Interaktivität
- 3.2 Der Text von Josef Wehner
- 3.3 Massenmedien: Ist die klassische Kritik haltbar?
- 3.3.1 Interaktivität und Massenmedien
- 3.3.2 Massenmedien und Vereinzelung der Rezipienten
- 3.3.3 Massenmedien und Autonomieverlust der Rezipienten
- 3.3.4 ‚Neue Medien' – Ergänzung oder Substitut?
- 3.3.5 Grenzen der interaktiven, neuen Medien'
- 3.3.6 Wehners' Fazit
- 3.4 Weitere Ansichten:, neue Medien vs. Massenmedien'
- 4 Fazit, Ertrag und Ausblick
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These vom Ende der Massenkommunikation im Angesicht interaktiver Medien. Sie analysiert, inwieweit neue Medien traditionelle Massenmedien ersetzen oder ergänzen und beleuchtet dabei die Veränderungen in der Medienrezeption und -interaktion. Die Arbeit basiert primär auf dem Text von Josef Wehner (1996).
- Der Vergleich zwischen Massenmedien und interaktiven Medien
- Die Rolle der Interaktivität in der Medienlandschaft
- Die Auswirkungen interaktiver Medien auf die Rezipienten
- Die Kritik an traditionellen Massenmedien
- Die Grenzen und Potenziale interaktiver Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These vom Ende der Massenmedien vor, basierend auf einem Artikel von Michael Crichton (1993). Sie führt in die Thematik ein und kontrastiert die Einseitigkeit der Massenkommunikation mit dem interaktiven Potential neuer Medien, wobei der Vergleich mit öffentlichen und individuellen Verkehrsmitteln zur Veranschaulichung dient. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse des Textes von Josef Wehner (1996), um die verschiedenen Positionen der Medienwissenschaft zu diesem Thema zu beleuchten.
2 Thema der Lehrveranstaltung: Dieses Kapitel beschreibt den Fokus des Seminars von Prof. Dr. Klaus Neumann-Braun zur Publikums- und Rezeptionsforschung. Es werden die Herausforderungen der Messung von Mediennutzung und -wirkung thematisiert sowie wichtige soziologische Begriffe wie Kommunikation und Interaktion im Kontext der Medienrezeption geklärt. Der einseitige Charakter der Massenkommunikation im Gegensatz zu interaktiven Kommunikationsformen wird herausgestellt.
3 Interaktive Medien – Ende der Massenkommunikation?: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert ausführlich den Text von Josef Wehner (1996). Es beleuchtet die verschiedenen Facetten der Interaktivität und ihre Implikationen für Massenmedien. Wehner’s Argumentation wird detailliert dargestellt, einschließlich seiner Kritik an traditionellen Massenmedien und seiner Einschätzung der „neuen Medien“. Die Arbeit untersucht, ob interaktive Medien Massenmedien ersetzen oder ergänzen und diskutiert die Grenzen und das Potential der neuen Medien. Zusätzliche Perspektiven und Gegenpositionen aus der Medienwissenschaft werden ebenfalls einbezogen.
Schlüsselwörter
Massenkommunikation, Interaktive Medien, Medienrezeption, Interaktivität, Medienkritik, Josef Wehner, Neue Medien, Massenmedien, Medienwirkung, Rezipienten
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Interaktive Medien – Ende der Massenkommunikation?
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die These, dass interaktive Medien das Ende der Massenkommunikation bedeuten. Sie analysiert, ob neue Medien traditionelle Massenmedien ersetzen oder ergänzen und beleuchtet die Veränderungen in der Medienrezeption und -interaktion, basierend hauptsächlich auf dem Text von Josef Wehner (1996).
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich zwischen Massenmedien und interaktiven Medien, die Rolle der Interaktivität in der Medienlandschaft, die Auswirkungen interaktiver Medien auf Rezipienten, die Kritik an traditionellen Massenmedien sowie die Grenzen und Potenziale interaktiver Medien. Sie bezieht sich auf die Publikums- und Rezeptionsforschung nach Neumann-Braun und diskutiert verschiedene Positionen aus der Medienwissenschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist der Text von Josef Wehner (1996). Zusätzlich wird der Artikel von Michael Crichton (1993) in der Einleitung erwähnt, um die These vom Ende der Massenmedien einzuführen. Die Arbeit bezieht sich auch auf die Lehren von Prof. Dr. Klaus Neumann-Braun zur Publikums- und Rezeptionsforschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Thema der Lehrveranstaltung (mit Fokus auf Neumann-Brauns Rezeptionsforschung), ein zentrales Kapitel zur Analyse des Textes von Wehner (inkl. Unterkapitel zu Interaktivität, Massenmedienkritik und den Grenzen neuer Medien), ein Fazit, einen Ausblick und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Was ist die Kernfrage der Arbeit?
Die Kernfrage ist, ob und inwieweit interaktive Medien traditionelle Massenmedien ersetzen oder ergänzen und welche Auswirkungen dies auf die Medienrezeption und die Rolle der Rezipienten hat.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text der Zusammenfassung der Kapitel und im Fazit enthalten, diese sind aber in der gegebenen Vorschau nicht vollständig wiedergegeben.) Die Arbeit analysiert Wehners Argumentation und diskutiert zusätzliche Perspektiven, um die komplexe Beziehung zwischen Massenmedien und interaktiven Medien zu beleuchten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Massenkommunikation, interaktive Medien, Medienrezeption, Interaktivität, Medienkritik, Josef Wehner, neue Medien, Massenmedien, Medienwirkung und Rezipienten.
- Citation du texte
- Miriam Braun (Auteur), 2006, Interaktive Medien - Ende der Massenkommunikation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73642