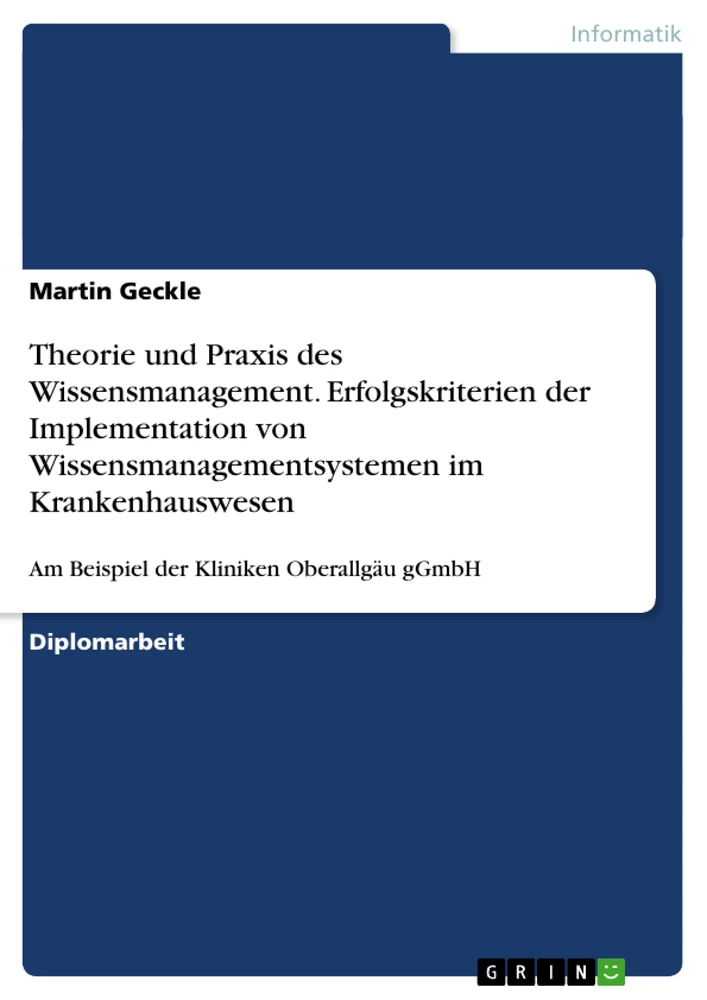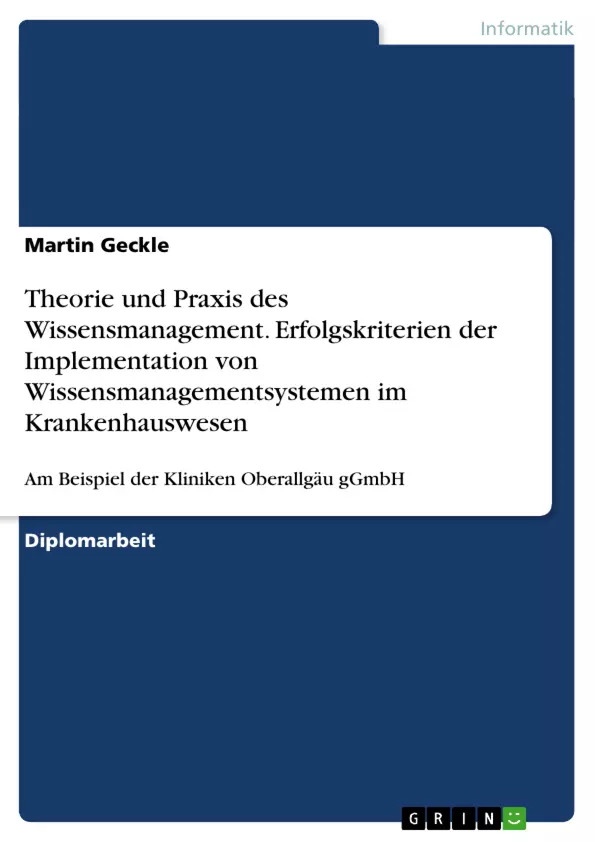Gegenstand der hier vorgestellten Diplomarbeit ist die Auseinandersetzung mit Wissen und Wissensmanagement in Theorie und Praxis. Es werden die Auswirkungen von Wissen und Wissensmanagement auf die Gesellschaft und die Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden verschiedenen Ansichten, Definitionen, Modelle sowie Lösungsansätze beschrieben. Vertieft werden die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wissensmanagement auf der Seite der Organisation und deren Mitarbeitern dargestellt. Zudem werden die Unternehmenskultur und kulturelle Voraussetzungen für Wissensmanagement-Aktivitäten näher untersucht. Im praxisbezogenen Teil dieser Arbeit werden die Erfolgsausichten und Erfolgskriterien für die Implementation und den Einsatz eines Wissensmanagement-Systems bei einem Krankenhausträger (Kliniken Oberallgäu gGmbH) herausgearbeitet. Dies u.a. durch die Beschreibung der aktuellen Situation im Krankenhaussektor mit einer Analyse der vorhandenen und zukünftigen Problemfelder. Durch die Auswertung und Interpretation einer durchgeführten aktuellen Zufallsbefragung sowie persönlichen Interviews mit ausgewählten Verantwortlichen des in den Kliniken umgesetzten Forschungsprojekts „Know-IT“ erfolgt ein ergänzendes Meinungsbild zur Ermittlung und Beurteilung der Erfolgskriterien. Abschließend wird ein beispielhafter Modellansatz für ein nachhaltiges Wissensmanagement vorgestellt sowie eine Bewertung der Wissensmanagement-Aktivitäten.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Wissensmanagement
- Die Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen
- Was ist Wissen und welche Eigenschaften besitzt es?
- Die Abgrenzung von Zeichen, Daten, Informationen und Wissen.
- Gründe für das Wissensmanagement
- Definition von Wissensmanagement und Darstellung der verschiedenen Wissensmanagementansätze.
- Die Bausteine des Wissensmanagements
- Das Münchner Modell des Wissensmanagement
- Das Modell des integrativen Wissensmanagement
- Das Lebenszyklusmodell des Wissensmanagement
- Das TOM Modell
- Das Modell der Wissensnetzwerke nach v. Krogh, Seufert und Back.
- Die vier Akte zum Aufbau eines Wissensmanagements nach Schüppel.
- Das APQC-Rahmenkonzept
- Das Wissensmarktkonzept
- Die Spirale des Wissens.
- Die organisationale Wissensbasis oder wie ein Unternehmen sein Wissen nutzbar machen kann.
- Wissensmanagement als organisatorische Herausforderung für Unternehmen und damit verbundene Aufgabenstellungen.
- Management: Eingrenzung eines weiten Begriffs.
- Aufgaben, Funktionen, Rollen und Verantwortungsbereiche für ein erfolgreiches Wissensmanagement auf der Ebene des Top-Managements
- Aufgaben, Funktionen, Rollen und Verantwortungsbereiche für ein erfolgreiches Wissensmanagement auf der Ebene des mittleren Managements.
- Aufgaben, Funktionen, Rollen und Verantwortungsbereich für ein erfolgreiches Wissensmanagement auf der Mitarbeiter-Ebene.
- Die besondere Bedeutung der Unternehmenskultur, der damit zusammenhängenden Motivationsinstrumente und Anreizsysteme.
- Communities of Practice: Begrifflichkeit, Entwicklung und Gestaltung.
- Untersuchung zu den Erfolgskriterien der Implementation von Wissensmanagementsystemen im Krankenhauswesen, dies am Beispiel der Kliniken Oberallgäu gGmbH.
- Zur allgemeinen Entwicklung und erkennbare Tendenzen im Krankenhaussektor.
- Darstellung der beteiligten Institutionen und Unternehmen am Forschungsprojekt „know-IT“
- Die private Universität Witten/Herdecke gGmbH.
- Die GWI AG
- Die Kliniken Oberallgäu gGmbH.
- Die Ziele des Forschungsprojektes „,know-IT“
- Zum Verlauf des Forschungsprojektes „,know-IT“
- Beschreibung der eingesetzten Wissensmanagement-Software
- Darstellung der gemeinsam erarbeiteten Zufallsumfrage zum Thema Wissensmanagement in Krankenhaussektor.
- Evaluation und Interpretation der Ergebnisse der Zufallsumfrage
- Entwicklung der Leitfragen für die Interviews.
- Zusammenfassende Darstellung und Interpretation der Interview-Ergebnisse.
- Erfolgskriterien für eine erfolgreiche Implementation und den Einsatz von Wissensmanagement-Systemen im Krankenhaus
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang A: Die Ergebnisse der Ergebnisse der Online-Umfrage (Stand vom 01.03.2007)
- Anhang B: Aufbau des Leifragebogens für die Interviews
- Die Bedeutung von Wissen und Wissensmanagement für die Gesellschaft und Unternehmen.
- Verschiedene Ansätze, Modelle und Definitionen von Wissensmanagement.
- Die Bedeutung der Unternehmenskultur und der Mitarbeitermotivation für ein erfolgreiches Wissensmanagement.
- Erfolgskriterien für die Implementierung und den Einsatz von Wissensmanagementsystemen im Krankenhauswesen.
- Bewertung von Wissensmanagement-Aktivitäten am Beispiel der Kliniken Oberallgäu gGmbH.
- Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Wissen und Wissensmanagement in der heutigen Zeit und betrachtet die Auswirkungen auf Gesellschaft und Unternehmen.
- Im zweiten Kapitel werden unterschiedliche Definitionen und Modelle des Wissensmanagements vorgestellt. Die Bedeutung der Unternehmenskultur und der Mitarbeitermotivation für ein erfolgreiches Wissensmanagement wird ebenfalls diskutiert.
- Kapitel drei befasst sich mit der Implementierung von Wissensmanagementsystemen im Krankenhauswesen am Beispiel der Kliniken Oberallgäu gGmbH. Die Arbeit analysiert Erfolgskriterien und Problemfelder, die im Zusammenhang mit der Einführung von Wissensmanagement-Systemen im Krankenhausbereich auftreten können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Wissen und Wissensmanagement in Theorie und Praxis. Sie analysiert die Auswirkungen von Wissen und Wissensmanagement auf die Gesellschaft und Unternehmen. Dabei werden verschiedene Ansichten, Definitionen, Modelle und Lösungsansätze sowie die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wissensmanagement innerhalb einer Organisation und bei deren Mitarbeitern beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Bereiche Wissensmanagement, Unternehmenskultur, Krankenhaus, Kliniken Oberallgäu gGmbH und das Forschungsprojekt „know-IT“. Sie untersucht die Auswirkungen von Wissen und Wissensmanagement auf Unternehmen und die Gesellschaft, sowie die Erfolgskriterien für die Implementierung von Wissensmanagementsystemen im Krankenhauswesen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Erfolgskriterien für Wissensmanagement im Krankenhaus?
Wichtige Kriterien sind eine unterstützende Unternehmenskultur, die Einbindung aller Managementebenen und die Motivation der Mitarbeiter durch Anreizsysteme.
Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur?
Sie ist die Basis für Wissensmanagement-Aktivitäten; ohne eine Kultur des Teilens und Vertrauens scheitern technische Systeme oft an der mangelnden Nutzung.
Was ist das Forschungsprojekt „Know-IT“?
Ein Projekt der Kliniken Oberallgäu gGmbH und der Universität Witten/Herdecke zur Implementierung von Wissensmanagement-Software im Klinikalltag.
Was ist der Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen?
Die Arbeit grenzt diese Begriffe ab: Daten sind strukturierte Zeichen, Informationen sind interpretierte Daten, und Wissen ist die Anwendung von Informationen in einem Kontext.
Was sind "Communities of Practice"?
Es handelt sich um selbstorganisierte Gruppen von Fachleuten, die ihr Wissen informell austauschen und gemeinsam Probleme lösen.
- Quote paper
- Martin Geckle (Author), 2007, Theorie und Praxis des Wissensmanagement. Erfolgskriterien der Implementation von Wissensmanagementsystemen im Krankenhauswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73694