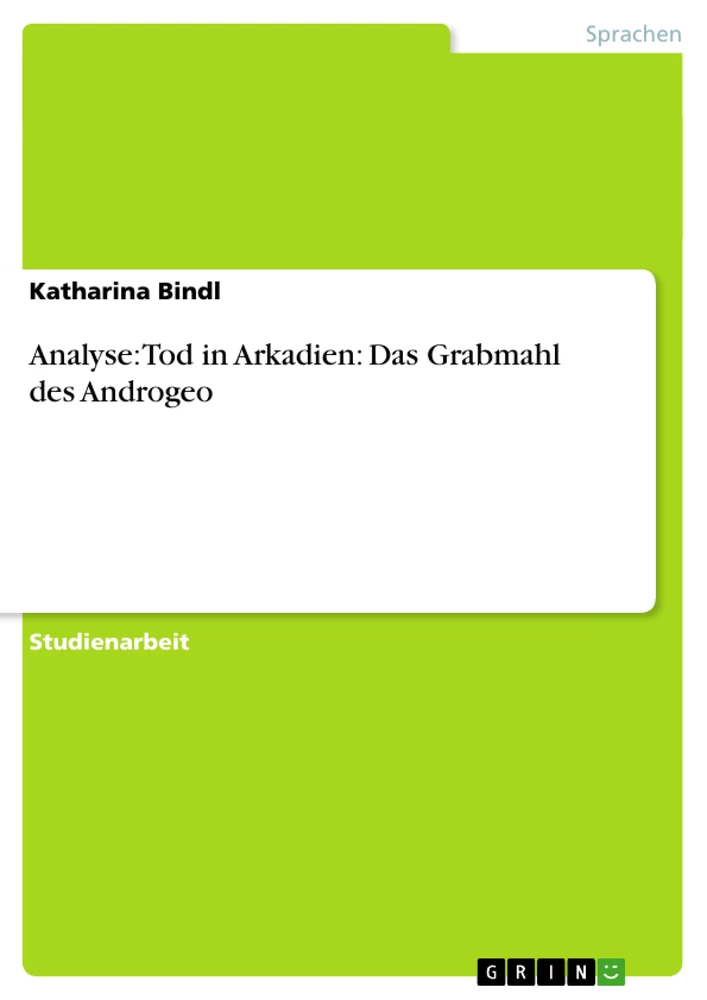Iacopo Sannazaro (1457-1530) gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Neapolitanischen Kultur im 15. und 16. Jahrhundert und schuf mit seinem Werk „Arcadia“, das im volgare geschrieben war, ein Modell für die Pastoraldichtung. Das literarische Arkadien ist aber nicht gleichzusetzen mit einer realen, geographischen Landschaft, sondern ist vielmehr ein Ort der freien Liebe und der Dichterkunst, in dem alle Menschen Hirten sind und im Einklang mit der Natur leben. Auch die Thematik der unglücklichen Liebe wird immer wieder in den Eklogen aufgegriffen. Dieses fiktive Arkadien geht zurück auf den lateinischen Schriftsteller Vergil, der seine Eklogen in eben diese Landschaft versetzte. Zudem galt Arkadien als Heimat des Hirtengottes Pan, der eine Hirtenflöte, die sog. Syrinx, aus einem Schilfrohr schnitt. Sannazaro verlegt seinen Schauplatz Arkadien in die Landschaft bei Neapel, seinem Geburtsort, und konstruiert eine Intertextualität zu Vergils Arkadien, indem er nicht nur die Idylle Arkadien aufgreift, sondern sich in seinem Prosimetrum immer wieder auf Vergils „Bucolica“ bezieht. So konstruiert Sannazaro beispielsweise eine Genealogie zu dem Hirtengott Pan, indem er Theokrit und Vergil erwähnt und somit die griechische und römische Antike verbindet. In Sannazaro’s X Ekloge nimmt Sincero (könnte mit Sannazaro gleichgesetzt werden) die gefundene Panflöte an sich, wodurch er sich neben Vergil und Theokrit zu den von Pan erwählten Dichtern zählt. Weiter funktioniert diese Genealogie in der V Ekloge, indem Sannazaro „vaccari“ (Kuhhirten) erwähnt, die im altgriechischen „bucolos“ genannt werden und dies wiederum eine Intertextualität zu Vergils „Bucolica“ ist (Metapoetische Benennung).
Im Folgenden werde ich auf die V Ekloge von Sannazaro’s „Arcadia“ eingehen. Das Idyll Arkadien stelle ich dem getrübten Bild dieses Ortes gegenüber und zeige anschließend den Bezug zwischen dem Grabmahl Androgeos und Massilias aus der X Ekloge auf. Zuletzt verdeutliche ich den Bruch des Arkadienbildes in diesem Kapitel, welches dadurch eingetrübt wird und die erwartete Standartrelation zu Neapel nicht erfüllt.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- A) Sannazaro's Arcadia und Genealogie
- B) Prosa/ Ekloge V
- 1. Ungebrochenes Idealbild von Arkadien
- 1.1. Sonnenuntergang bis Endes des Tages (Vers 1-8)
- 1.2. Morgendämmerung und Hirten kommen zu Androgeo's Grabmahl (9-19)
- 2. Getrübtes Bild Arkadiens
- 2.1. Erwähnung des Grabes von Androgeo bis Ende der Prosa (Vers 20 - 36)
- 2.2. Klagelied Ergastos (Vers 1-68)
- C) Bezug zu dem Grabmahl von Massilia (Ekloge X)
- D) Bruch des Arkadienbildes und Vergleich zu Neapel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die V. Ekloge aus Jacopo Sannazaros Werk "Arcadia" und untersucht die Brechung des Arkadienbildes in diesem Kapitel. Dabei werden sowohl das Idealbild Arkadiens als auch die Elemente, die dieses Bild trüben, analysiert. Der Text befasst sich mit der Intertextualität zu Vergils "Bucolica" und der Bedeutung des Grabmahls von Androgeo im Kontext der Pastoraldichtung.
- Die Bedeutung von Arkadien in der Pastoraldichtung
- Die Brechung des Arkadienbildes in der V. Ekloge
- Die Intertextualität zu Vergils "Bucolica"
- Die Rolle des Grabmahls von Androgeo
- Der Vergleich zwischen Arkadien und Neapel
Zusammenfassung der Kapitel
Die V. Ekloge beginnt mit einer Beschreibung des Idealbildes Arkadiens, das durch die Hirten, ihre Spiele und die idyllische Natur geprägt ist. Der Fokus liegt auf den Hirten, die in Harmonie mit der Natur leben und sich dem Musizieren und Dichten hingeben. In der Folge wird das Bild von Arkadien getrübt, als die Hirten auf das Grabmahl von Androgeo stoßen. Dieses Grabmahl steht für Tod und Verlust und stellt das Idyll in Frage. Die Klage des Hirten Ergastos, die auf das Grabmahl folgt, verstärkt diese Tristesse. Die Ekloge endet mit einer Reflexion über den Bruch des Arkadienbildes und stellt das Idealbild in Frage, indem sie auf die realen Gegebenheiten der Zeit verweist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Pastoraldichtung, Arkadien, Intertextualität, Brechung des Idealbildes, Grabmahl, Androgeo, Massilia, Neapel, Sannazaro, Vergil, "Bucolica".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „literarische Arkadien“ bei Sannazaro?
Es ist ein fiktiver Ort der freien Liebe und Dichterkunst, an dem Menschen als Hirten im Einklang mit der Natur leben.
Wie wird das Idyll in der V. Ekloge gebrochen?
Das Bild wird durch das Auffinden des Grabmahls von Androgeo getrübt, welches Tod und Verlust in die pastorale Welt bringt.
Welchen Bezug gibt es zwischen Sannazaro und Vergil?
Sannazaro konstruiert eine Intertextualität zu Vergils „Bucolica“, indem er Motive und die Genealogie des Hirtengottes Pan aufgreift.
Wer ist Androgeo in der Arcadia?
Androgeo ist eine Figur, deren Grabmahl im Zentrum der V. Ekloge steht und Anlass für ein Klagelied (Ergastos) gibt.
Welche Rolle spielt Neapel in Sannazaros Werk?
Sannazaro verlegt den Schauplatz seines Arkadiens in die Landschaft bei Neapel, seinem Geburtsort.
- Quote paper
- Katharina Bindl (Author), 2007, Analyse: Tod in Arkadien: Das Grabmahl des Androgeo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73865