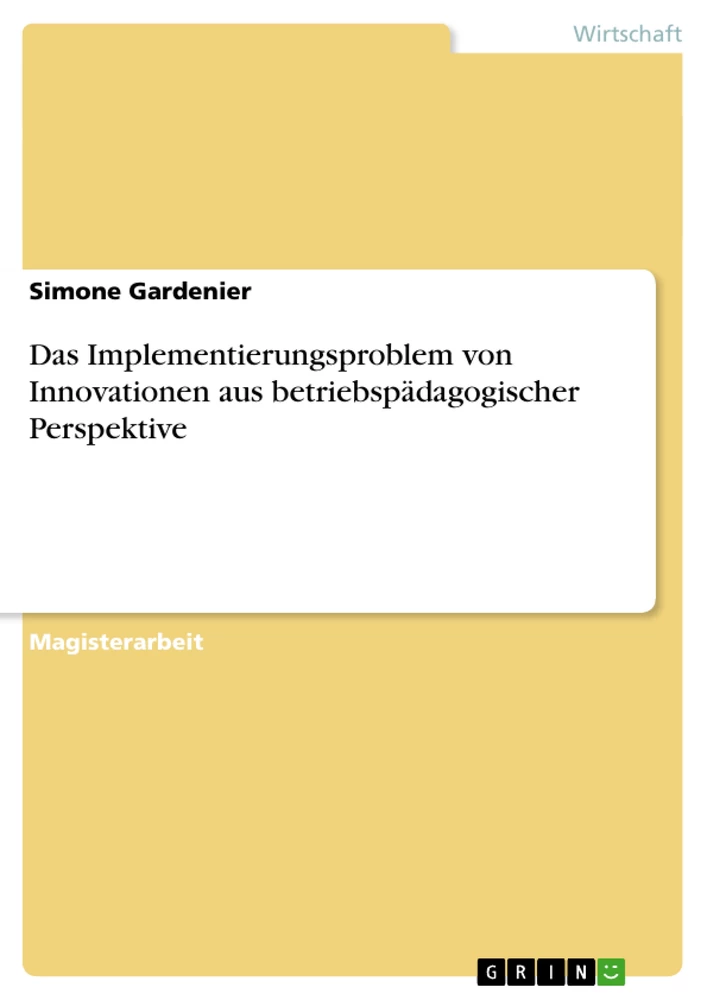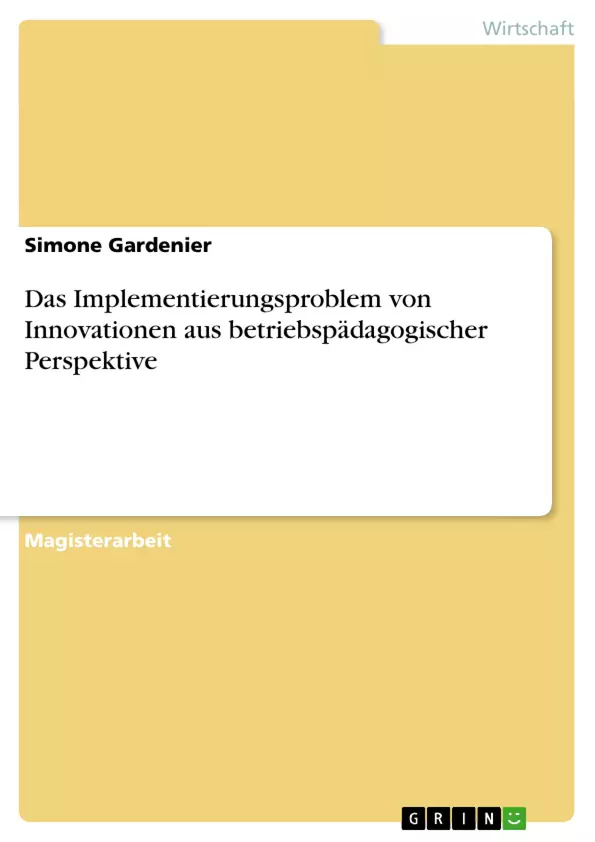Unternehmen, die flexibel auf die Herausforderungen eines sich dynamisch wandelnden Umfeldes reagieren wollen, sehen sich beständig dem Druck ausgesetzt, innovative Veränderungen in Produkten und Prozessen vorzunehmen.
Nicht selten stoßen Unternehmen dabei an ihre Grenzen, die durch den hemmenden Einfluss von Interessengruppen, aber auch durch einzelne Individuen gesetzt werden. Innovation und Widerstand erweisen sich als nahezu untrennbar miteinander verknüpft, denn Innovationen bedeuten Veränderungen und Wandel sowie die Anpassung an neue Rahmenbedingungen personalen und organisationalen Handelns (vgl. Hauschildt 2004, S. 27, 160). Eine Innovationsimplementierung, die oftmals tief greifende Veränderungsprozesse impliziert, verläuft nur selten ohne Schwierigkeiten. Vielfach müssen Widerstände erst überwunden werden, um eine erfolgreiche Implementierung der Innovation durchzusetzen. Motive, beruhend auf Beharrlichkeit und Starrsinn, subjektiven Bedürfnissen, Fähigkeits- und Willensbarrieren, Proteste, die zugunsten der Gruppenkonformität ausgeführt werden, sind einige gegen die eine Innovationsimplementierung antreten muss (vgl. Frey/Greif 2001; Frey/Irle 2002; Klöter 1997; Strebel 2003). Diesen Widerständen muss entgegengewirkt werden, zum Beispiel durch Motivations- oder Überzeugungsarbeit, wenn das Unternehmen nicht den Anschluss an das sich in vielen Bereichen immer schneller ändernde Umfeld verlieren will.
Das daraus entstehende Problemfeld soll zugleich auch die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sein: Weshalb, wodurch entstehen Widerstände gegen eine Implementierung einer Innovation und durch welche theoretischen Grundlagen lassen sie sich begründen? Der Fokus der vorliegenden Arbeit richtet sich daher nicht aufgrundlegende, bahnbrechende Technik- oder Weltneuheiten, sondern eher auf die Innovationen, die vom Unternehmen Bereitschaft und Fähigkeit im Implementierungsprozess abverlangt.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die verdeckten Probleme der Implementierung, welche erst bei einer eingehenden Betrachtung an die Oberfläche gelangen und benutzt betriebspädagogische Sichtweisen, um dieses oftmals betriebswirtschaftlich beeinflusste Themenfeld genauer zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- PROBLEMSTELLUNG.
- DARSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DER VORGEHENSWEISE
- IMPLEMENTIERUNGSPROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT INNOVATIONSMANAGEMENT..
- DIMENSIONEN DES INNOVATIONSBEGRIFFES
- TYPOLOGIE DES INNOVATIONSBEGRIFFES.
- EINGRENZUNG DES INNOVATIONSBEGRIFFES UND ENTSTEHENDE IMPLEMENTIERUNGSSCHWIERIGKEITEN.
- AUFGABEN, SCHWIERIGKEITEN UND AKTEURE BEI DER INNOVATIONSIMPLEMENTIERUNG.
- PROBLEMDARSTELLUNG AUS KOGNITIVER PERSPEKTIVE.
- RELEVANZ VON KOGNITIONEN UND MANGELNDES PROBLEMBEWUSSTSEIN.
- ANFORDERUNGEN AN DIE KOGNITIVE LEISTUNG DER MITARBEITER
- WISSENSTRANSFER.
- Struktur des Wissenstransfers.
- Barrieren für den Austausch von individuellem Wissen...
- Barrieren für den Austausch von kollektivem Wissen.
- WIDERSTAND ALS ERGEBNIS EINES PROZESSES DER PROGNOSE UND BEWERTUNG VON INNOVATIONSFOLGEN.
- PROBLEMDARSTELLUNG AUS SOZIALPSYCHOLOGISCHER PERSPEKTIVE.
- ERKLÄRUNGSANSÄTZE AUS DER SOZIALPSYCHOLOGIE
- INDIVIDUALTHEORIEN...
- Hypothesentheorie..
- Theorie der kognitiven Dissonanz..
- Theorie der kognizierten Kontrolle.
- Theorie des Selbstwertschutzes.
- WIDERSTANDSGENESE IM GRUPPENVERHALTEN
- Darstellung verschiedener Quellen des Widerstandes.
- PROBLEMDARSTELLUNG AUS MOTIVATIONALER PERSPEKTIVE
- WIRKUNGEN VON MOTIVATION AUF DEN WIDERSTAND.
- INTRINSISCHE UND EXTRINSISCHE WILLENSBARRIEREN
- DIE ZWEIFAKTORENTHEORIE NACH HERZBERG.
- VERLUST PERSONALER KERNKOMPETENZEN.
- VERLUST DES ARBEITSPLATZES.....
- MACHT UND EINFLUSSPOTENZIAL BEI DER ENTSTEHUNG VON WIDERSTÄNDEN
- ERSCHEINUNGSFORMEN PERSONALER WIDERSTÄNDE.
- OFFENER UND VERDECKTER WIDERSTAND ALS MÖGLICHKEIT DER EINFLUSSNAHME AUF DIE IMPLEMENTIERUNG..
- AKTIVER UND PASSIVER WIDERSTAND
- DIREKTER UND INDIREKTER WIDERSTAND
- DESTRUKTIVER UND KONSTRuktiver WideRSTAND
- LOYALER UND EGOZENTRISCHER WIDERSTAND
- BETRIEBSPÄDAGOGISCHE KONSEQUENZEN IM KONTEXT DES IMPLEMENTIERUNGSPROBLEMS
- AUSGEWÄHLTE HANDLUNGSFELDER DER BETRIEBSPÄDAGOGIK..
- DIE BETRIEBSPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DES CHANGE MANAGEMENTS.
- ÜBERWINDUNG VON WIDERSTÄNDEN DURCH INSTRUMENTE DES CHANGE MANAGEMENTS.
- Analytischer Umgang mit Widerstand
- Anpassung der Lösungskonzeption an die Bedürfnisse von Individuen.
- Identifizierung der Machtinhaber
- Umgang mit Emotionen...\li>
- Umgang mit versteckten psychologischen Problemfeldern.….….….........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit dem Implementierungsproblem von Innovationen aus betriebspädagogischer Perspektive. Ziel ist es, die Herausforderungen und Barrieren bei der Einführung von Innovationen in Unternehmen aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren und betriebspädagogische Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Kognitive Aspekte des Widerstandes gegen Innovationen
- Soziale und psychologische Faktoren, die den Widerstand beeinflussen
- Motivationale Aspekte und deren Einfluss auf die Implementierung
- Mögliche Erscheinungsformen des Widerstands
- Betriebspädagogische Ansätze zur Überwindung von Widerstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung des Implementierungsproblems von Innovationen aus betriebspädagogischer Perspektive dargelegt wird. Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Innovation" und den unterschiedlichen Dimensionen und Typologien von Innovationen. Es wird darauf eingegangen, welche Schwierigkeiten bei der Implementierung von Innovationen entstehen können. Das zweite Kapitel untersucht das Implementierungsproblem aus kognitiver Perspektive. Es werden die Relevanz von Kognitionen und das mangelnde Problembewusstsein im Zusammenhang mit Innovationen betrachtet. Weiterhin werden die Anforderungen an die kognitive Leistung der Mitarbeiter und die Bedeutung von Wissenstransfer bei der Implementierung von Innovationen analysiert.
Das dritte Kapitel beleuchtet das Thema aus sozialpsychologischer Sicht. Verschiedene Erklärungsansätze aus der Sozialpsychologie werden vorgestellt, die den Widerstand gegen Innovationen erklären können. Dabei wird sowohl auf Individualtheorien wie die Hypothesentheorie, die Theorie der kognitiven Dissonanz, die Theorie der kognitiven Kontrolle und die Theorie des Selbstwertschutzes, als auch auf Gruppenebene auf die Theorie der sozialen Identität und die Selbstbestätigungstendenz von Gruppen eingegangen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Problematik aus motivationaler Perspektive. Die Arbeit untersucht, wie Motivation den Widerstand beeinflusst und wie intrinsische und extrinsische Willensbarrieren die Implementierung von Innovationen behindern können. Des Weiteren wird die Zweifaktorentheorie nach Herzberg vorgestellt, die die Unterscheidung zwischen Hygienefaktoren und Motivatoren erklärt. Das Kapitel befasst sich auch mit den Folgen der Implementierung von Innovationen für die Mitarbeiter, wie beispielsweise dem Verlust persönlicher Kernkompetenzen und dem Verlust des Arbeitsplatzes.
Im fünften Kapitel werden die verschiedenen Erscheinungsformen des Widerstandes gegen Innovationen dargestellt. Es wird zwischen offenem und verdecktem, aktivem und passivem, direktem und indirektem, destruktivem und konstruktivem sowie loyalem und egozentrischem Widerstand unterschieden. Das sechste Kapitel beleuchtet die betriebspädagogischen Konsequenzen im Kontext des Implementierungsproblems. Es werden ausgewählte Handlungsfelder der Betriebspädagogik vorgestellt und die Bedeutung des Change Managements für die Bewältigung von Widerständen erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Innovation, Implementierung, Widerstand, Motivation, Wissenstransfer, Change Management, Betriebspädagogik, kognitive Prozesse, soziale und psychologische Faktoren. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen bei der Einführung von Innovationen in Unternehmen und den betriebspädagogischen Ansätzen, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
Häufig gestellte Fragen
Warum entstehen Widerstände gegen Innovationen in Unternehmen?
Widerstände entstehen oft durch Angst vor Veränderung, mangelndes Problembewusstsein, Willensbarrieren oder den befürchteten Verlust von Kompetenzen und Arbeitsplätzen.
Welche Rolle spielt die Betriebspädagogik bei der Innovationsimplementierung?
Sie analysiert verdeckte Probleme, fördert den Wissenstransfer und entwickelt Strategien des Change Managements, um Widerstände pädagogisch zu überwinden.
Was ist der Unterschied zwischen offenem und verdecktem Widerstand?
Offener Widerstand äußert sich direkt (z.B. Kritik), während verdeckter Widerstand subtiler ist und oft schwerer zu identifizieren, aber ebenso blockierend wirkt.
Wie beeinflusst Motivation den Implementierungsprozess?
Intrinsische und extrinsische Motivatoren entscheiden darüber, ob Mitarbeiter eine Neuerung mittragen oder aktiv/passiv blockieren.
Welche sozialpsychologischen Theorien erklären Widerstand?
Die Arbeit nennt unter anderem die Theorie der kognitiven Dissonanz, die Theorie der kognizierten Kontrolle und den Selbstwertschutz als Erklärungsmodelle.
- Arbeit zitieren
- Simone Gardenier (Autor:in), 2007, Das Implementierungsproblem von Innovationen aus betriebspädagogischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73918