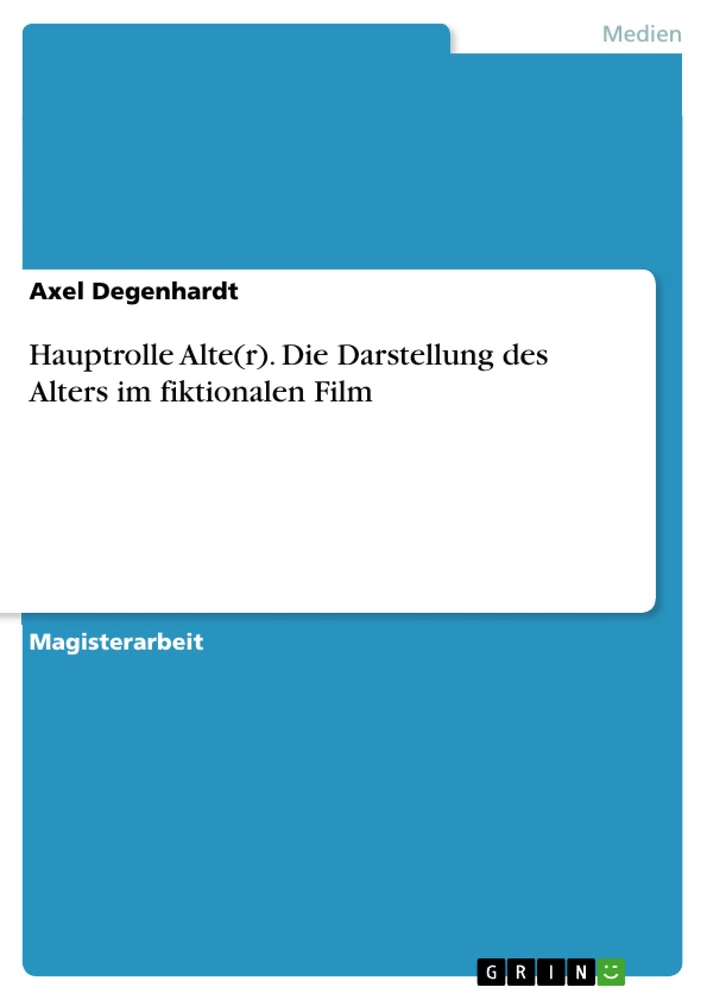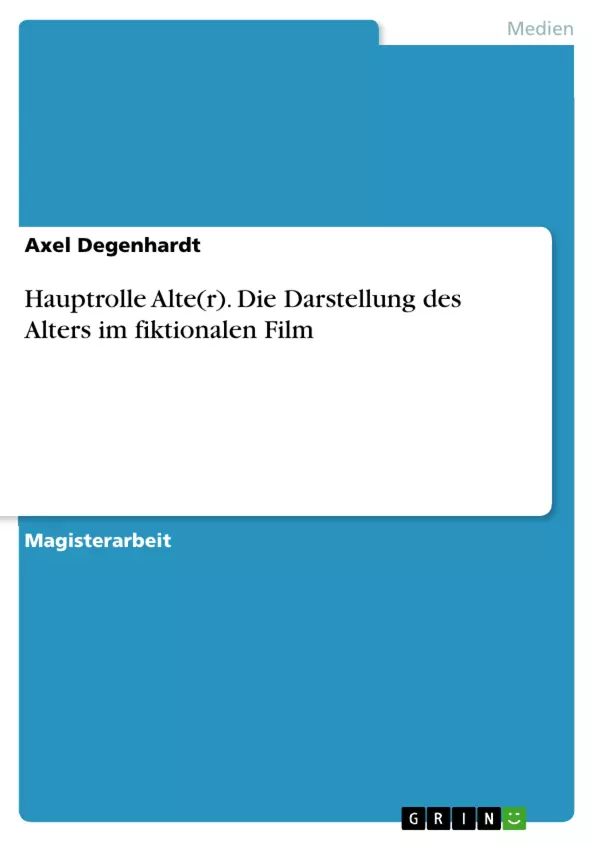Mit der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft rücken Themen, die das Alter(n) betreffen, immer stärker in den Vordergrund des öffentlichen Interesses. Die Politik nimmt sich endlich dieser Problematik an, die schon seit Jahren in den Sozialwissenschaften und der Gerontologie diskutiert und analysiert wurde. Auch die Medien reagieren auf diese Entwicklung, allen voran die Werbung: Ältere Menschen wurden schon vor Jahren als lukrative Zielgruppe für bestimmte Produkte entdeckt und dieser Sektor wird zusehends ausgebaut. Im Fernsehen tauchten bereits in den Achtzigerjahren neue Formate mit und über alte Menschen auf, so zum Beispiel die Serien "Jakob und Adele" oder "Golden Girls". Seit kürzester Zeit erobern Altersthematiken den vergleichsweise jungen Comedymarkt, so brachte Sat.1 2003 die Sketchshow "Alt & durchgeknallt" heraus. Auch das Kino scheint in den vergangenen Jahren mit Filmen über die ältere Generation den Vorsprung zu wagen, denkt man nur an "About Schmidt", "Kalender Girls" oder "Was das Herz begehrt".
Im Zuge dieser Entwicklung ist es interessant, einen näheren Blick auf die Darstellung des Alter(n)s im Erzählkino zu werfen. Doch wer denkt, die Literatur der Filmwissenschaft würde erste Antworten liefern, irrt sich: Innerhalb der Medienwissenschaft ist das Thema der Inszenierung von Alter extrem mangelhaft bearbeitet worden. Dieses Defizit ist umso bemerkenswerter, als sich anverwandte Wissenschaften wie die Psychologie und die Soziologie bereits seit Langem mit gerontologischen Themen beschäftigen. Die wenigen wegweisenden wissenschaftlichen Studien, die sich interdisziplinär mit der Darstellung der Alten bzw. des Alterns beschäftigen, beschränken sich zudem fast ausschließlich auf Fernsehen, Werbung oder Printmedien. Ihr einstimmiges Urteil: Missrepräsentation und Stereotypisierung der Älteren, Vermittlung eines negativen Altersbildes und zudem eine Unterrepräsentation weiblicher Figuren. Aber lassen sich diese Erkenntnisse eins zu eins auf das Medium Film übertragen?
Die Untersuchung "Hauptrolle: Alte(r) – Die Darstellung des Alters im fiktionalen Film" hat sich die Beantwortung dieser Frage zum Ziel gemacht. Sie basiert auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 24 Langspielfilmen aus den Jahren 1967 bis 2003, die einen hinreichenden Bezug zum Thema Alter haben und für den Kinoverleih produziert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Thematische Einführung
- 2 Hauptrolle: Alte(r). Die Darstellung des Alters im fiktionalen Film
- 2.1 Forschungsmethodik und Analysematerial
- 2.1.1 Die interdisziplinäre Kontexterschließung
- 2.1.2 Filmauswahl zum Thema Alter
- 2.2 Filmische Inszenierungen des Alter(n)s
- 2.2.1 Erzählerfiguren, Erinnerungen und Erfahrungen: life review
- 2.2.2 Inszenierung des Sterbensbewusstseins
- 2.2.3 Alte Menschen als Sex(anti)symbole
- 2.2.4 Konfliktbeziehungen und -situationen
- 2.2.5 Rebellion gegen Homogenität und Stereotypisierung
- 3 Ausgangsbasis Alte(r) und Film: Interdisziplinäre Ageing Studies
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die filmwissenschaftliche Untersuchung der Darstellung von Alter und alten Menschen im fiktionalen Spielfilm. Die Arbeit analysiert, wie ältere Protagonisten und ihr Umfeld inszeniert werden, welche Themen und Probleme des Alterns angesprochen werden und welche Konfliktlösungen präsentiert werden. Der Fokus liegt auf Filmen aus dem europäischen, nordamerikanischen und australischen Kulturraum von 1945 bis 2003.
- Die Darstellung des Alters im Film im Vergleich zu Fernseh- und Werbeinszenierungen.
- Analyse von Stereotypen und Klischees in der filmischen Darstellung alter Menschen.
- Untersuchung der filmischen Inszenierung von Themen wie Sterben, Erinnerung und Beziehungen im Alter.
- Die Rolle alter Menschen als Sexsymbole oder Anti-Sexsymbole im Film.
- Konfliktlösungen und Rebellion gegen Stereotypisierungen im Kontext der Altersdarstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Thematische Einführung: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet die zunehmende gesellschaftliche Relevanz des Themas Alter und den damit verbundenen Fokus in Medien, Politik und Sozialwissenschaften. Es verdeutlicht die Forschungslücke in der filmwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Altersdarstellungen und begründet die Notwendigkeit dieser Arbeit. Der Autor kündigt seine qualitative Inhaltsanalyse von Filmen an, die ältere Menschen oder das Altern in den Mittelpunkt ihrer Handlung stellen, und betont seinen Fokus auf fiktionale Langspielfilme aus dem europäischen, nordamerikanischen oder australischen Kulturraum.
2 Hauptrolle: Alte(r). Die Darstellung des Alters im fiktionalen Film: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Zuerst wird der Forschungsstand in Medienwissenschaft, Soziologie und Psychologie beleuchtet und die Herausforderungen bei der Auswahl geeigneter Filme erläutert. Die Auswahlkriterien werden detailliert dargestellt und begründen die letztendliche Auswahl der Filme für die qualitative Inhaltsanalyse. Der Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Analyse wird diskutiert und die Wahl der qualitativen Methode begründet.
Schlüsselwörter
Alter, Altersdarstellung, Film, Kino, Medienwissenschaft, Gerontologie, Stereotyp, Klischee, qualitative Inhaltsanalyse, filmische Inszenierung, Erinnerung, Sterben, Beziehungen, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung des Alters im fiktionalen Film
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht filmwissenschaftlich die Darstellung von Alter und alten Menschen im fiktionalen Spielfilm. Der Fokus liegt auf der Analyse der Inszenierung älterer Protagonisten und ihres Umfelds, der angesprochenen Themen und Probleme des Alterns sowie der präsentierten Konfliktlösungen. Die Untersuchung konzentriert sich auf Filme aus dem europäischen, nordamerikanischen und australischen Kulturraum von 1945 bis 2003.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Alters im Film im Vergleich zu Fernseh- und Werbeinszenierungen, untersucht Stereotype und Klischees, beleuchtet die filmische Inszenierung von Sterben, Erinnerung und Beziehungen im Alter, geht auf die Rolle alter Menschen als Sexsymbole oder Anti-Sexsymbole ein und untersucht Konfliktlösungen und Rebellion gegen Stereotypisierungen im Kontext der Altersdarstellung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse. Es wird der Forschungsstand in Medienwissenschaft, Soziologie und Psychologie beleuchtet, die Herausforderungen der Filmauswahl erläutert und die Auswahlkriterien detailliert dargestellt. Die Entscheidung für eine qualitative statt quantitative Analyse wird begründet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer thematischen Einführung, die die gesellschaftliche Relevanz des Themas Alter und die Forschungslücke in der filmwissenschaftlichen Auseinandersetzung damit darlegt. Das Hauptkapitel analysiert die Darstellung des Alters im fiktionalen Film, unterteilt in die Forschungsmethodik, die filmische Inszenierung (z.B. Erzählerfiguren, Erinnerungen, Sterben, Sex(anti)symbole, Konflikte und Rebellion gegen Stereotypen) und die Einbettung in interdisziplinäre Ageing Studies. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörtern.
Welche Kapitel gibt es?
Die Arbeit umfasst mindestens drei Kapitel: 1. Thematische Einführung, 2. Hauptrolle: Alte(r). Die Darstellung des Alters im fiktionalen Film (einschliesslich Unterkapitel zur Methodik und zur Analyse der filmischen Inszenierungen), und 3. Ausgangsbasis Alte(r) und Film: Interdisziplinäre Ageing Studies.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alter, Altersdarstellung, Film, Kino, Medienwissenschaft, Gerontologie, Stereotyp, Klischee, qualitative Inhaltsanalyse, filmische Inszenierung, Erinnerung, Sterben, Beziehungen, Konfliktlösung.
Welche Filme wurden analysiert?
Die konkreten Filme, die in der qualitativen Inhaltsanalyse verwendet wurden, sind in der Arbeit detailliert aufgeführt. Die Auswahlkriterien werden begründet und zielen auf fiktionale Langspielfilme aus dem europäischen, nordamerikanischen oder australischen Kulturraum von 1945 bis 2003 ab.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für filmwissenschaftliche Analysen, die Darstellung von Alter im Film und die interdisziplinären Aspekte von Alter(n)s-Studien interessieren. Sie ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit dem Thema Alter und dessen medialer Repräsentation auseinandersetzen.
- Quote paper
- Axel Degenhardt (Author), 2004, Hauptrolle Alte(r). Die Darstellung des Alters im fiktionalen Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74056