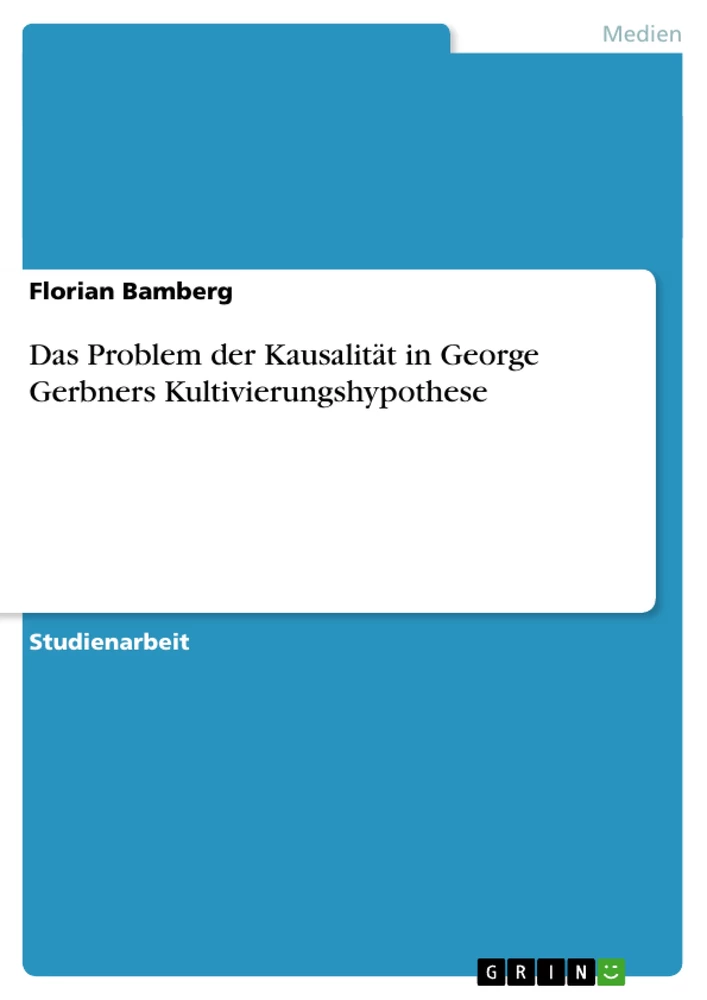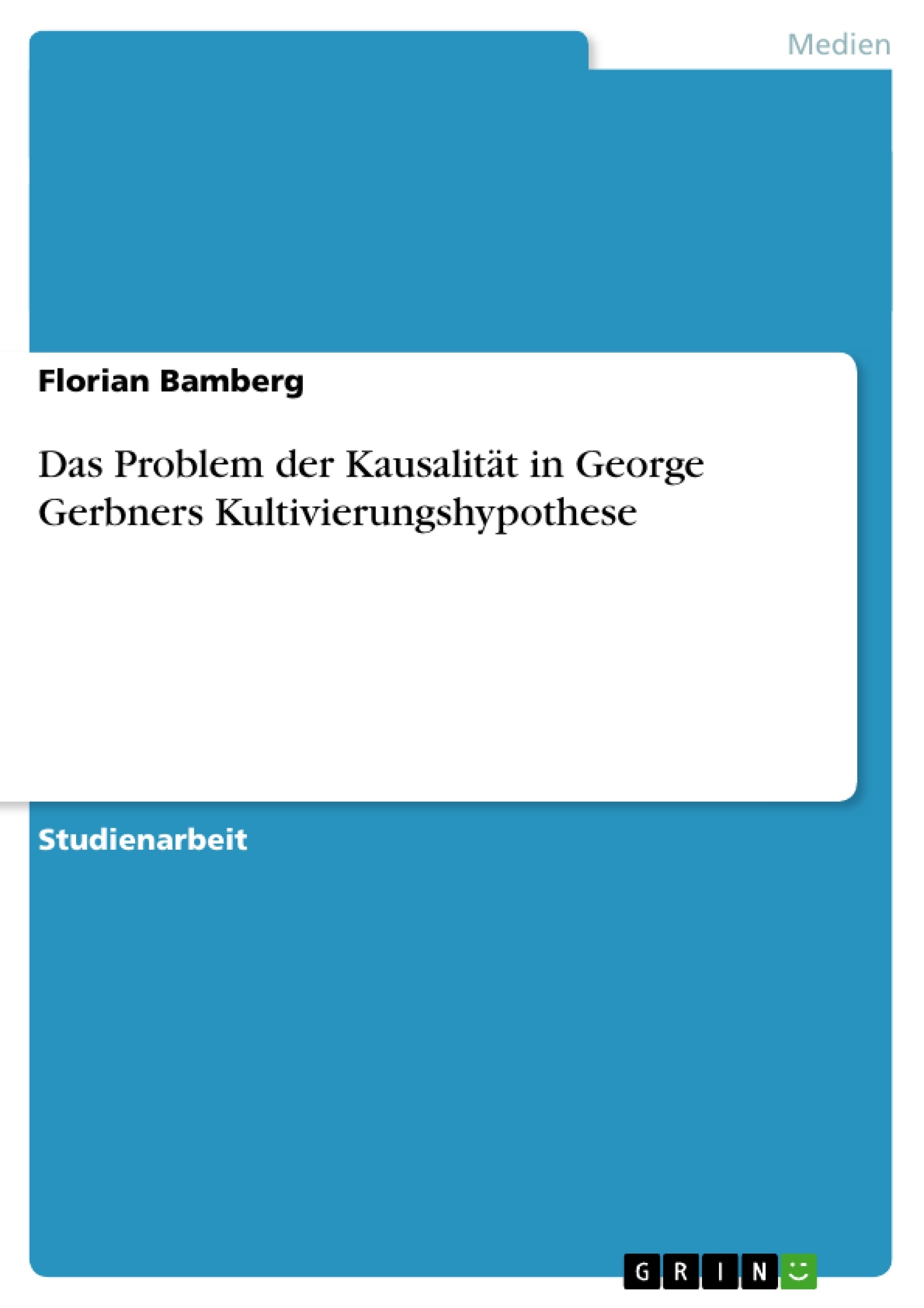Das Fernsehen wird oft und von vielen Seiten für die Verursachung oder Verstärkung sozialer Probleme verantwortlich gemacht. Oft wird bei derartigen Zuschreibungen Faktenwissen und leidlich gesicherte Erkenntnis mit Spekulation und Vermutungen vermischt. Während das z.B. im Alltag, in der politischen Rethorik und auch in den Medien wahrscheinlich unvermeidlich ist, kann die Wissenschaft helfen, detailliertere und besser abgesicherte Erkenntnisse zu verwenden. Indem sie höhere methodische Maßstäbe anlegt, als es in anderen Sphären getan wird, kann sie helfen, die anderen Sphären mit Erkenntnis zu bereichern. Um das zu erreichen, muss die wissenschaftliche Forschung methodischen Mindestanforderungen genügen. Unter anderem müssen Theorien widerlegbar sein. Wenn sie das sind und trotzdem den Widerlegungsversuchen standhalten, werden sie vorläufig akzeptiert.
In dieser Arbeit werde ich eine Hypothese daraufhin untersuchen, ob sie als widerlegt oder als vorläufig akzeptiert zu betrachten ist. Die Hypothese, um die es sich handelt, ist die Kultivierungshypothese, aufgestellt von der Annenberg-Gruppe um George Gerbner. Ich werde diese Hypothese jedoch nicht unter allen Gesichtspunkten bearbeiten, sondern nur dahingehend, ob die in ihr behauptete kausale Beziehung (vorläufig) anzunehmen ist. Die Frage, der ich nachgehe, lautet also: Ist die in der Kultivierungshypothese postulierte kausale Beziehung zwischen Fernsehkonsum und Einstellungen der Konsumenten anzunehmen oder zurückzuweisen?
Um die Frage zu beantworten, werde ich zuerst die Begriffe Kausalität und Korrelation umreißen. Dann werde ich die Kultivierungshypothese kurz vorstellen, um anschließend zu diskutieren, ob Kausalität in ihr vorausgesetzt wird. Als nächstes werde ich die Standpunkte zweier Forscher wiedergeben, die untersucht haben, ob die beschriebene kausale Beziehung in der Kultivierungshypothese widerlegt oder vorläufig nachgewiesen werden kann. Dann werde ich zu einer abschließenden Bewertung kommen, in der ich die gleiche Frage aufgrund der vorangegangenen Erkenntnis für diese Arbeit selbst beantworte. Das Schlusswort beendet die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kausalität und Korrelation
- Die Kultivierungshypothese: Vermutung, Methodik, Befunde
- Kausalität in der Kultivierungshypothese
- Die Kultivierungshypothese und das Kausalitätsproblem in der Diskussion
- Die Befunde zur von Doob und Macdonald
- Paul Hirschs Kritik
- Abschließende Bewertung: War Gerbner erfolgreich im Feststellen von Kausalität?
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kultivierungshypothese von George Gerbner im Hinblick auf die Frage, ob die postulierte kausale Beziehung zwischen Fernsehkonsum und Einstellungen der Konsumenten (vorläufig) anzunehmen ist. Es wird geprüft, ob die Hypothese widerlegt oder vorläufig akzeptiert werden kann, indem methodische Anforderungen wissenschaftlicher Forschung, insbesondere die Widerlegbarkeit von Theorien, berücksichtigt werden.
- Kausalität vs. Korrelation
- Methodische Anforderungen an den Kausalitätsnachweis
- Die Kultivierungshypothese und ihre methodischen Grundlagen
- Diskussion bestehender Forschungsergebnisse zur Kausalität in der Kultivierungshypothese
- Abschließende Bewertung der Kausalitätsaussage in der Kultivierungshypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die Problematik der Kausalitätszuschreibung im Kontext des Einflusses des Fernsehens auf soziale Probleme beschreibt. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Annahme oder Zurückweisung der kausalen Beziehung in Gerbners Kultivierungshypothese und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kausalität und Korrelation: Dieses Kapitel differenziert zwischen Kausalität und Korrelation. Es betont die Notwendigkeit, Korrelationen nicht vorschnell als Kausalitäten zu interpretieren. Die drei notwendigen Bedingungen für den Nachweis von Kausalität werden detailliert erläutert: statistische Korrelation, zeitliche Abfolge und die Kontrolle von Drittvariablen. Die Rolle der multivariaten Analyse bei der Kontrolle von Drittvariablen in nicht-experimentellen Untersuchungen wird hervorgehoben, ebenso wie die Herausforderungen, die sich aus der nicht immer vollständigen Erhebung potentiell einflussreicher Variablen ergeben.
Die Kultivierungshypothese: Vermutung, Methodik, Befunde: Dieses Kapitel beschreibt die Kultivierungshypothese selbst, einschließlich ihrer Vermutungen und methodischen Ansätze. Es wird besonders auf die Frage eingegangen, inwieweit die Hypothese eine kausale Beziehung postuliert und wie diese methodisch zu erfassen versucht wird. Die Kapitel befasst sich detailliert mit der Frage nach der Kausalität innerhalb des theoretischen Rahmens der Kultivierungshypothese.
Die Kultivierungshypothese und das Kausalitätsproblem in der Diskussion: Dieses Kapitel präsentiert die Standpunkte von Doob und Macdonald sowie Paul Hirsch zur Frage der Kausalität in der Kultivierungshypothese. Die unterschiedlichen Forschungsergebnisse und kritischen Auseinandersetzungen mit der methodischen Vorgehensweise werden analysiert und verglichen, um ein umfassendes Bild der Diskussion um die Kausalitätsfrage zu geben. Die jeweiligen methodischen Ansätze und ihre Stärken und Schwächen werden beleuchtet, und die jeweiligen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kausalität werden kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Kultivierungshypothese, George Gerbner, Kausalität, Korrelation, Fernsehkonsum, Einstellungen, Methodologie, Drittvariablen, multivariate Analyse, empirische Forschung, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Kausalität in der Kultivierungshypothese"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kultivierungshypothese von George Gerbner und analysiert kritisch, ob die postulierte kausale Beziehung zwischen Fernsehkonsum und den Einstellungen der Zuschauer bestätigt werden kann. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der methodischen Fundiertheit des Kausalitätsanspruchs der Hypothese.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Kausalität und Korrelation, den methodischen Anforderungen an den Nachweis von Kausalität, den methodischen Grundlagen der Kultivierungshypothese und der Diskussion bestehender Forschungsergebnisse zur Kausalität in diesem Kontext. Sie bewertet abschließend die Aussagekraft der Kultivierungshypothese bezüglich der Kausalitätsbehauptung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Kausalität und Korrelation, ein Kapitel zur Kultivierungshypothese (Vermutungen, Methodik, Befunde), ein Kapitel zur Diskussion der Kausalitätsfrage in der Forschung (u.a. Doob & Macdonald, Paul Hirsch) und eine abschließende Bewertung sowie Schlussbemerkung.
Welche methodischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit, Korrelationen nicht vorschnell als Kausalitäten zu interpretieren. Sie erläutert die drei notwendigen Bedingungen für den Kausalitätsnachweis (statistische Korrelation, zeitliche Abfolge, Kontrolle von Drittvariablen) und die Rolle der multivariaten Analyse. Die Herausforderungen bei der Kontrolle von Drittvariablen und die methodischen Ansätze der untersuchten Studien werden kritisch beleuchtet.
Welche Forschungsergebnisse werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Standpunkte von Doob und Macdonald sowie Paul Hirsch zur Kausalitätsfrage in der Kultivierungshypothese. Die unterschiedlichen Forschungsergebnisse und die methodischen Ansätze werden analysiert und verglichen, inklusive der Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu einer abschließenden Bewertung der Kausalitätsaussage in der Kultivierungshypothese. Ob Gerbner erfolgreich Kausalität nachgewiesen hat, wird kritisch diskutiert und bewertet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Kultivierungshypothese, George Gerbner, Kausalität, Korrelation, Fernsehkonsum, Einstellungen, Methodologie, Drittvariablen, multivariate Analyse, empirische Forschung, Medienwirkung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Kultivierungshypothese, Medienwirkungen und den methodischen Herausforderungen bei der Kausalitätsforschung auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Florian Bamberg (Autor), 2005, Das Problem der Kausalität in George Gerbners Kultivierungshypothese, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74173