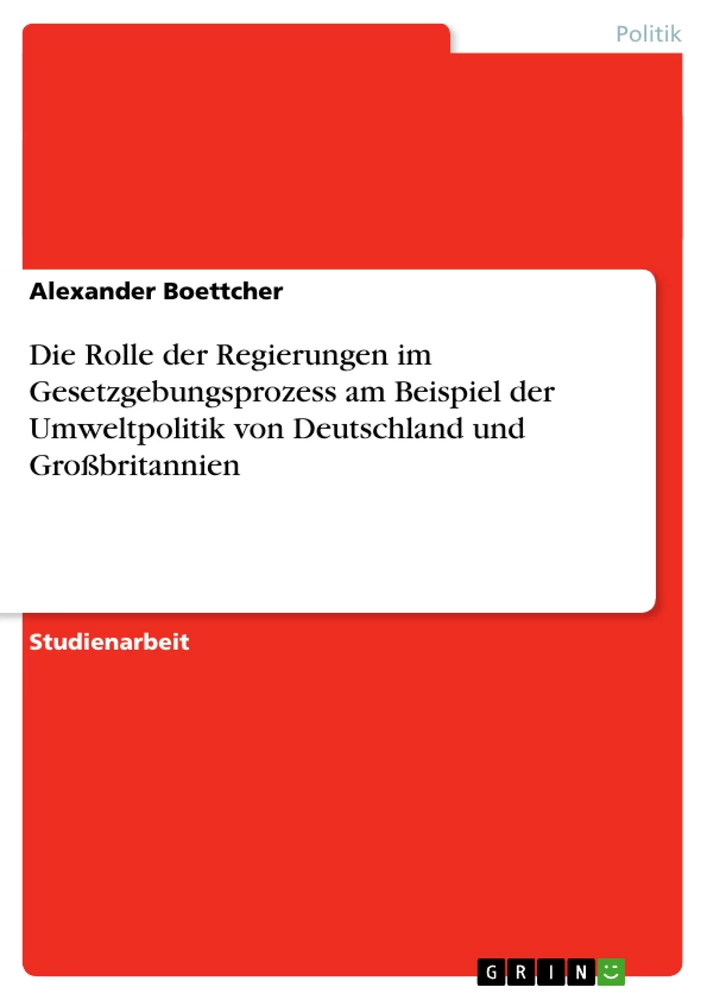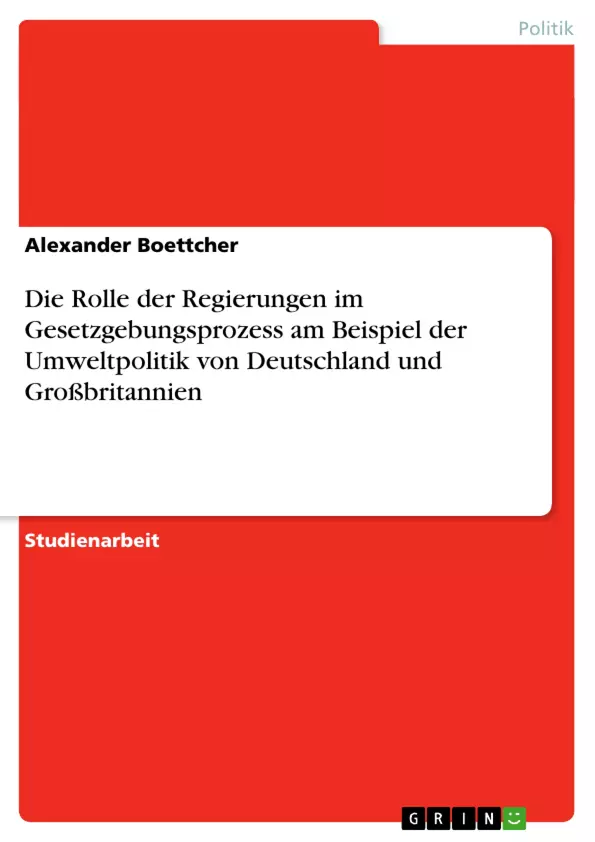„Achtung Weltuntergang – Wie gefährlich ist die globale Erwärmung wirklich?“ titelte kürzlich der Spiegel vom 6. September 2006 und berichtete ausführlich über die aktuellen sowie zukünftigen Auswirkungen der globalen Erderwärmung. Noch wird Umweltpolitik in Deutschland stiefmütterlich behandelt, trotz seiner bisherigen Vorreiterrolle Deutschlands im Bezug auf Umweltschutz und eines ausgeprägten Umweltbewusstseins. So waren 2004 92 % der Bevölkerung überzeugt, dass Umweltschutz eine wichtige politische Aufgabe sei (Kuckartz 2005: 4). Dies mag zum einen am noch jungen Politikfeld Umwelt liegen, zum anderen scheint in Zeiten zunehmender geistiger Verarmung durch die Massenmedien und Arbeitslosigkeit das Problembewusstsein verzerrt. Anlässlich einer Warnung des Ökonom Nicholas Stern, der, sollte die Politik den Kurs nicht ändern, den Schaden der Umweltverschmutzung auf 20 Prozent der Weltwirtschaft bezifferte, erklärte Bundesumweltminister Sigmar Gabriel: „Dabei gilt auch für uns was Stern sagt: Wir müssen mittelfristig ein Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Klimaschutz ausgeben. Das wären gut 22 Milliarden Euro. Nichts zu tun wird mindestens fünfmal so teuer“ (Spiegel 06.11.06: 92). Dabei sorgen der Bund, die Industrie, private und öffentlicher Verbände, sowie Kommunen und Länder derzeit mit jährlich 29,49 Milliarden Euro für ihre Umwelt. Dem Umweltministerium kommt dabei eine wichtige Rolle als Steuerungs- und Verteilungszentrale zu. In England nimmt das Umweltministerium eine ähnlich herausragende Stellung ein und verwaltet 2007 einen Jahresetat von 14,25 Milliarden Euro, jedoch ohne Einbeziehung privater und öffentlicher Träger sowie ohne Industrie.
In Deutschland wie in Großbritannien ist Umweltschutz nicht bloß Sache der Regierungen. Auch der Naturschutz- und Industrieverbände, die nach Implementierung ihrer Interessen streben, Parteien, die um den korrekten Kurs ringen, sowie eine breite Kompetenzverteilung in der Umweltpolitik auf Bundesland, Nationalstaat und Europäische Union (EU) definieren die Inhalte zum Umweltschutz mit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Umweltpolitik in Deutschland und Großbritannien
- Die Rolle der Regierungen in einem parlamentarischen Regierungssystem
- Das Wahlrecht und seine Auswirkungen auf das politische System
- Das Spannungsfeld zwischen Regierung und Parlament
- Äußere und innere Einflüsse auf die Regierungstätigkeit
- Föderalismus contra Devolution
- Parteien
- Interessenverbände
- Die Europäische Union als supranationaler Akteur
- Der Gesetzgebungsprozess
- Deutschland
- England
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausklausur analysiert die Rolle der Regierungen im Gesetzgebungsprozess, insbesondere im Bereich der Umweltpolitik, anhand eines Vergleichs zwischen Deutschland und Großbritannien. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in den Regierungsstrukturen und den Einfluss verschiedener Akteure auf die Gesetzgebung, mit dem Ziel, die Arbeitshypothese zu überprüfen: Im Gegensatz zur zentralistisch agierenden britischen Regierung arbeitet die deutsche Regierung im Gesetzgebungsprozess konsensorientiert.
- Vergleich der Regierungsstrukturen in Deutschland und Großbritannien
- Analyse der Rolle des Wahlrechts und der Mehrheitsverhältnisse im Parlament
- Untersuchung der Bedeutung von Föderalismus und Devolution
- Einfluss von Parteien und Interessenverbänden auf die Umweltpolitik
- Bedeutung der Europäischen Union als supranationaler Akteur im Gesetzgebungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Bedeutung der Umweltpolitik im Kontext der globalen Erwärmung. Sie stellt die Arbeitshypothese vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft wird.
Kapitel 2 stellt die Besonderheiten der Umweltpolitik in Deutschland und Großbritannien dar, insbesondere die Entwicklung des Politikfeldes, die Bedeutung von Umweltministerien und die Rolle von Interessenverbänden.
Kapitel 3 widmet sich der Rolle der Regierungen in parlamentarischen Regierungssystemen. Es analysiert das Wahlrecht und seine Auswirkungen auf das politische System sowie die Spannungsverhältnisse zwischen Regierung und Parlament.
Kapitel 4 untersucht die äußeren und inneren Einflüsse auf die Regierungstätigkeit, mit besonderem Fokus auf Föderalismus und Devolution, den Einfluss von Parteien und Interessenverbänden sowie die Rolle der Europäischen Union.
Kapitel 5 beleuchtet den Gesetzgebungsprozess in Deutschland und England, um die spezifischen Abläufe und Besonderheiten der beiden Länder zu vergleichen.
Schlüsselwörter
Umweltpolitik, Gesetzgebungsprozess, Regierung, Parlament, Föderalismus, Devolution, Parteien, Interessenverbände, Europäische Union, Deutschland, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich der Gesetzgebungsprozess in Deutschland und Großbritannien?
In Deutschland ist der Prozess stark konsensorientiert, während die britische Regierung in ihrem zentralistischen System oft direkter agieren kann.
Welchen Einfluss hat der Föderalismus auf die deutsche Umweltpolitik?
Der Föderalismus führt zu einer Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, was Abstimmungsprozesse komplexer, aber oft auch breiter abgestützt macht.
Was ist der Unterschied zwischen Föderalismus und Devolution?
Föderalismus ist eine verfassungsrechtlich garantierte Eigenständigkeit der Länder (Deutschland), während Devolution die Übertragung von Machtbefugnissen an Regionen durch das Zentralparlament (Großbritannien) beschreibt.
Welche Rolle spielt die EU in der nationalen Umweltpolitik?
Die EU fungiert als supranationaler Akteur, der verbindliche Umweltstandards setzt, die von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen.
Wie beeinflussen Interessenverbände die Gesetzgebung?
Sowohl Naturschutz- als auch Industrieverbände versuchen, ihre Interessen durch Lobbyarbeit in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, um politische Entscheidungen mitzugestalten.
- Quote paper
- Alexander Boettcher (Author), 2006, Die Rolle der Regierungen im Gesetzgebungsprozess am Beispiel der Umweltpolitik von Deutschland und Großbritannien , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74214