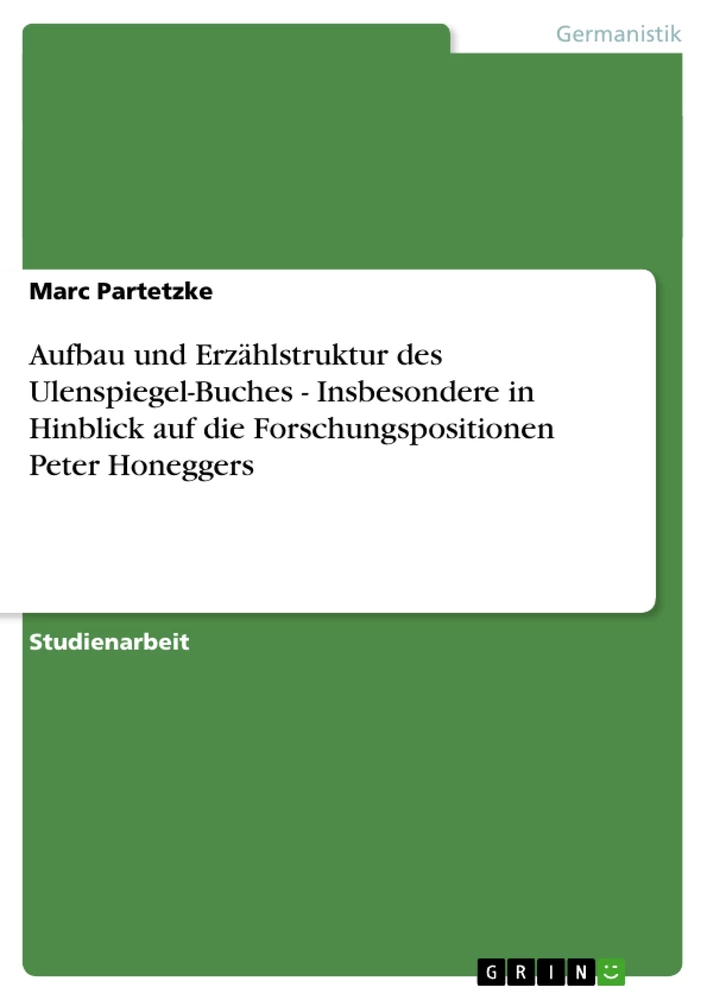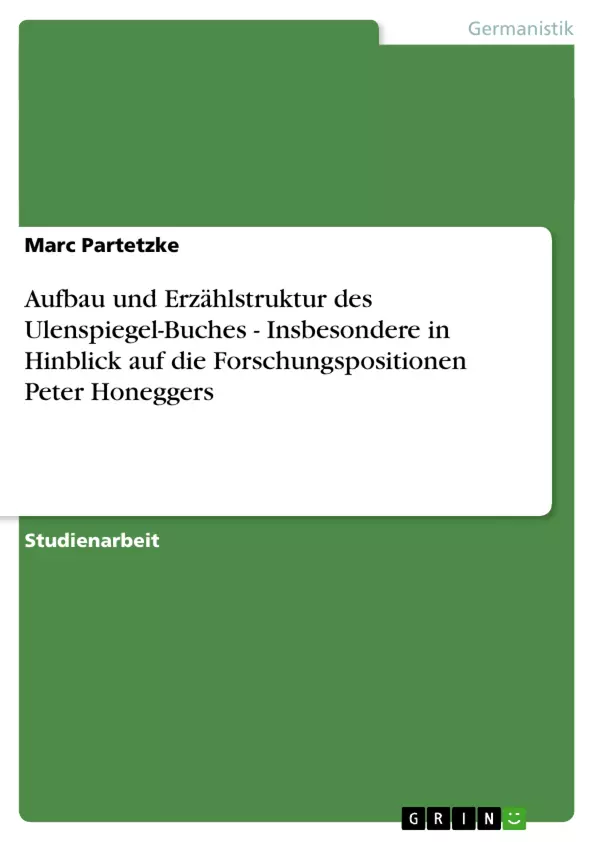Anknüpfend an das im Hauptseminar „Ulenspiegel“ gehaltene Referat „Ulenspiegel. Akrostichon und Erzählstruktur“ soll mit dieser Hausarbeit der Versuch unternommen werden, tiefer in die Thematik einzusteigen, weitere Informationen zu liefern und sich kritischer mit einzelnen Forschungspositionen auseinanderzusetzen. Unterstellt werden soll dabei, dass Herman Bote gemeinhin als der Verfasser des „Ulenspiegel“ gilt. Auch wenn zeitweilig andere Persönlichkeiten, wie z.B. Dr. Thomas Murner als Autoren gehandelt wurden/ werden, erscheint es in der Forschungsliteratur dennoch so, als sei H. Bote weithin als Ulenspiegelschöpfer anerkannt. Einen nicht zu verachtenden Anteil an dieser wissenschaftlichen Position hat Peter Honegger, der mit seiner 1973 erschienen Publikation „Ulenspiegel. Ein Beitrag zur Druckgeschichte und Verfasserfrage“ für neue Erkenntnisse in der Ulenspiegelforschung sorgte. Doch nicht nur in Bezug auf den Verfasser lieferte P. Honegger wichtige Informationen, sondern auch hinsichtlich der gesamten Erzählstruktur des Textes. Ich möchte daher im ersten Abschnitt auf die Fragen der Verfasserschaft und der vermeintlichen Erzählstruktur des „Ulenspiegel“ nach Peter Honegger eingehen und mich im zweiten Teil dieser Arbeit damit kritisch auseinandersetzten. Dabei sollen auch andere Konzepte zur Erzählstruktur in den Blick genommen werden. – Dies ergibt sogleich einen Blick auf die verwendete Forschungsliteratur. Hauptsächlich werde ich mit P. Honeggers Publikation arbeiten – nicht zuletzt wegen der methodischen Praktikabilität. Die Mehrzahl der übrigen Literatur wird dann entweder zusätzliche Informationen liefern, flankierend wirken oder in kritischer (Op-)Position zu den Ansichten Honeggers stehen, damit ein umfangreicheres Bild bezüglich der Verfasserfrage und Erzählstruktur gezeichnet werden kann, als dies mittels einer einzigen Publikation möglich ist. Textgrundlage der Arbeit ist die Ulenspiegelausgabe von Reclam „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515“, herausgegeben von Wolfgang Lindow.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Verfasserfrage
- Herman Bote – Verfasser des „Ulenspiegel“!?
- Formale und inhaltliche Erzählstruktur des „Ulenspiegel“
- Exkurs: Sinn und Intention von Akrosticha
- Kritische Auseinandersetzung mit den Positionen Honeggers
- Weitere Versionen bezüglich des „Ulenspiegel“-Aufbaus
- Der Eulenspiegelaufbau nach Ekkehard Borries
- „Der Aufbau des Eulenspiegel-Volksbuches von 1515“ nach Werner Hilsberg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Aufbau und die Erzählstruktur des „Ulenspiegel“-Buches, insbesondere im Hinblick auf die Forschungspositionen Peter Honeggers. Ziel ist es, die Verfasserfrage zu beleuchten und verschiedene Konzepte zur Erzählstruktur kritisch zu vergleichen. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Rekonstruktion der ursprünglichen Struktur des Textes.
- Die Verfasserfrage des „Ulenspiegel“ und die Rolle von Herman Bote
- Analyse der formalen und inhaltlichen Erzählstruktur nach Honegger
- Kritische Bewertung von Honeggers Methoden und Schlussfolgerungen
- Alternative Konzepte zur Strukturierung des „Ulenspiegel“
- Die Bedeutung von Akrostichen und anderen kryptographischen Elementen im Text
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit setzt den Fokus auf die tiefergehende Erforschung der Thematik des „Ulenspiegel“, liefert zusätzliche Informationen und setzt sich kritisch mit einzelnen Forschungspositionen auseinander. Ausgehend von der Annahme, dass Herman Bote der Verfasser ist, werden die Fragen der Verfasserschaft und der Erzählstruktur nach Peter Honegger untersucht und kritisch bewertet, wobei auch alternative Konzepte berücksichtigt werden. Die Arbeit basiert auf Honeggers Publikation und weiterer Literatur.
Die Verfasserfrage: Bis zur Veröffentlichung von Honeggers Arbeit bestand das Hauptproblem in der Methodik der Verfasserforschung. Der Fokus lag nicht auf der Suche nach dem Autor, sondern auf dem ursprünglichen Text. Die heutige Version zeigt Inkonsistenzen in Sprache, Handlung und Charakterisierung, was auf mehrere Autoren hindeutet. Honegger argumentiert, dass man zuerst nach Spuren eines Autors suchen und dann die ihm zuzuschreibenden Teile identifizieren sollte, im Gegensatz zur bisherigen Trennung des Ursprungstextes von späteren Zusätzen.
Herman Bote – Verfasser des „Ulenspiegel“!? Unter der Annahme, dass Herman Bote der Autor ist, werden Übereinstimmungen zwischen Botes Lebenszeit und Ereignissen im „Ulenspiegel“ untersucht. Die Arbeit analysiert Botes bekannte Werke, wie das Zollverzeichnis, „Dat schichtbiok“, „Dat boek von veleme rade“ und „Der Koker“, um stilistische und inhaltliche Parallelen zum „Ulenspiegel“ aufzuzeigen. Honegger verweist auf Parallelen in der kritischen Einstellung gegenüber Handwerkern, der Bedeutung der Hansestädte, der Themenwahl, Spruchweisheiten, Wortwahl und der Verwendung von Akrostichen als Indizien für Botes Autorschaft.
Formale und inhaltliche Erzählstruktur des „Ulenspiegel“: Honegger argumentiert, dass der Druck Grüningers die ursprüngliche Struktur verfälscht habe. Er rekonstruiert die Erzählstruktur anhand von Anknüpfungspunkten der Historien, geographischer Ordnung und Hermann Botes Weltbild. Er ordnet die Historien neu, basierend auf vermeintlichen akrostichen Elementen und inhaltlichen Verbindungen, und unterteilt das Buch in vier Teile: Ulenspiegels Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Tod. Diese Neuordnung soll die ursprüngliche inhaltliche Erzählstruktur wiederherstellen.
Exkurs: Sinn und Intention von Akrosticha: Der Exkurs untersucht den Sinn von Akrostichen in Botes Werk. Akrosticha dienten in religiösen Texten als beschwörendes Element. Im Falle Botes könnten sie die Echtheit des Textes gewährleisten, den literarischen Schmuck bereichern oder als Gedächtnisstütze dienen. Die Debatte darüber, ob Botes Akrosticha eine Verschlüsselung oder eher eine spielerische Gestaltung darstellen, wird präsentiert.
Kritische Auseinandersetzung mit den Positionen Honeggers: Dieser Abschnitt bewertet Honeggers Thesen kritisch. Die Interpretation der Akrosticha wird in Frage gestellt, ebenso die philologische und methodische Vorgehensweise bei der Rekonstruktion des Aufbaus. Die Arbeit von Schönsee und anderen Autoren wird herangezogen, um die fragwürdigen Aspekte von Honeggers Methodik aufzuzeigen, wie beispielsweise die willkürliche Auswahl und Anwendung von Kriterien sowie die zweifelhafte Berücksichtigung von sprachlichen und geographischen Aspekten.
Weitere Versionen bezüglich des „Ulenspiegel“-Aufbaus: Dieser Abschnitt stellt alternative Konzepte zur Erzählstruktur vor. Borries unterscheidet zwischen textimmanenten und inhaltlichen Bezügen und gliedert den Text in Historiengruppen. Hilsberg definiert den „Ulenspiegel“ als Schwankbiographie und analysiert den Aufbau anhand von Akkumulation, Serie, Reihung und Verkettung. Er untersucht die Verbindungen zwischen den Historien und gliedert das Werk in Serien und Reihen.
Fazit: Die Arbeit würdigt Honeggers Beiträge zur „Ulenspiegel“-Forschung, betont aber auch die kritischen Aspekte seiner Methoden und Schlussfolgerungen. Alternative Ansätze werden präsentiert, die auf unterschiedliche Prinzipien der Strukturierung basieren. Die Arbeit schliesst mit der Feststellung, dass eine definitive Rekonstruktion des ursprünglichen Aufbaus wahrscheinlich unmöglich ist und dass der Wert des Werkes unabhängig von der endgültigen Klärung dieser Frage bestehen bleibt.
Schlüsselwörter
Till Eulenspiegel, Herman Bote, Verfasserfrage, Erzählstruktur, Akrostichon, Kryptogramm, Schwankliteratur, Schwankbiographie, Hochdeutsch, Niederdeutsch, Textrekonstruktion, Peter Honegger, Ekkehard Borries, Werner Hilsberg, Ständebuch, Historiengruppen, Serien, Reihen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Der Aufbau des Till Eulenspiegel-Volksbuches"
Wer ist der mutmaßliche Verfasser des Till Eulenspiegel?
Die Hausarbeit untersucht die Verfasserfrage des Till Eulenspiegel-Volksbuches und konzentriert sich auf die These, dass Herman Bote der Autor ist. Diese These wird anhand von stilistischen und inhaltlichen Parallelen zwischen Botes bekannten Werken und dem Eulenspiegel-Text untersucht. Die Arbeit vergleicht Botes Schriften wie das Zollverzeichnis, „Dat schichtbiok“, „Dat boek von veleme rade“ und „Der Koker“ mit dem Eulenspiegel, um Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit zur Klärung der Verfasserfrage angewendet?
Die Arbeit analysiert Übereinstimmungen zwischen Botes Lebenszeit und Ereignissen im „Ulenspiegel“. Es werden stilistische und inhaltliche Parallelen in Bezug auf die kritische Einstellung gegenüber Handwerkern, die Bedeutung der Hansestädte, die Themenwahl, Spruchweisheiten, Wortwahl und die Verwendung von Akrostichen untersucht, um die Autorschaft Botes zu belegen. Die Methodik wird kritisch hinterfragt und mit alternativen Ansätzen verglichen.
Wie wird die Erzählstruktur des Till Eulenspiegel in der Arbeit analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die formale und inhaltliche Erzählstruktur des „Ulenspiegel“-Buches, insbesondere im Hinblick auf die Forschungspositionen von Peter Honegger. Honegger rekonstruiert die Erzählstruktur anhand von Anknüpfungspunkten der Historien, geographischer Ordnung und Hermann Botes Weltbild. Die Arbeit präsentiert Honeggers Neuordnung des Buches in vier Teile und bewertet diese kritisch. Zusätzlich werden alternative Konzepte zur Strukturierung des Werkes von Borries und Hilsberg vorgestellt und verglichen.
Welche Rolle spielen Akrosticha in der Analyse?
Die Bedeutung von Akrostichen und anderen kryptographischen Elementen im Text wird untersucht. Es wird diskutiert, ob die Akrosticha in Botes Werk eine Verschlüsselung, ein literarischer Schmuck oder eine Gedächtnisstütze darstellen. Honeggers Interpretation der Akrosticha wird kritisch hinterfragt und ihre Rolle in der Rekonstruktion der Erzählstruktur bewertet.
Welche kritischen Auseinandersetzungen werden mit Honeggers Positionen geführt?
Die Hausarbeit bewertet Honeggers Thesen kritisch. Die Interpretation der Akrosticha, die philologische und methodische Vorgehensweise bei der Rekonstruktion des Aufbaus und die Auswahl und Anwendung seiner Kriterien werden in Frage gestellt. Die Arbeit von Schönsee und anderen Autoren wird herangezogen, um die fragwürdigen Aspekte von Honeggers Methodik aufzuzeigen.
Welche alternativen Konzepte zur Strukturierung des "Ulenspiegel" werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert alternative Konzepte zur Erzählstruktur von Ekkehard Borries und Werner Hilsberg. Borries unterscheidet zwischen textimmanenten und inhaltlichen Bezügen und gliedert den Text in Historiengruppen. Hilsberg definiert den „Ulenspiegel“ als Schwankbiographie und analysiert den Aufbau anhand von Akkumulation, Serie, Reihung und Verkettung.
Welches Fazit zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit würdigt Honeggers Beiträge zur „Ulenspiegel“-Forschung, hebt aber auch die kritischen Aspekte seiner Methoden und Schlussfolgerungen hervor. Alternative Ansätze werden präsentiert, die auf unterschiedliche Prinzipien der Strukturierung basieren. Die Arbeit schliesst mit der Feststellung, dass eine definitive Rekonstruktion des ursprünglichen Aufbaus wahrscheinlich unmöglich ist und dass der Wert des Werkes unabhängig von der endgültigen Klärung dieser Frage bestehen bleibt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Till Eulenspiegel, Herman Bote, Verfasserfrage, Erzählstruktur, Akrostichon, Kryptogramm, Schwankliteratur, Schwankbiographie, Hochdeutsch, Niederdeutsch, Textrekonstruktion, Peter Honegger, Ekkehard Borries, Werner Hilsberg, Ständebuch, Historiengruppen, Serien, Reihen.
- Citar trabajo
- Marc Partetzke (Autor), 2006, Aufbau und Erzählstruktur des Ulenspiegel-Buches - Insbesondere in Hinblick auf die Forschungspositionen Peter Honeggers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74240