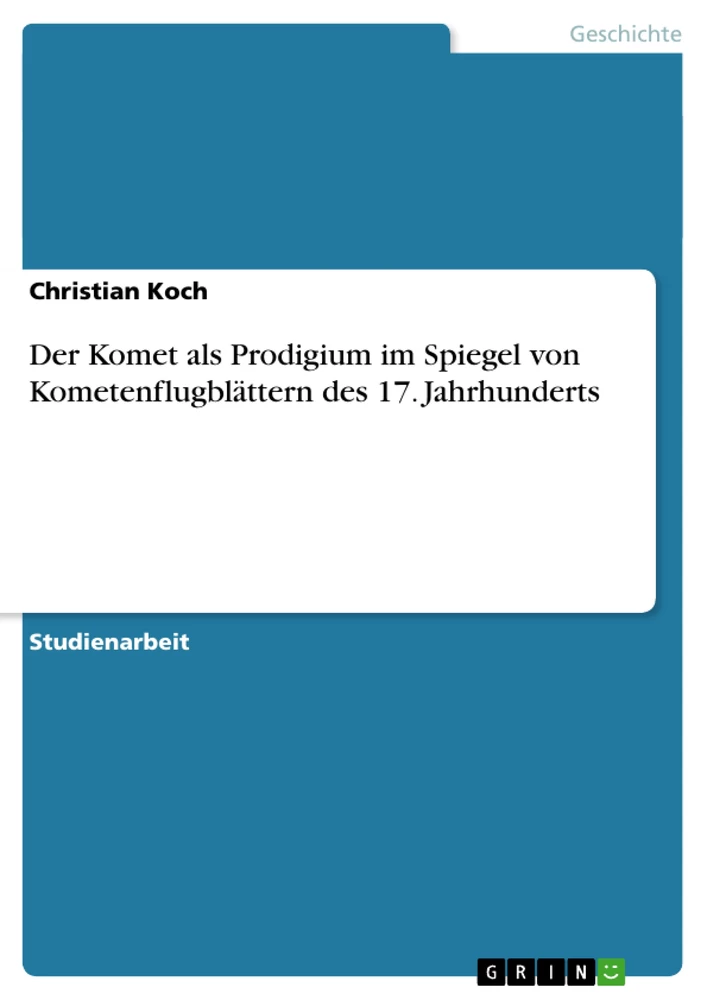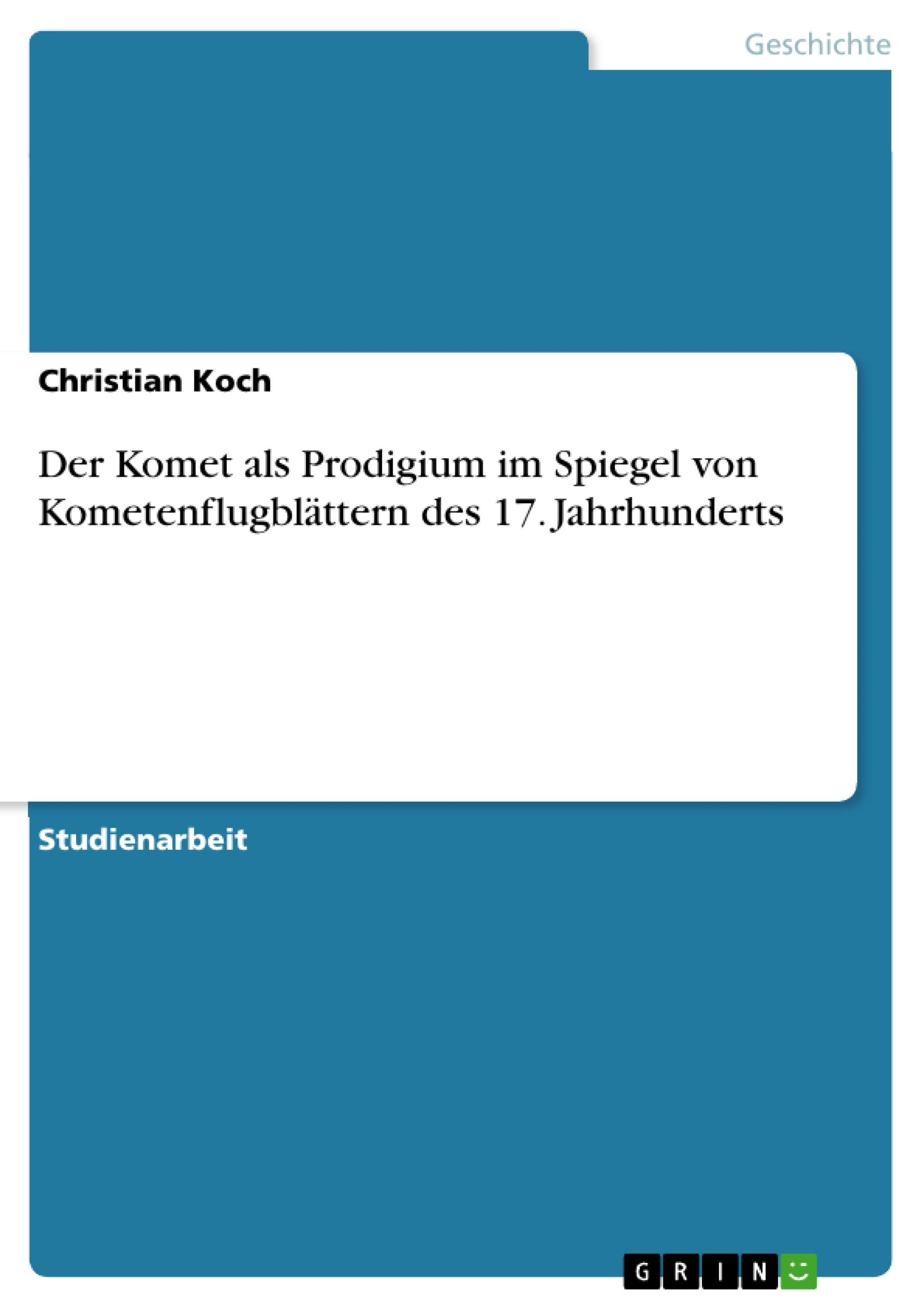Das illustrierte Flugblatt war in der Frühen Neuzeit ein weit verbreitetes Massen-medium. In der vorliegenden Arbeit wird mit den Kometenflugblättern eine Gat-tung aus dem vielfältigen Themenspektrum der Flugblätter jener Zeit vorgestellt. Die Untersuchung beschränkt sich zwar, bis auf eine Ausnahme, auf Flugblätter aus dem deutschen Sprachraum, jedoch lassen sich viele der an deutschen Flug-blättern gewonnen Ergebnisse auch auf die Nachbarländer übertragen. Bei der Betrachtung der Kometendrucke wird der Frage nachgegangen, ob die Kometen-flugblätter als ein Symptom einer Krise des 17. Jahrhunderts betrachtet werden können. Wenn dem so ist, müsste die Kometenfurcht im 17. Jahrhundert beson-ders groß gewesen sein und sich der Prodigienglaube in dieser Zeit verstärkt ha-ben. Im Folgenden soll dagegen gezeigt werden, dass die Furcht vor Kometen zu allen Zeiten und bis in die Gegenwart ein Teil der menschlichen Gesellschaft war und die Flugblätter selber zum Krisenbewusstsein im 17. Jahrhundert beitrugen, indem sie Ängste schürten und als Instrument der Sozialdisziplinierung und Pro-paganda benutzt wurden.
Die Prodigieneigenschaft von Kometen steht also im Mittelpunkt dieser Untersuchung, was dazu führt, dass eine Eingrenzung bei den zu behandelnden Flugblät-tern vorgenommen werden muss. Behandelt werden ausschließlich Kometenblät-ter, welche die Kometen als göttliche Vorzeichen betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- A. Thema und Aufbau der Arbeit
- B. Literatur
- C. Quellen
- II. Der Komet als Prodigium im 17. Jahrhundert
- A. Prodigenliteratur bei Protestanten und Katholiken
- B. Der Komet als Prodigium
- C. Kometen als Instrument der Sozialdisziplinierung
- III. Der Komet als Vorzeichen von Krieg
- A. Der Dreißigjährige Krieg
- B. Die Furcht vor den Türken
- IV. Die Kometenfurcht als Indikator einer Krise des 17. Jahrhunderts
- A. Prodigienliteratur und Krise
- B. Der Komet als positives Vorzeichen
- V. Der Wandel des Kometenbildes
- A. Vom Wunderzeichen zum erklärbaren Phänomen
- B. Die neue Kometenfurcht
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Kometen auf Flugschriften des 17. Jahrhunderts und deren Bedeutung im Kontext der damaligen Gesellschaft. Die zentrale Frage ist, ob die Kometenfurcht als Symptom einer umfassenderen Krise des 17. Jahrhunderts interpretiert werden kann. Die Arbeit widerlegt diese These, indem sie zeigt, dass Kometenfurcht zu allen Zeiten präsent war und die Flugschriften selbst zum Krisenbewusstsein beitrugen, indem sie Ängste schürten und als Instrument der Sozialdisziplinierung und Propaganda dienten.
- Die Rolle von Kometen als Prodigien in der frühneuzeitlichen Gesellschaft
- Die unterschiedliche Rezeption von Prodigienliteratur bei Protestanten und Katholiken
- Die Instrumentalisierung der Kometenfurcht für Zwecke der Sozialdisziplinierung und Propaganda
- Die Deutung von Kometen als Vorboten von Krieg (Dreißigjähriger Krieg und osmanische Bedrohung)
- Der Wandel des Kometenbildes vom Wunderzeichen zum wissenschaftlich erklärbaren Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es wird die Bedeutung von Flugschriften als Massenmedium der Frühen Neuzeit hervorgehoben und die Fokussierung auf Kometenflugblätter aus dem deutschsprachigen Raum begründet. Die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle von Kometenflugblättern als Krisensymptom des 17. Jahrhunderts wird formuliert, wobei bereits angedeutet wird, dass die Arbeit diese These widerlegen wird. Es wird die Methodik erläutert, die sich auf Kometenblätter konzentriert, die Kometen als göttliche Vorzeichen deuten. Der Aufbau der Arbeit in vier Hauptabschnitte wird skizziert.
II. Der Komet als Prodigium im 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Kometen als Prodigien im 17. Jahrhundert. Es untersucht die Überrepräsentation protestantischer Autoren in der Prodigienliteratur, ohne den konfessionsübergreifenden Charakter des Aberglaubens zu leugnen. Die unterschiedliche Nutzung des Buchdrucks durch Protestanten und Katholiken wird diskutiert. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Kometen als göttliche Vorzeichen, sowohl als Ankündigung der Endzeit als auch als Zeichen göttlichen Zorns. Es werden verschiedene Beispiele aus der Kometenliteratur analysiert, die die vielschichtigen Deutungsmöglichkeiten von Kometen verdeutlichen.
III. Der Komet als Vorzeichen von Krieg: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Kometenerscheinungen und Kriegen im 17. Jahrhundert, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg und die osmanische Bedrohung. Es werden konkrete Beispiele von Kometenflugblättern analysiert, die diese Ereignisse als göttliche Strafen oder Warnungen interpretieren. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die sowohl negative als auch positive Aspekte berücksichtigen, je nach dem, ob die Bedrohung von innen (Dreißigjähriger Krieg) oder von außen (Osmanen) kam.
IV. Die Kometenfurcht als Indikator einer Krise des 17. Jahrhunderts: Dieses Kapitel hinterfragt die These, dass die Kometenfurcht ein Indikator für eine allgemeine Krise des 17. Jahrhunderts sei. Es wird die "Kleine Eiszeit" und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in Europa thematisiert, aber die These einer direkten Verbindung zwischen Kometenflugschriften und der "Kleinen Eiszeit" verworfen. Die Arbeit stellt die Bedeutung der Flugschriften im Kontext der damaligen Kommunikationsmöglichkeiten heraus und argumentiert, dass diese nicht nur ein krisenhaftes Zeitgefühl widerspiegelten, sondern dieses auch aktiv mitgestalteten und verstärkten. Die Übertreibungen in der ikonographischen Darstellung von Kometen werden im Kontext der Verkaufsstrategien des Flugblattmarktes betrachtet.
V. Der Wandel des Kometenbildes: Das Kapitel beschreibt den Wandel im Verständnis von Kometen vom Ende des 17. Jahrhunderts an. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse Halleys, die die berechenbaren Bahnen von Kometen aufzeigten, führten zu einer Entmythologisierung, ohne den Aberglauben vollständig zu beseitigen. Es wird die Entstehung einer "neuen Kometenfurcht" im 18. Jahrhundert beschrieben, die sich auf die Angst vor einem möglichen Kometeneinschlag konzentrierte. Beispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert illustrieren die anhaltende Verbindung zwischen Kometen und Katastrophenängsten, sowie die instrumentalisierte Ausnutzung dieser Ängste.
Schlüsselwörter
Kometen, Flugschriften, 17. Jahrhundert, Prodigien, Prodigienliteratur, Frühneuzeit, Dreißigjähriger Krieg, Osmanisches Reich, Sozialdisziplinierung, Propaganda, Krisenbewusstsein, Bildpublizistik, Wunderzeichen, Aberglaube, Edmond Halley, Neue Kometenfurcht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Kometen auf Flugschriften des 17. Jahrhunderts
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Kometen auf Flugschriften des 17. Jahrhunderts und deren Bedeutung im Kontext der damaligen Gesellschaft. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob die Kometenfurcht als Symptom einer umfassenderen Krise des 17. Jahrhunderts interpretiert werden kann.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann die Kometenfurcht als Symptom einer umfassenden Krise des 17. Jahrhunderts interpretiert werden? Die Arbeit widerlegt diese These.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Kometenflugblätter aus dem deutschsprachigen Raum des 17. Jahrhunderts, die Kometen als göttliche Vorzeichen deuten. Es werden verschiedene Beispiele aus der Kometenliteratur analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der Komet als Prodigium im 17. Jahrhundert, Der Komet als Vorzeichen von Krieg, Die Kometenfurcht als Indikator einer Krise des 17. Jahrhunderts, Der Wandel des Kometenbildes und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Kometeninterpretation und -rezeption im 17. Jahrhundert.
Welche Rolle spielten Kometen im 17. Jahrhundert?
Kometen wurden als Prodigien interpretiert, d.h. als göttliche Zeichen oder Warnungen. Sie wurden mit Ereignissen wie dem Dreißigjährigen Krieg und der osmanischen Bedrohung in Verbindung gebracht. Die Interpretationen waren vielschichtig und konfessionsabhängig (Protestanten und Katholiken).
Wie wurde die Kometenfurcht instrumentalisiert?
Die Kometenfurcht wurde für Zwecke der Sozialdisziplinierung und Propaganda instrumentalisiert. Flugschriften schürten Ängste und nutzten die Kometen als Mittel zur Verbreitung von bestimmten politischen oder religiösen Botschaften.
Gab es Unterschiede in der Rezeption von Kometen zwischen Protestanten und Katholiken?
Die Arbeit untersucht die unterschiedliche Rezeption von Prodigienliteratur bei Protestanten und Katholiken, fokussiert auf die unterschiedliche Nutzung des Buchdrucks.
Wie hat sich das Kometenbild im Laufe der Zeit verändert?
Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wie denen von Halley, begann ein Wandel im Verständnis von Kometen. Kometen wurden zunehmend als wissenschaftlich erklärbare Phänomene betrachtet, was zur Entmythologisierung, aber nicht zur vollständigen Beseitigung des Aberglaubens führte. Eine "neue Kometenfurcht" entstand, fokussiert auf die Angst vor einem möglichen Kometeneinschlag.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit widerlegt die These, dass die Kometenfurcht ein eindeutiges Indiz für eine umfassende Krise im 17. Jahrhundert darstellt. Sie argumentiert, dass Kometenfurcht zu allen Zeiten präsent war und Flugschriften diese Ängste aktiv mitgestalteten und verstärkten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Kometen, Flugschriften, 17. Jahrhundert, Prodigien, Prodigienliteratur, Frühneuzeit, Dreißigjähriger Krieg, Osmanisches Reich, Sozialdisziplinierung, Propaganda, Krisenbewusstsein, Bildpublizistik, Wunderzeichen, Aberglaube, Edmond Halley, Neue Kometenfurcht.
- Citation du texte
- Christian Koch (Auteur), 2007, Der Komet als Prodigium im Spiegel von Kometenflugblättern des 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74270